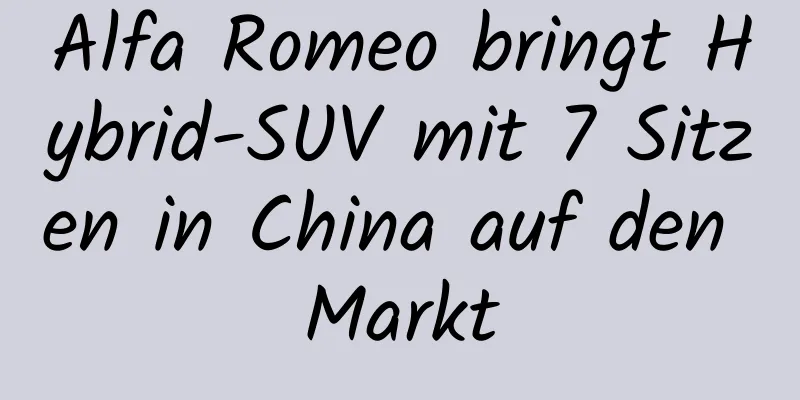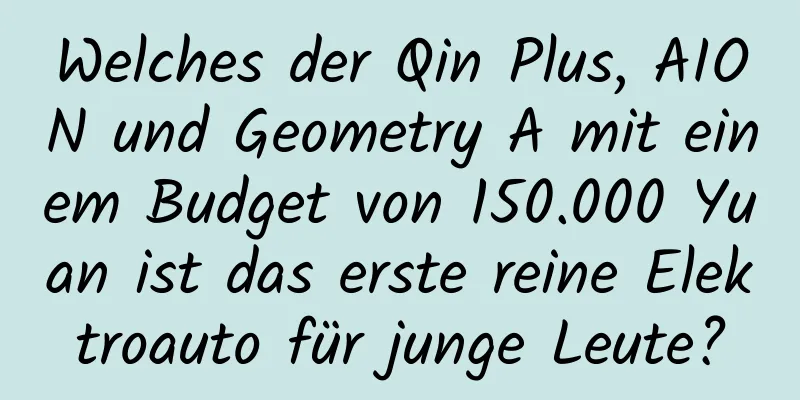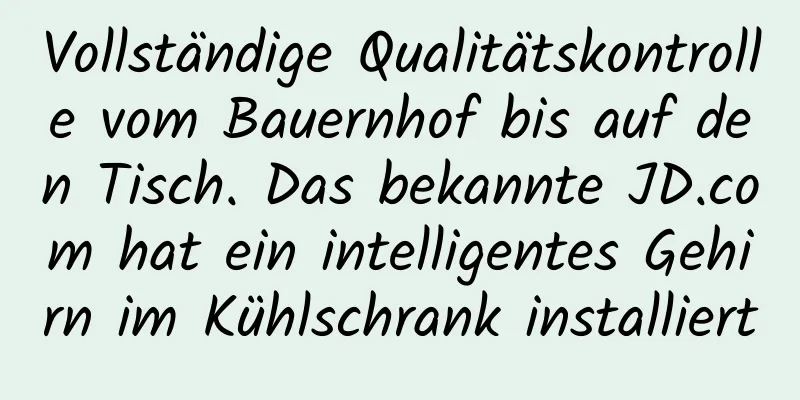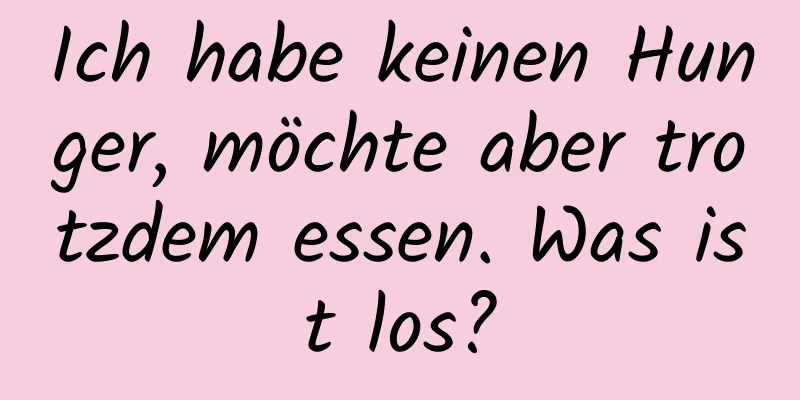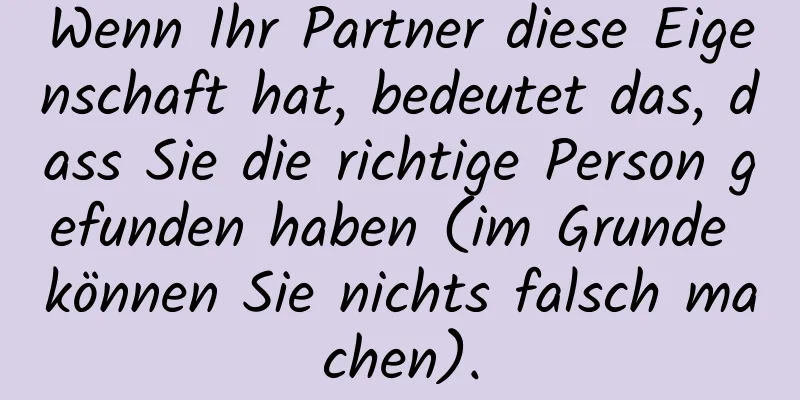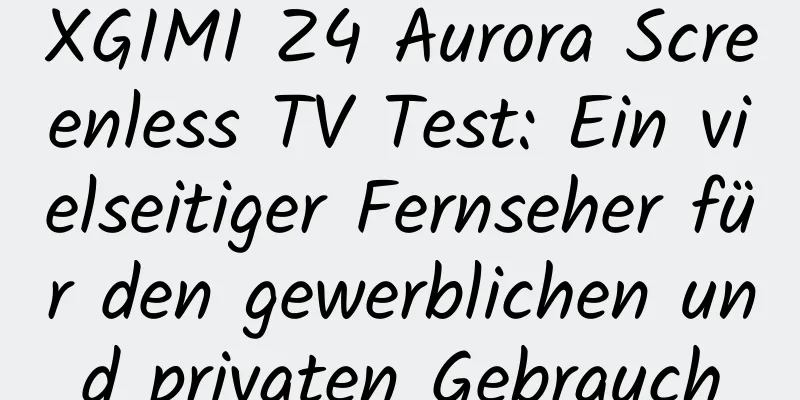Retortenbabys werden nicht im Reagenzglas geboren – wann wird aus dem Embryo ein „Mensch“? | Entfalten
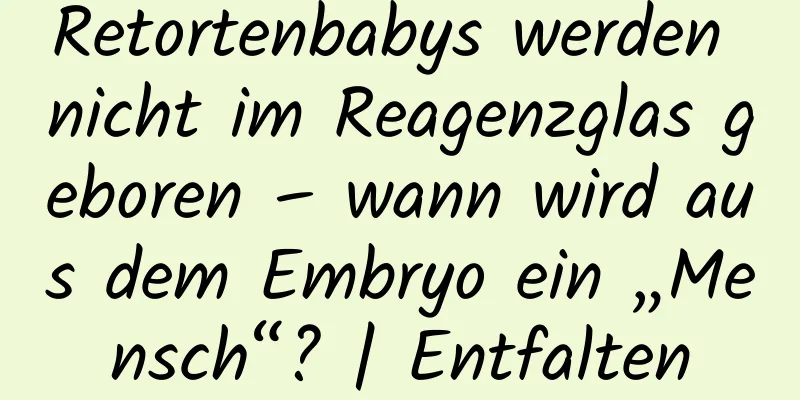
|
Die In-vitro-Fertilisation hat die Art und Weise, wie wir Kinder bekommen, verändert, bietet aber noch viel mehr. Es stellt unsere Sicht auf uns selbst auf eine Weise auf den Kopf, die nur wenige erkennen. Es zeigt uns, dass sich der Mensch aus einer einzigen Zelle entwickelt, was die Grenze zwischen Zelle und Mensch komplizierter macht. Eine Ansicht besagt, dass der Embryo eine Gruppe von Zellen ist, die die mütterliche Umgebung für ihre eigenen egoistischen Interessen „ausbeutet“. Dies ist besonders in den frühesten Stadien des Embryos, beispielsweise im Blastozystenstadium, deutlich zu erkennen, wenn der Embryo eher wie „menschliches Gewebe“ als wie ein Mensch aussieht. Wenn wir mit Hilfe der In-vitro-Fertilisationstechnologie in die frühen Stadien des Lebens eines Menschen eintauchen und sogar in diese eingreifen können, stellen wir fest, dass unser übliches Konzept der Persönlichkeit nicht mehr ausreicht, um den Status dieses Lebewesens zu definieren. Der Zweck der komplizierten ethischen Debatte rund um die assistierte Reproduktionstechnologie besteht daher weit über die bloße Schaffung einer geeigneten gesetzlichen Grundlage hinaus. In diesen ethischen Debatten geht es auch darum, die Frage „Was ist ein Mensch?“ neu zu definieren: Diese Zellhaufen waren einst alles, was wir hatten. Wann wurden wir zu diesen Zellhaufen? Dieser Artikel darf ausschließlich aus „How to Make a Person“ (CITIC Press) entnommen werden. Der Inhalt wurde bearbeitet und der Titel vom Redakteur hinzugefügt. Gehen Sie zu „Fanpu“ und klicken Sie am Ende des Artikels auf „Originaltext lesen“, um dieses Buch zu kaufen. Klicken Sie auf „Lesen“ und posten Sie Ihre Gedanken im Kommentarbereich. Bis zum 05.09.2021, 12:00 Uhr, werden wir 2 Kommentare auswählen und 2 Bücher verlosen. Der heutige Weibo-Vorteil: Folgen Sie @返朴, reposten Sie dieses Weibo und @ einen Freund. Bis zum 5. September 2021, 12:00 Uhr, verlosen wir 2 Fans und schenken ihnen jeweils ein Exemplar von „How to Create a Person“. Von Philip Ball Übersetzung | Li Ke, Wang Yating Wir wissen seit mindestens einigen Jahrhunderten, dass Geschlechtsverkehr für die Fortpflanzung nicht notwendig ist. Die erste aufgezeichnete künstliche Befruchtung wurde in den 1770er Jahren vom schottischen Chirurgen John Hunter durchgeführt. Hunter soll die Frau eines Mannes durch künstliche Befruchtung mit seinem Sperma geschwängert haben. Ausführlichere Aufzeichnungen über künstliche Befruchtung erschienen im Jahr 1884, als der amerikanische Arzt William Pancoast eine Frau unter Vollnarkose (als Narkosemittel wurde Chloroform verwendet) mit Spendersamen künstlich befruchtete und sie erfolgreich schwängerte. (Originalanmerkung: „Spender“ war zu dieser Zeit kein Begriff. Das Sperma stammte angeblich von einem von Pancosts Schülern. Unter Pancosts Schülern galt er als der Schönste und Eleganteste. Die Schüler hatten geschworen, dies geheim zu halten.) Zuvor hatte Pancost das Sperma des Mannes der Frau unter dem Mikroskop untersucht und festgestellt, dass dieser unfruchtbar war. Pancoast dachte offensichtlich, er würde ihm einen Gefallen tun. Weder die Frau noch ihr Mann wussten damals, dass Pancost eine künstliche Befruchtung durchgeführt hatte. Pancost erzählte ihrem Mann später von der Situation, doch seine Frau wurde im Dunkeln gelassen. (Originalnotiz: Der Grund, warum er seiner Frau die Wahrheit verheimlichte, ist unbekannt. Obwohl die ethischen Fragen der künstlichen Befruchtung heute schockierend erscheinen, hinderte dies die Menschen auch daran, diesen Vorfall eingehend zu diskutieren. Lag es daran, dass sie befürchteten, die Mutter würde ihr Kind nicht mehr lieben, wenn sie die Wahrheit erfuhr? Lag es daran, dass sie befürchteten, sie würde schockiert sein und sich für die Operation schämen? Lag es daran, dass sie befürchteten, sie würde Pancost und seine Schüler verurteilen? Ist der Ausgangspunkt dieses paternalistischen Chauvinismus einfach? Dieser Vorfall ist zweifellos ein erwähnenswerter Knotenpunkt in der Entwicklung der öffentlichen Haltung gegenüber assistierter Reproduktionstechnologie.) Damals konnten mithilfe von Mikroskopen die biologischen Vorgänge der Empfängnis sichtbar gemacht werden. Im Jahr 1879 beobachtete der Schweizer Zoologe Hermann Fol erstmals das Eindringen eines Spermiums in eine Eizelle, obwohl sich aus der befruchteten Eizelle offenbar kein Embryo bildete. Doch nachdem Carrel und Barrows die Techniken der Gewebekultur verfeinert hatten, war die Schaffung von Embryonen eines der ersten Dinge, mit denen die Forscher versuchten. Im Jahr 1912 entdeckten die amerikanischen Anatomen John McWhorter und Allen Whipple, dass sie drei Tage alte Hühnerembryos in vitro bis zu 31 Stunden am Leben erhalten konnten. Ein Jahr später demonstrierte der belgische Embryologe Albert Brachet, dass er Kaninchen-Embryonen im Blastozystenstadium in einer Kulturschale am Leben erhalten konnte. Die Erzeugung eines lebenden Embryos außerhalb des Körpers mithilfe von Spermien und Eizellen – eine echte In-vitro-Fertilisation – ist eine andere Sache. In den 1930er Jahren berichtete der amerikanische Biologe Gregory Pincus über die Erzeugung von Kaninchenembryonen durch In-vitro-Fertilisation. In den 1940er Jahren behauptete er sogar, eine In-vitro-Fertilisation menschlicher Eizellen und Spermien erfolgreich durchgeführt zu haben, doch seine Arbeit wurde nie bestätigt. Der erste glaubwürdige Bericht über die Reproduktionsförderung von Säugetieren durch In-vitro-Fertilisation erschien in den 1950er Jahren und wurde von Pincus‘ Mitarbeiter, dem chinesisch-amerikanischen Biologen Ming-Jue Chang, durchgeführt. Durch künstliche Befruchtung brachte er das weibliche Kaninchen dazu, lebende Kaninchen zur Welt zu bringen. Um zu bestätigen, dass die Kaninchen tatsächlich das Ergebnis einer künstlichen Befruchtung waren, verwendete Zhang Kaninchen unterschiedlicher Farbe: Er kombinierte Eier und Sperma von schwarzen Kaninchen und transplantierte die Embryonen dann in weiße Kaninchen. Die Kaninchen, die die Kaninchenmutter schließlich zur Welt brachte, waren schwarz. Die menschliche Befruchtung ist schwieriger. Bei der Befruchtung geht es nicht nur darum, Eizelle und Spermium zusammenzubringen und sie tun zu lassen, was sie wollen. Wie ich im vorherigen Artikel erwähnt habe, ist die Befruchtung ein komplexer Vorgang, an dem auch die weiblichen Geschlechtsorgane beteiligt sind. Lange Zeit gelang es niemandem, eine Methode zur In-vitro-Fertilisation zu finden, da wir nur sehr wenig über den biologischen Prozess der Befruchtung wussten. In den 1930er Jahren beschloss der amerikanische Geburtshelfer und Gynäkologe John Rock, die befruchtete Eizelle in den frühesten Stadien nach der Empfängnis zu untersuchen und startete damit ein Projekt, das die Menschen heute überraschen würde. Gemeinsam mit seinen Assistenten Arthur Hertig und Miriam Menkin suchte er bei Freiwilligen, denen eine Hysterektomie bevorstand, nach befruchteten Eizellen. Sie schlugen den Frauen vor, in der Nacht vor der Operation Sex zu haben. Die Frauen kamen der Bitte von Locke und anderen nach, ihre befruchteten Eizellen abzuholen, und zeigten damit ihre Großzügigkeit und Bereitschaft, unser Verständnis der Fruchtbarkeit und ihrer Hindernisse zu verbessern. Die Tatsache, dass diese Studie genehmigt wurde, lässt darauf schließen, dass das Bewusstsein für die Notwendigkeit einer medizinischen Ethik damals noch nicht ausreichend ausgeprägt war. Im Jahr 1944 behaupteten Locke und Menkin, die erste In-vitro-Fertilisation beim Menschen mit Eizellen durchgeführt zu haben, die ihnen bei einer Hysterektomie entnommen worden waren. Locke und seine Kollegen konnten zwar beobachten, wie sich die befruchtete Eizelle zu teilen begann, das war jedoch auch schon alles: Sie züchteten in der Schale keine echten Embryonen. In späteren Forschungsarbeiten leistete Locke bahnbrechende Beiträge zur Entwicklung oraler Kontrazeptiva. In den Anfängen der Entwicklung der In-vitro-Fertilisationstechnologie herrschte in der akademischen Gemeinschaft eine wilde und abenteuerliche Atmosphäre, und die Forschung zur Überprüfung von Hypothesen beruhte oft auf Kühnheit, Eloquenz und einem gewissen Maß an Arroganz. In den 1960er Jahren versuchte der Physiologe Robert Edwards während seiner Arbeit am National Institute for Medical Research im Norden Londons sein Bestes, um Eizellen von Chirurgen und Gynäkologen zu erhalten, die seine Ziele teilten. Die Eizellen wurden im Rahmen einer Eierstockoperation ohne die Zustimmung der Eizellenspenderinnen entnommen. Diese Art von Freiheit war der Trend der Zeit. Obwohl Edwards’ Motivation darin bestand, das Leiden der unter Unfruchtbarkeit leidenden Menschen zu lindern, können wir in diesem Bild eines männlichen Arztes, der mit Hilfe ahnungsloser Frauen „neues Leben“ erschafft, nicht umhin zu erkennen, dass sich die kulturelle Einstellung zur assistierten Reproduktion seit Pancosts Zeiten nicht großartig geändert hat. Wie die Anthropologin Lynn Morgan betonte, ist die Anonymität der Frauen, die die Embryonen oder Eizellen zur Verfügung stellten, ein Merkmal der Geschichte der Embryologie: Sie wurden oft als Quelle nicht identifizierten biologischen Materials betrachtet, das für die Forschung manipuliert werden konnte. Manche Feministinnen stehen Reproduktionstechnologien misstrauisch oder sogar ablehnend gegenüber. Dies liegt möglicherweise an der berechtigten Sorge, dass diese Technologien zu alten Methoden der Kontrolle und Beherrschung von Frauen zurückkehren könnten. Auf Ruhm und Ehre legt Edwards allerdings keinen großen Wert. Im Gegenteil, seine Bemühungen wurden von seinen Kollegen angegriffen und lächerlich gemacht. Martin Johnson, Edwards‘ Doktorand, fasste die damalige Arbeitsatmosphäre im Team wie folgt zusammen: Ehrlich gesagt waren wir während unserer Promotion und sogar als Postdocs in seinem Labor äußerst unsicher, ob seine Forschung ethisch vertretbar war, und wollten uns nicht zu sehr darin einmischen. Teilweise lag es daran, dass wir als Doktoranden und junge Postdocs ziemlich beunruhigt waren, als wir sahen, wie groß die Feindseligkeit war, die Außenstehenden dieser Arbeit entgegenschlugen. Als Nobelpreisträger, Stipendiaten der Royal Society und aufstrebende Stars der Disziplin Bob beschimpften und sagten, er solle diese Forschung nicht durchführen, fragte man sich unweigerlich: Was um alles in der Welt machten wir hier in unserem Labor? Trotz der Skepsis und des Widerstands seiner Kollegen, die diese Studien für unethisch hielten – so warnten beispielsweise namhafte Biologen wie James Watson und Max Perutz später, dass durch künstliche Befruchtung Babys mit schweren Geburtsfehlern entstehen könnten (Anmerkung: Wenn man bedenkt, dass durch die Technologie der In-vitro-Fertilisation in Tierversuchen keine Jungtiere mit schweren Geburtsfehlern hervorgebracht wurden, wird die Tatsache noch deutlicher: Diese Befürchtungen haben keine wissenschaftliche Grundlage) – und trotz der Weigerung des British Medical Research Council, seine Forschung zu finanzieren, veröffentlichte Edwards 1969 dennoch gemeinsam mit seinem Studenten Barry Bavister und dem Gynäkologen Patrick Steptoe einen Artikel in Nature, in dem der Prozess des Eindringens menschlicher Spermien in die Eizelle im Reagenzglas detailliert beschrieben wurde. „Die befruchtete menschliche Eizelle kann bei der Behandlung bestimmter Fälle von Unfruchtbarkeit nützlich sein“, schrieben sie. Im folgenden Jahr veröffentlichten Edwards, Steptoe und ihre klinische Assistentin Jean Purdy Fotos eines befruchteten menschlichen Embryos im 16-Zellen-Stadium. Bis 1971 gelang es ihnen, menschliche Embryonen in vitro bis zum Blastozystenstadium zu züchten. Steptoe war mit den chirurgischen Techniken zur Wiedereinpflanzung von Embryonen in die Gebärmutter vertraut und die Forscher wussten, dass es keinen Mangel an Freiwilligen geben würde, auch wenn der Eingriff höchst unsicher und sogar gefährlich war. Der Moment der Befruchtung? Das Sperma ist dabei, in die Eizelle einzudringen. Bildquelle: Science Photo Library Doch diese Fotos menschlicher Embryonen in Petrischalen haben eine tiefere Bedeutung: Zum ersten Mal können wir sehen, wo die Reise des Lebens beginnt. Zuvor konnten wir den Beginn des Lebens nur auf eine kleine menschenähnliche Gewebemasse zurückführen, in der sich ein garnelenartiger Kopf gebildet hatte. Um über unsere eigene Entwicklung nachzudenken, müssen wir zunächst in der Lage sein, die Entwicklung mitzuerleben. „Das Konzept eines Embryos ist, wie wir heute sprechen, relativ neu“, sagt Lynn Morgan. „Vor hundert Jahren konnten sich die meisten Amerikaner wahrscheinlich das Bild eines menschlichen Embryos nicht vorstellen.“ Morgan weist darauf hin, dass abgetriebene Embryonen in manchen Kulturen nicht als echte Menschen betrachtet werden und ihnen nicht der gleiche moralische Status zugeschrieben wird wie Menschen. (Originalanmerkung: In manchen Kulturen werden selbst Neugeborene nicht unbedingt als vollwertige Menschen angesehen. Das liegt daran, dass die Säuglingssterblichkeitsrate vor dem 20. Jahrhundert sehr hoch war und diese hohe Sterblichkeitsrate möglicherweise eine gewisse psychologische Distanz zwischen Menschen und Neugeborenen geschaffen hat.) Derzeit beschaffen sich viele „Abtreibungsgegner“-Gruppen mithilfe biomedizinischer Technologien Bilder und verwenden diese Bilder, um ihren Standpunkt zu beweisen. Sie verwendeten einen Fötus im Mutterleib als Symbol für den Embryo und suggerierten damit, dass der Embryo vom Moment der Empfängnis an bereits eine Person sei. Laut dem Wissenschaftshistoriker Nick Hopwood ist das Konzept der „menschlichen Entwicklung“ eher eine aktive Konstruktion als eine offenbarte „Tatsache über das Leben“. Ihm zufolge begann dieser Konstruktionsprozess mit der Embryologie im späten 19. Jahrhundert. Biologen und Ärzte glaubten damals, dass die Bildung eines Embryos ein komplexer, aber unauffälliger biologischer Prozess sei. Sie sind außerdem der Ansicht, dass die ethischen Fragen, die sich durch die Embryogenese ergeben, durch ein besseres wissenschaftliches Verständnis geklärt oder sogar gelöst werden könnten. Wir wissen jetzt, dass dies nicht der Fall ist. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Es ist schwierig, den individuellen Entwicklungsprozess zu verstehen, der durch die In-vitro-Fertilisation zum Ausdruck kommt. Welche Vorstellungskraft braucht es, um ein weinendes Baby mit einer winzigen Zellmasse in Verbindung zu bringen? Schließlich sind diese Zellen bestenfalls wie ein Haufen Seifenblasen. Wir haben versucht, ein Wort zu verwenden, um ein im Chemielabor übliches Gerät – auch die Bühne für die In-vitro-Fertilisation – mit dem heiligen Kristall zu verbinden, den die Mutter gezeugt hat. Der Begriff lautet „Retortenbaby“. Reagenzgläser wurden bei der In-vitro-Fertilisation nie verwendet und ihre Rolle ist rein symbolisch. Der Begriff „Retortenbaby“ tauchte erstmals im frühen 20. Jahrhundert auf, als das Verständnis der Öffentlichkeit für Biologie noch rudimentär war. Für sie klingt die Schaffung von Leben mit chemischen Methoden durchaus machbar, ja sogar unmittelbar bevorstehend. Damals war das, was wir heute als In-vitro-Fertilisation bezeichnen – die Vereinigung eines Spermiums und einer Eizelle außerhalb des Körpers und möglicherweise die Möglichkeit, dass die befruchtete Eizelle außerhalb des Körpers weiterwächst – eine Leistung, die der Schöpfung des Lebens durch Gott nicht weit entfernt schien. In Glasbehältern untergebrachte Kinder sind seit langem Teil der menschlichen Vorstellung von Leben und Tod. Seit Jahrhunderten werden die Körper von Totgeburten, Fehlgeburten und missgebildeten Babys in Krügen und Töpfen konserviert. Wie Susan Merrill Squire berichtet, geht die Idee, dass ein Lebewesen nach seinem Tod nicht nur in einer Flasche aufbewahrt, sondern tatsächlich in einer künstlichen Umgebung aus Glas erschaffen wird, mindestens auf das Mittelalter und die Renaissance zurück. Alchemisten und Mystiker der damaligen Zeit behaupteten, sie könnten im Labor kleine Männchen erschaffen und stellten sogar Rezepte für deren Herstellung zur Verfügung. Goethe beschreibt im Faust die Entstehung solcher Kreaturen und erklärt, nach welchen moralischen Grundsätzen diese Bösewichter beurteilt werden sollten. Die In-vitro-Zellkultur hat diese Geschichte geändert und uns Retortenbabys beschert. In seinem 1924 erschienenen Buch „Daedalus, or Science and the Future“ beschrieb JBS Haldane die Möglichkeit der Ektogenese oder Schwangerschaft außerhalb des Körpers. Dies inspirierte seinen Freund Aldous Huxley fast ein Jahrzehnt später dazu, einen berühmten satirischen Roman mit dem Titel „Schöne neue Welt“ zu schreiben. In der zukünftigen Gesellschaft von „Schöne neue Welt“ werden im Reagenzglas entwickelte Babys chemisch manipuliert, um ein System sozialer Klassen zu bilden, die nach Intelligenz unterteilt sind. Haldane glaubt, dass diese (hypothetische) Technologie der Menschheit Vorteile bringen könnte. Eine solche Technologie könnte sowohl die Emanzipation der Frau unterstützen – die Haldane grundsätzlich begrüßte – als auch die Sozialtechnik der Eugenik zur Erhaltung der Vitalität der menschlichen Spezies. Haldane und Julian Huxley befürchteten, dass gebildetere und intelligentere Frauen mit der Ausweitung der Chancen für Frauen weniger bereit wären, Kinder zu bekommen, weil sie entdecken würden, dass das Leben mehr ist als nur Hausarbeit. Doch mangels Chancen würden sich die „unteren Klassen“ weiter fortpflanzen und (so Haldanes Befürchtung) der menschliche Genpool würde mit jeder neuen Generation schrumpfen. Der Erzähler von „Daedalus oder Wissenschaft und Zukunft“ erklärt aus der Perspektive des 21. Jahrhunderts: Ohne die ektopische Entwicklung würde die menschliche Zivilisation in absehbarer Zukunft zweifellos zusammenbrechen, da die Fruchtbarkeit der weniger qualifizierten Mitglieder der Bevölkerung höher wäre. (Ursprünglicher Hinweis: Leider bezeichnete Haldane mit „Fruchtbarkeit“ lieber die tatsächliche Zahl der Nachkommen als das Potenzial, Nachkommen zu zeugen. Diese mehrdeutige Verwendung ist noch immer weit verbreitet und nicht weniger irreführend.) Die Möglichkeit, Menschen in einer kontrollierten Laborumgebung durch In-vitro-Fertilisation künstlich zu erschaffen, weckte in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen Bedenken hinsichtlich der Bevölkerungskontrolle und des Niedergangs der Zivilisation. Haldane hätte nie erwartet, dass jeder seine Vision der Zukunft akzeptieren würde. „Vom Holzbohren über das Feuermachen bis hin zum Fliegen gibt es keine große Erfindung, die nicht als Beleidigung irgendeiner Gottheit angesehen wurde“, schrieb er. „Wenn aber jede Erfindung in der Physik und Chemie eine Gotteslästerung ist, dann kann man sogar jede Erfindung in der Biologie als pervers und verdorben betrachten.“ Haldane war sich durchaus bewusst, dass manche Menschen die In-vitro-Fertilisation und ähnliche Techniken zur Manipulation der Empfängnis im Labor als „unanständig und unnatürlich“ ansehen würden, und das zu Recht. Im Jahr 1938 veröffentlichte Nora Burke einen überreaktionären Artikel im Tidbits-Magazin, der von Schengweiss' Gewebekulturforschung inspiriert war (siehe Seite 215). Darin sprach sie von „Chemiebabys“ und fragte: „Was genau sind das für Lebewesen?“ Der Titel des Artikels – „Würden Sie ein Chemiebaby lieben?“ – rief bei den Lesern die gewünschte Ablehnungsreaktion hervor. Doch es scheint, dass der Erfinder des Begriffs „Retortenbaby“ kein anderer als Thomas Schengweiss selbst war. In seinem Vortrag über Gewebekultur aus dem Jahr 1926 sagte Schengweis: „Man kann erkennen, dass die Idee von ‚Retortenbabys‘ keine Fantasie ist.“ „Retortenbabys“ war ein treffenderer Begriff als Haldanes „In-vitro-Entwicklung“, der eher wie ein wissenschaftlicher Begriff klang. Jeder kann die Bedeutung des Wortes „IVF“ verstehen und dabei gemischte Gefühle empfinden: Überraschung, Aufregung und möglicherweise Angst. Es ist ein Symbol der Moderne selbst: der Menschheit in einem Zeitalter der wissenschaftlichen Kontrolle über das Leben. Ein gängiges Bild von „Retortenbabys“: Wenn der Embryo in die Gebärmutter eingepflanzt wird, befindet er sich noch im Stadium vor der Blastozyste, aber zur Darstellung dieser Embryonen wird oft das Bild eines Babys verwendet. Bildquelle: Shutterstock Kurz gesagt: „IVF“ ist vorerst der richtige Begriff. Dass ein Mensch das Produkt einer wunderbaren Technologie sein kann, ist eine fast unvermeidliche Folge der industrialisierten Massenproduktion. Schließlich scheint die industrielle Massenproduktion alles in unserem Leben am Fließband herzustellen, in einem standardisierten, erprobten und kommerzialisierten Prozess. Der Abstand zwischen Haldanes Ektomorphismus und dem Brutzentrum in Aldous Huxleys Schöne neue Welt ist nicht allzu groß. Aber vielleicht ähnelt das Konzept „Roboter“ eher Schengweis‘ „Retortenbaby“. Das Konzept wurde erstmals 1921 vom tschechischen Schriftsteller Karel Capek in seinem Theaterstück R.U.R. vorgeschlagen. RUR ist die Abkürzung eines Unternehmens namens Rossum’s Universal Robots. Während Capeks Begriff für Roboter (das Wort bedeutet auf Tschechisch „Arbeiter“) Bilder von humanoiden Maschinen aus Metall und Draht hervorruft – wie der Terminator, dem seine künstliche Haut abgerissen wurde – sind Rossum-Roboter alles andere als das: Sie bestehen aus weichem Fleisch. In dem Stück erklärt Harry Domin, der Generaldirektor von RUR, dass die Roboter von Russell erfunden wurden, der seine Erfindungen auf Entdeckungen basierte, die er während seiner Experimente machte. Er führte chemische Experimente in Reagenzgläsern durch und versuchte, eine lebende Substanz zu erzeugen. Russell war ein Meeresbiologe, der in einem Reagenzglas eine neue Form von „Protoplasma“ schuf. Aus chemischer Sicht ist dieses Protoplasma viel einfacher als das Protoplasma innerhalb der Zelle. „Als nächstes muss er diese Leben aus den Reagenzgläsern holen“, sagte Dominic. Mithilfe dieses künstlichen Lebens hat RUR eine teigartige Substanz geschaffen, aus der Organe geformt werden können. „Dort drüben sind die Bottiche, in denen Lebern, Gehirne und so weiter hergestellt werden“, sagte Domin, „und dort drüben ist der Montageraum, in dem alles zusammengesetzt wird.“9 Der Produktionsprozess basiert auf Henry Fords automatisiertem Fertigungsmodell, aber die Fertigungstechnologie basiert eindeutig auf Gewebe- und Organkulturtechniken, deren Pionierarbeit von Leuten wie Carrel und Schengweiss geleistet wurde. Dieselbe Angst, die sich in Capeks Werk widerspiegelt – die Angst vor der Produktion homogener Menschen im industriellen Maßstab – veranlasste auch David H. Keller, eine Geschichte mit dem Titel „Ein biologisches Experiment“ zu schreiben, die 1928 in einer Ausgabe des Magazins „Amazing Stories“ erschien. Die Geschichte prophezeit eine dystopische Zukunft, in der Sex verboten ist und Babys in Fabrikbottichen nach standardisierten Vorgaben gezeugt, mit Strahlung behandelt und an Paare verteilt werden, die die erforderlichen behördlichen Genehmigungen einholen. Eine ähnliche Handlung taucht in Aldous Huxleys späterem Roman Schöne neue Welt auf. Natürlich erregen dystopische Geschichten immer mehr Aufmerksamkeit als utopische Geschichten. Wie immer ist es erwähnenswert, dass diese „Chemiebaby“-Geschichten oft damit enden, dass die künstlichen Menschen die Menschheit besiegen. R.U.R. etablierte eine Vorlage für Geschichten, in denen abscheuliche Roboter zurückschlagen und die Menschheit besiegen. Diese Vorlage wird auch heute noch verwendet, beispielsweise in der Fernsehserie „Westworld“ und dem Skynet-System im Film „Terminator“. In der Science-Fiction werden selten gehorsame Roboter dargestellt und die Prämisse ist offensichtlich: Künstlich geschaffenen Menschen fehlt es von Natur aus an Moral und sie sind daher kalt und rücksichtslos. In den Schriften von Nora Burke werden „chemische Babys“ ohne Grund als „geschlechts- und seelenlose chemische Kreaturen“ beschrieben, die möglicherweise irgendwann „die echten Menschen besiegen“ und zur „Ausrottung der Menschheit“ führen könnten. Doch ist es im Großbritannien des Jahres 1938 vielleicht nicht schwer zu verstehen, woher diese Angst kam. Die Frage „Wie erschafft man einen Menschen?“ war nie eine einfache wissenschaftliche Frage, sondern eine tiefgreifende und unausweichliche soziale und politische Frage. Der Begriff „Retortenbaby“ ist nicht auf das Magazin „Amazing Stories“ beschränkt. es passt auch gut in das „anspruchsvolle“ Nature-Magazin. Der Ursprung des Begriffs lässt darauf schließen, dass es ein Irrtum ist, zu glauben (wie viele Wissenschaftler es tun), man könne Wissenschaft einfach mit gesenktem Kopf und geschlossenen Augen betreiben, während die Medien und die Popkultur zusammenarbeiten, um die Wissenschaft mit sensationellen Slogans und Bildern zu diskreditieren. Tatsache ist, dass sich die beiden Seiten der „Professionalisierung“ und der „Popularisierung“ in der wissenschaftlichen Innovation gemeinsam entwickeln. Honna Fells Enthusiasmus für die Förderung und Verbreitung der Forschung im Schengweiss-Labor – größtenteils aufgrund der Hoffnung, Unterstützung und Gelder für die Arbeit zu gewinnen – verflog schließlich, als sie die sensationellen Schlagzeilen und Science-Fiction-Geschichten über die Arbeit sah. Als 1935 Gerüchte die Runde machten, das Schengweiss-Labor plane, Babys im Reagenzglas zu zeugen, reagierte Fair sofort alarmiert und bestand darauf, dass Wissenschaftler die Gewebekultur nur als „eine wertvolle Technik mit ihren eigenen einzigartigen Vorteilen und ihren eigenen Grenzen“ beschreiben sollten. Das hielt den Daily Express jedoch nicht davon ab, im darauffolgenden Jahr zu schreiben, dass in Schengweiss‘ Labor „lebendes Gewebe außerhalb des Körpers genauso wächst und sich entwickelt wie bei intakten, lebenden Tieren“. Der Artikel zitierte einen zweifelhaften anonymen Wissenschaftler („aus einem anderen Labor der Universität Cambridge“), der behauptete, dass die Forschung „den ersten Schritt in Richtung der Gesellschaft aus Aldous Huxleys Schöner neuer Welt darstellt, indem Babys in Reagenzgläsern gezüchtet werden.“ Wie der Historiker Duncan Wilson betont, war Fair selbst zwar gern bereit, die Arbeit des Schengweiss-Labors bekannt zu machen, doch die Behauptung, sie würde seelenlose Chemiebabys erschaffen, war „offensichtlich nicht die Publicity, die sie suchte“. Man könnte meinen, die Verzerrung und Übertreibung der Tatsachen stamme von Fair. Doch ihr Rat an die Wissenschaftler – dass sie über ihre Forschung sprechen und versuchen sollten, bei ihrem Publikum Anklang zu finden – ist nicht falsch. Der Punkt ist, dass sich Wissenschaftler darüber im Klaren sein müssen, dass sie die Wirkung ihrer Beschreibungen und Metaphern nicht mehr kontrollieren können, wenn sie diese erst einmal ausgesprochen haben. Sie sollten also mit dem, was sie sagen, vorsichtig sein. Dieser Konflikt wird heute besonders deutlich in Diskussionen über Genetik und Genomik. Wissenschaftler sind empört über das vereinfachende Verständnis der Öffentlichkeit zu Themen wie dem genetischen Determinismus, doch die Öffentlichkeit kann leicht erwidern: „Das haben Sie ja von Anfang an gesagt.“ Über den Autor Philip Ball ist Wissenschaftsjournalist, Mitglied der Royal Society of Chemistry, Mitglied der Expertengruppe der Europäischen Kommission für synthetische Biologie und beratender Redakteur des Magazins Nature, wo er 20 Jahre lang als Redakteur tätig war. |
Artikel empfehlen
Die Galaha, die wir in unserer Gegend spielten, tauchten tatsächlich in antiken römischen Gemälden auf?
In meiner Heimatstadt im Nordosten Chinas gibt es...
Essen Sie jeden Tag ein bisschen davon, um Ihr Gehirn zu nähren und Ihre Augen und Haut zu schützen! In nur 2 Schritten geht es!
Bereits in den 1940er Jahren stellte man fest, da...
Kann man durch Sitzen abnehmen?
Mehr Wasser zu trinken kann Ihnen helfen, Giftsto...
Welche Funktion hat ein Spinning-Bike?
Spinning-Bikes sind Fitnessgeräte, die man häufig...
Wie schmeckt Schrödingers Kirschblütenaroma?
Science Times Reporter-Epos In letzter Zeit haben...
Das mysteriöse Raumflugzeug im Spiel der Großmächte – eine mächtige Waffe für die zukünftige Kontrolle des Weltraums?
In den letzten Tagen waren die Nachrichten über C...
Staudammwissen | Xiaolangdi: Turbulente Wellen treten in einem ruhigen See auf, und es gibt Tausende von Kilometern lang keinen überfluteten Strand
Wenn wir über die Wasser- und Sedimentregulierung...
Tesla erwarb erfolgreich ein Grundstück zur industriellen Nutzung in Lingang, Shanghai, für 973 Millionen RMB
Am 17. Oktober gab die offizielle Website des Sha...
Was? Ich pflücke seit so vielen Jahren Tannenzapfen und Sie behaupten, das sei keine Frucht?
Im Naturhistorischen Museum von Shanghai gibt es ...
Testbericht zum ATET A8 Bluetooth-Controller mit individuellem Erscheinungsbild
Als einer der Steuerungsstandards für viele Spiel...
Verabschieden Sie sich vom Stromverbrauch im Hintergrund und dem Datendiebstahl durch herkömmliche Anti-Selbststart-Software.
Die Größe der Mobiltelefone hat nicht zugenommen u...
Broadridge: Bericht: Beschleunigen Sie die digitale Transformation mit Technologien der nächsten Generation
Warum ist die digitale Transformation so wichtig?...
Tornado-Datenarchiv: Ich stifte im Frühling und Sommer gerne Ärger und fahre gern nach Jiangsu und Guangdong!
In jüngster Zeit kam es in vielen Orten im Süden ...
Ein Rettungsanker für die im IP-Strudel gefangene Videobranche?
10. April (Reporter Zhang Zhichang) Unter dem Ein...