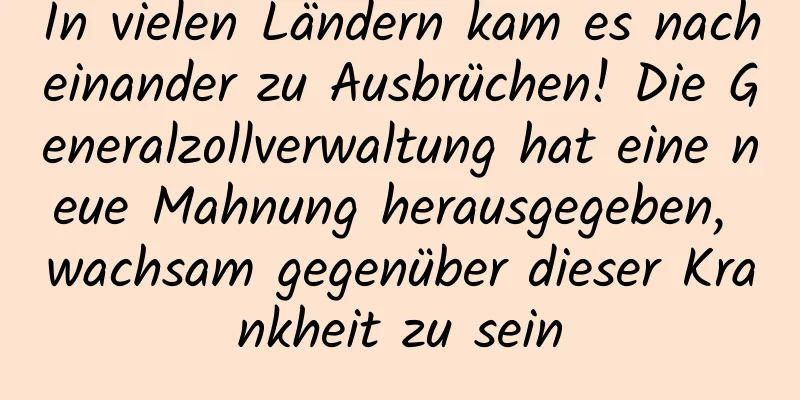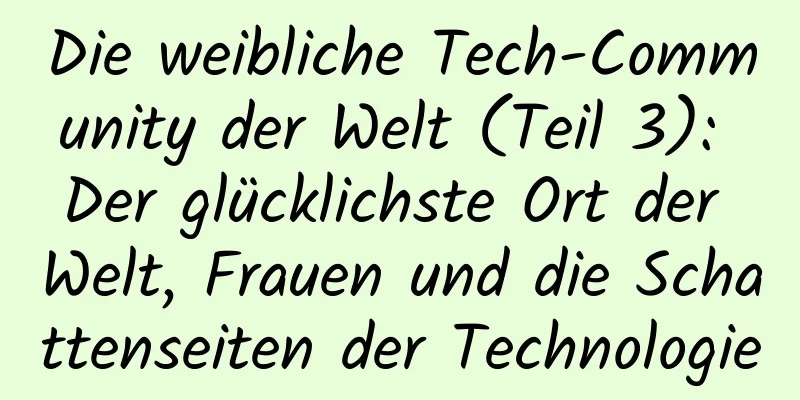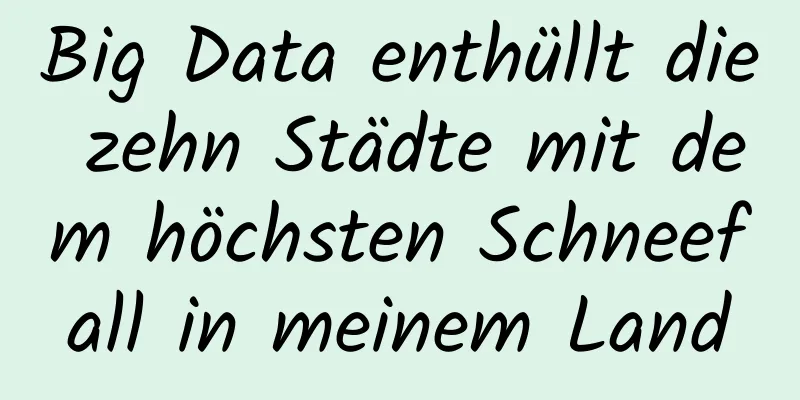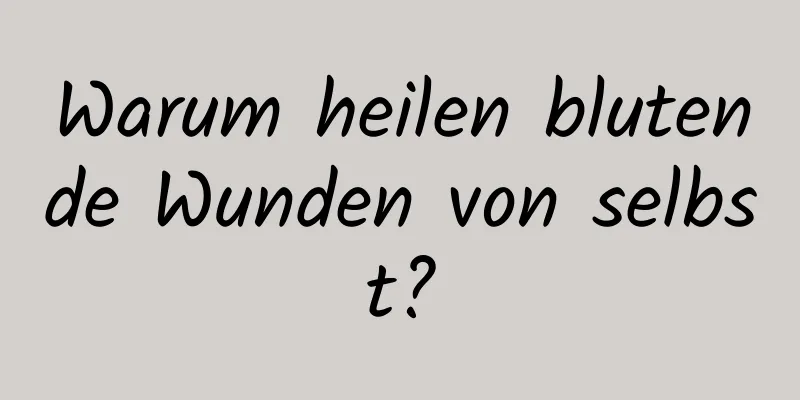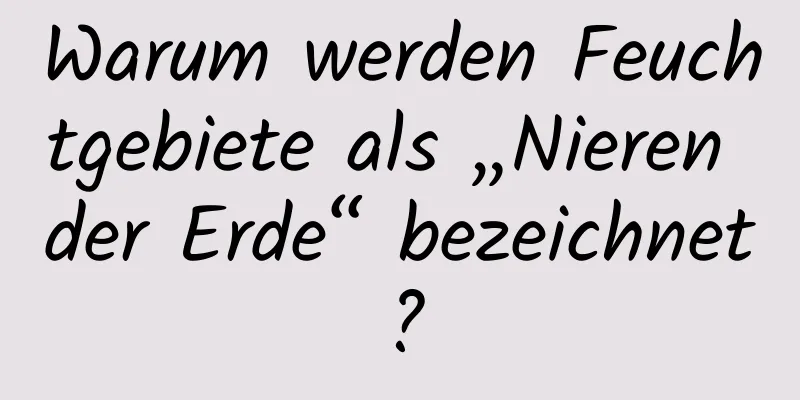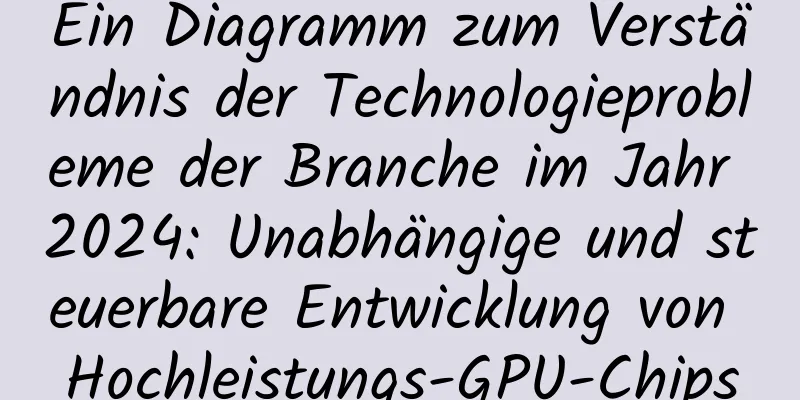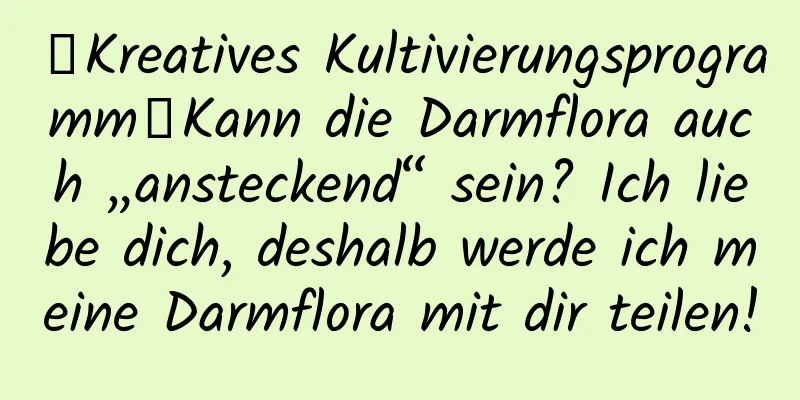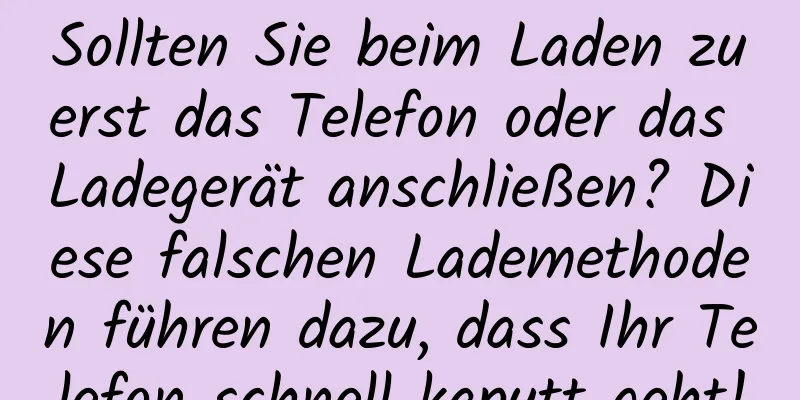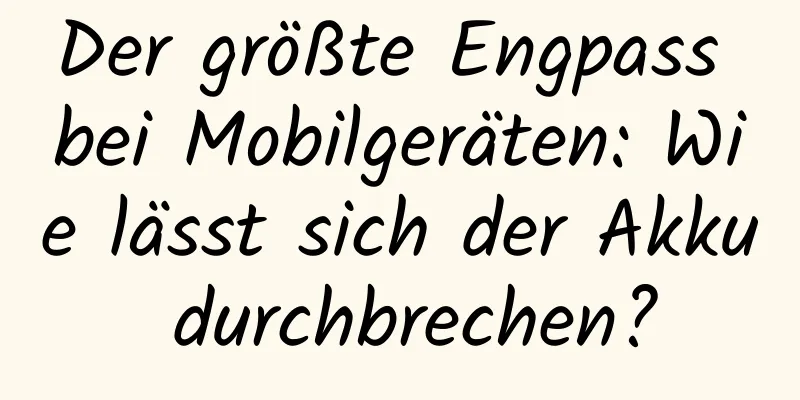Wenn wir nicht dieselbe Sprache sprechen, wird dann auch unser Denken unterschiedlich sein?
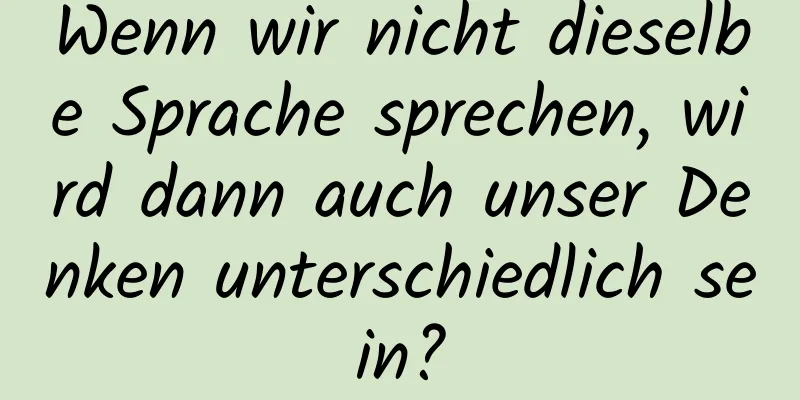
|
Wenn wir nicht dieselbe Sprache sprechen, wird dann auch unser Denken unterschiedlich sein? Autor: Mao Ning Wissenschaft Popularisierung Im Internet kursieren viele Witze, und die lustigen Stellen drehen sich alle um die Unterschiede zwischen den verschiedenen Nationalitäten. Beispielsweise sind Chinesen im Kopfrechnen viel besser als Amerikaner. Probieren Sie einfach das amerikanische Einmaleins aus und Sie werden feststellen, dass es im Vergleich zu unserem „Eins plus Eins ist Eins“ zu lang und schwer auszusprechen ist. Sobald die Franzosen auf der Bildfläche erschienen, verloren wir. Es stellte sich heraus, dass ihre seltsame Art, Zahlen auszudrücken, zu ihrer mächtigen Waffe im Kopfrechnen wurde. Diese Aussagen sind zwar nicht durch Experimente bestätigt, decken sich jedoch mit den Erfahrungen vieler Menschen. Vielleicht beeinflusst unsere Sprache tatsächlich unsere Kopfrechenfähigkeit? Wie nehmen wir die Dinge um uns herum täglich wahr? Weich, nass, groß, lang... Wir nehmen die Welt wahr und teilen sie in verschiedene Attribute ein. Links, rechts, Osten, Süden, Westen und Norden – wir verwenden verschiedene Richtungen, um den Standort von Dingen anzugeben. Heute und morgen, vorher und nachher, die Position spiegelt sich auch im Fluss der Zeit wider. Nun stellt sich die Frage: Wenn eine Sprache bei der Beschreibung von Objekten den Wortstamm je nach Weichheit oder Härte ändert; wenn eine Sprache Richtungen als Seeseite oder Landseite ausdrückt; Wenn eine Sprache die Reihenfolge der Zeit von links nach rechts ausdrückt, sehen Menschen, die diese Sprachen sprechen, die Welt dann anders als wir? Diese Fragen gewannen Ende des 19. Jahrhunderts an Bedeutung. Europäische Gelehrte trennten die Nationen und Sprachen der Kontinente und begannen, ernsthaft über solche Fragen nachzudenken. Der große Gelehrte Wilhelm von Humboldt untersuchte verschiedene Sprachen und begann zu erklären, dass Deutsch, Englisch und andere indoeuropäische Sprachen vollkommener seien. Später stellten viele Wissenschaftler bei der Untersuchung indigener Völker fest, dass es in den indigenen Sprachen im Vergleich zu ihrer Muttersprache zu viele Dinge gab, die keine Regelmäßigkeit aufzuweisen schienen. Manche Menschen glauben einfach, dass dies Ausdruck der Minderwertigkeit der indigenen Sprachen sei. Glücklicherweise ist ein anderer Wissenschaftler anderer Meinung. Franz Boas, ein deutsch-amerikanischer Anthropologe, der die Sprache der Inuit erforschte, wies darauf hin, dass es sich bei scheinbar unterschiedlichen Aussprachen nicht um Dialekte oder unregelmäßige Veränderungen handele. Die Wahrnehmung dieser Veränderungen bei der Kommunikation durch die Einheimischen unterscheidet sich von der Wahrnehmung der Wissenschaftler, die vor Ort Nachforschungen anstellen. Dieser Unterschied in der Wahrnehmung ist eher ein kultureller Unterschied als ein Unterschied in der Aussprache. Dieses sprachliche Merkmal kann für einen Inuit etwas völlig anderes bedeuten als für einen Gelehrten einer anderen Kultur. Boas’ Schüler Edward Sapir war stark von seinen Ideen beeinflusst. Er war fasziniert vom Studium der indianischen Sprachen und lieferte zusammen mit seinem Studenten Benjamin Lee Whorf zahlreiche Beispiele zur Veranschaulichung der Theorie der sprachlichen Relativität. Whorf argumentiert beispielsweise, dass die Hopi-Sprache, eine indianische Sprache, im Gegensatz zum Englischen nicht die Fähigkeit besitzt, kontinuierliche Zeiteinheiten auszudrücken, sodass ihre Zeitwahrnehmung völlig anders ist als die der Englischsprachigen. Sie wiesen beispielsweise darauf hin, dass viele Versuchspersonen in gefährlichen Umgebungen rauchten, weil sie von der Sprache beeinflusst wurden, mit der die Umgebung beschrieben wurde. Am bekanntesten ist vielleicht die Aussage über die Inuit-Sprache: Für die Inuit gibt es viele Wörter, um „Schnee“ auszudrücken. Sie glauben, dass die Sprache das Denken bestimmt und dass Menschen, die unterschiedliche Sprachen sprechen, unterschiedliche Denkweisen haben. Diese Ansicht wird als „Sapir-Whorf-Hypothese“ zusammengefasst. Was als nächstes geschah, war ziemlich unerwartet. Ihre Hypothese wurde sowohl mythologisiert als auch kritisiert. Nehmen wir zum Beispiel die Mythologie. In der Inuit-Sprache gibt es so viele Wörter, um Schnee zu beschreiben. Von etwa einem Dutzend steigerte sich die Wortverbreitung auf Dutzende, Hunderte und schließlich auf tausend Wörter. Auch die Unterschiede zwischen verschiedenen Sprachen werden als Beleg dafür herangezogen, dass „die Deutschen streng, die Franzosen romantisch, die Chinesen gut in Mathematik und die Japaner ein ausgeprägtes Gefühl für Kollektivismus haben“, unabhängig davon, wie viel davon bloße Spekulation aufgrund von Sprachbarrieren und wie viel Zirkelschluss ist. Kurz gesagt: Sprachliche, nationale und geistige Unterschiede sind für viele Menschen miteinander verwoben und tragen manchmal sogar zu Stereotypen gegenüber anderen Kulturen bei. Es ist ironisch, dass das Vorurteil, gegen das Boas sich wandte, inzwischen zu einer verstärkten Form des Vorurteils geworden ist. Im Gegensatz zur mythischen Seite ist die Kritik an der Forschung von Sapir und Wolff in der akademischen Gemeinschaft zum Mainstream geworden. Viele der von ihnen angeführten Beispiele zu indigenen Sprachen erwiesen sich bei genauerer Betrachtung als unhaltbar. Von Chomsky bis hin zum berühmten Neurowissenschaftler Steven Pinker haben sie in den letzten Jahren Theorien wie die der Universalgrammatik vertreten und sind der Ansicht, dass die Strenge dieser Studien damals wirklich besorgniserregend war. Linguisten haben auch zwei Versionen der Hypothese vorgeschlagen, eine starke und eine schwache; Die abgeschwächte Version schwächt das Konzept ab, dass die Sprache das Denken bestimmt, und zwar dahingehend, dass die Sprache das Denken beeinflusst. Dennoch wurde ein Großteil der Forschung kritisiert. Trotz der Führung durch „große Namen“ gibt es in der debattenfreudigen Wissenschaftsgemeinde immer wieder Menschen, die gegen den Strom schwimmen und weiter forschen. Bekannt scheint zum Beispiel die Methode von Lera Boroditsky zu sein, einem aufstrebenden akademischen Stern der letzten Jahre und Psychologieprofessorin an der Stanford University: Durch die Untersuchung der kognitiven Unterschiede zwischen Menschen unterschiedlicher Sprachen und Nationalitäten versucht sie, den Einfluss der Sprache auf das Denken herauszufinden. Sie und ihre Kollegen untersuchten beispielsweise das Volk der Pormpuraawa, ein Aborigine-Volk in Australien. In der Sprache dieser Menschen gibt es kein Konzept von links und rechts. Sie können sich ohnehin nur mit räumlichen Lagebeziehungen nach Ost, Süd, West und Nord befassen. Sie können nicht sagen: „Die Person, die links von mir steht“, sondern Sie sollten sagen: „Die Person, die südlich von mir steht“. Das Erlernen dieser Sprache von klein auf ist wirklich eine besondere Art des Trainings. Ein kleines Mädchen aus der Gegend kann mit geschlossenen Augen die Himmelsrichtungen Osten, Westen und Norden erkennen. Auch ihr Zeitempfinden unterscheidet sich von dem der Menschen an anderen Orten. Nehmen Sie einen Satz Story-Fotos heraus und bitten Sie die Leute, diese von vorne nach hinten anzuordnen. Englischsprachige sind es gewohnt, von links nach rechts zu gehen, während Hebräischsprachige von rechts nach links gehen. Für die Pormpuraawa gibt es ein Problem: Egal, ob sie nach Süden mit Blick auf den Norden oder nach Norden mit Blick auf den Süden sitzen, sie richten sie in umgekehrter Richtung aus, weil sie sich nur auf die absolute Richtung verlassen können. Boroditsky schlussfolgerte, dass die meisten Zeitadverbien im Chinesischen mit oben und unten in Verbindung stehen und dass es für Chinesen vielleicht am bequemsten ist, von oben nach unten zu sortieren. Wir alle wissen, dass es bei vielen ethnischen Gruppen unterschiedliche Methoden zur Farbtrennung gibt. Einige ethnische Gruppen unterscheiden nicht zwischen Blau und Grün, während andere das Spektrum von Rot bis Gelb unterteilen. Wie beeinflusst diese Spaltung das Denken der Menschen? Im Russischen sind Dunkelblau und Hellblau zwei verschiedene Wörter. Boroditsky stellte fest, dass russische Muttersprachler das blaue Spektrum deutlich schneller und genauer unterscheiden konnten als englische Muttersprachler. Verschiedene Sprachen haben unterschiedliche Begriffe für Aktiv und Passiv. Eine zerbrochene Tasse ist ein Ereignis. Wenn es absichtlich gebrochen wird, können sich Englisch- und Japanischsprachige gleichermaßen daran erinnern, wer es gebrochen hat. Wenn es jedoch versehentlich kaputt geht, können sich japanische Muttersprachler oft nicht erinnern, wer es kaputt gemacht hat. Denn bei zufälligen Ereignissen ist die Angabe des Verursachers auf Japanisch nicht erforderlich. Im Chinesischen weisen Wörter wie elf, zwölf und dreizehn eindeutig auf das Dezimalsystem hin, die englischen Wörter elf und zwölf sind jedoch nicht eindeutig. Infolgedessen beherrschen chinesische Kinder das Dezimalsystem früher als englische Muttersprachler. Kurz gesagt: Anders als Sapirs damalige Erfahrungen und Beschreibungen verwenden die heutigen Wissenschaftler experimentelle Methoden, um echte Beweise dafür zu finden, dass Sprache das Denken beeinflusst. Während die Kulturpsychologie den Weg der interkulturellen Forschung einschlägt, hat die kognitive Linguistik schon lange begonnen, gegen Chomskys Theorie zu reagieren. Was sie am meisten beschäftigt, ist nicht die Sapir-Whorf-Hypothese, sondern grundlegendere Fragen der Sprachwissenschaft. Wissenschaftler wie George Lakoff reagierten darauf, indem sie die Kognition als Schlüssel zur Sprachforschung betrachteten. Lassen wir die komplizierten sprachlichen Fragen einmal beiseite und sehen wir uns an, was Lakov selbst vorgeschlagen hat. Dieser Gelehrte nahm aktiv am öffentlichen Leben teil und verfasste Werke wie „Political Mind“ und „Don’t Think About the Elephant“, womit er seine Forschungen zur kognitiven Linguistik in den politischen Bereich einbrachte. Er wies darauf hin, dass Politiker, die sprachgewandt seien, einen Sprachrahmen nach dem anderen schaffen würden, der das Denken ihrer Gesprächspartner beeinflusse. Erinnern Sie sich daran, wie Bush Jr. den Krieg gegen den Irak in seiner Rede zur Lage der Nation beschrieb: Die Abstimmung über die Vereinten Nationen kam einer „Genehmigung durch Handzeichen“ gleich. Diese Formulierung erinnerte die Leute an einen Grundschüler, der seinem Lehrer Bericht erstattet, und stieß das Publikum mit Abscheu vor diesem Verhalten auf. Und was die Steuersenkungen betrifft, so lässt die Sprache seiner Regierung darauf schließen, dass er versucht, die Verluste aufgrund einer fehlgeleiteten Politik zu stoppen. Wenn die Demokraten diese Worte in einer Debatte verwenden, begeben sie sich tatsächlich in den von der anderen Partei vorgegebenen Sprachrahmen. Sie lassen sich nicht nur an der Nase herumführen, sondern tragen auch dazu bei, den Wählern die Werte ihrer politischen Gegner nahezubringen. Dieses Spieleset ist sehr clever und es steckt eine ganze Reihe von Werten dahinter. Rakoff wies darauf hin, dass die Einstellungen zu Abtreibung, Waffenkontrolle, Außenpolitik und Steuerpolitik scheinbar nichts miteinander zu tun hätten, dass sich die Linke und die Rechte in den Vereinigten Staaten jedoch mit jedem dieser Themen auseinandersetzen könnten. Dies liegt daran, dass hinter dieser Politik zwei Wertesysteme stecken: das eine ist streng väterlich, das andere fürsorglich. Strenge Moral, die Betonung männlicher Qualitäten, herrschsüchtige und streng väterliche Werte, die Selbstverwaltung befürworten, sind tief im Diskurs der amerikanischen Konservativen verborgen und verknüpfen eine Reihe irrationaler Wahrnehmungen der Wähler. Sie bilden auch die Grundlage vieler Rede- und Sprachstrukturen der republikanischen Rechten. Bei dieser Art von Werten ist der Versuch, ihnen zu gefallen oder rational zu sein, oft nicht die beste Option. Um Anerkennung zu erlangen, müssen Sie über einen eigenen Sprachrahmen verfügen und fest zu Ihren eigenen Werten stehen. Dies ist auch ein Aspekt der Wechselwirkung zwischen Sprache und Denken. Die Forschung von Boroditsky et al. wird weiterhin von Linguisten kritisiert, die der Meinung sind, dass ihr experimentelles Design nicht streng genug sei. Ich frage mich, welche Inspiration Lakoffs Theorie amerikanischen Politikern bieten kann. Eines ist sicher: Es gibt viele Menschen um uns herum, die andere Ansichten haben. Bevor wir betonen, dass wir nicht einer Meinung sind, sollten wir vielleicht zunächst einmal zuhören, wie sie die Welt wahrnehmen. Dieser Artikel wurde vom Science Popularization China-Starry Sky Project (Erstellung und Kultivierung) erstellt. Bei Nachdruck bitten wir um Quellenangabe. |
<<: Die Entdeckung der Batterie war ein Unfall
>>: Warum erscheinen beim Betrachten bakterienähnliche schwebende Objekte vor Ihren Augen?
Artikel empfehlen
Wie viel Gewicht haben Sie bei diesem Frühlingsfest zugenommen?
Gewichtszunahme in nur sieben Tagen Von Silvester...
Ist Dehnen die beste Übung?
Wenn wir eine Haltung über einen längeren Zeitrau...
Ein Mann wurde festgenommen, weil er den „heiligen Vogel des Plateaus“ getötet hatte. Welche Bedeutung hat der Schutz der Schwarzhalskraniche?
Im Dezember 2023 gab es eine traurige und ärgerli...
Raten Sie mal, wessen Baby das ist?
Bildquelle: Pinterest Dumm Schauen Sie sich die B...
Kann ich Sport treiben, wenn ich Allergien im Gesicht habe?
Sie können Sport treiben, um Allergien im Gesicht...
Diese im Internet beliebte Promipflanze ist wirklich schwer zu züchten!
In den letzten Jahren ist der „kalte“ Stil grüner...
iQOO Z7 im Test: Macht richtig Spaß, ist langlebig und leistungsstark
In den letzten Jahren ist es sehr schwierig gewor...
Gibt es außer der Erde noch andere Planeten, auf denen Leben existiert? Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, dass...
Das Universum, dieses riesige und geheimnisvolle ...
Die Landschaft nach der Dividende: Eine detaillierte Analyse des chinesischen Mobilfunkmarktes im Jahr 2017
Dieser Artikel enthält die wichtigsten Inhalte de...
Was genau ist das mysteriöse Wesen „Wasseraffe“?
In unserem Land kursieren verschiedene Versionen ...
Welche Bedeutung haben die Bemühungen von Alibaba Pictures, Internet und Filme zu schaffen?
Seit Alibaba Ventures Ende letzten Jahres eine Be...
Wie trainiert man die unteren Bauchmuskeln?
Im Leben ist jeder mit der Arbeit beschäftigt und...
Kann Tischtennisspielen beim Abnehmen helfen?
Viele Freunde hoffen, dass ihr Körper schlanker w...
Der Internet-TV-Markt steht vor Veränderungen durch die Einführung neuer Produkte
Kürzlich gab Damai Technology bekannt, dass die e...
Audi e-tron kommt nach China und schreibt die Geschichte des luxuriösen Elektro-SUV neu
Der Mythos des Tesla Model X verblasste endgültig...