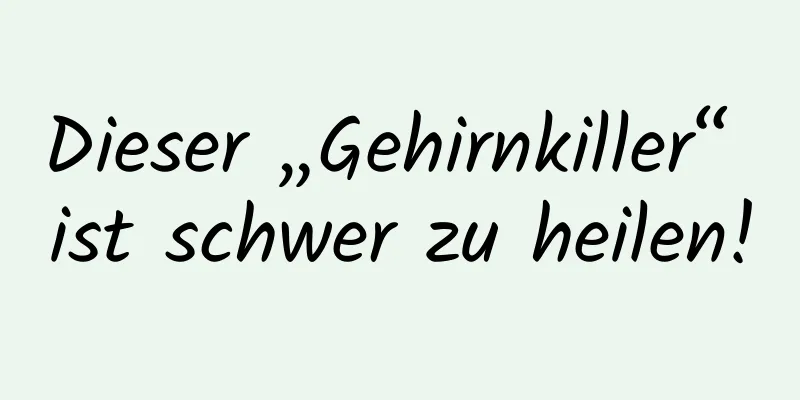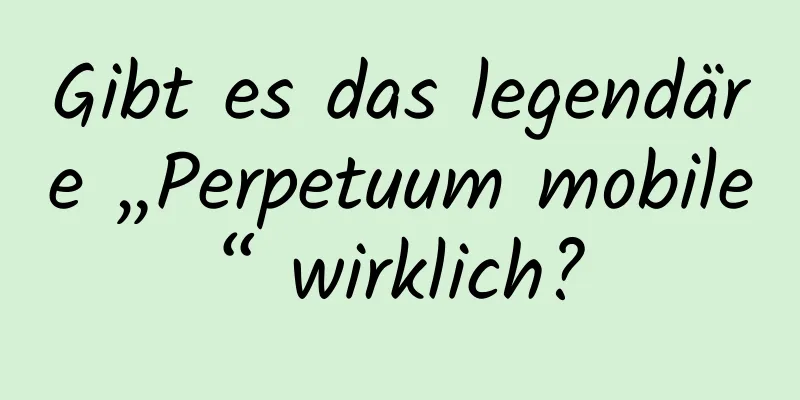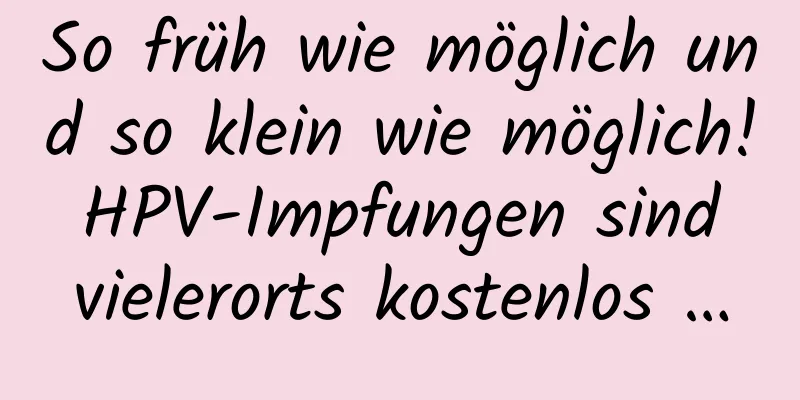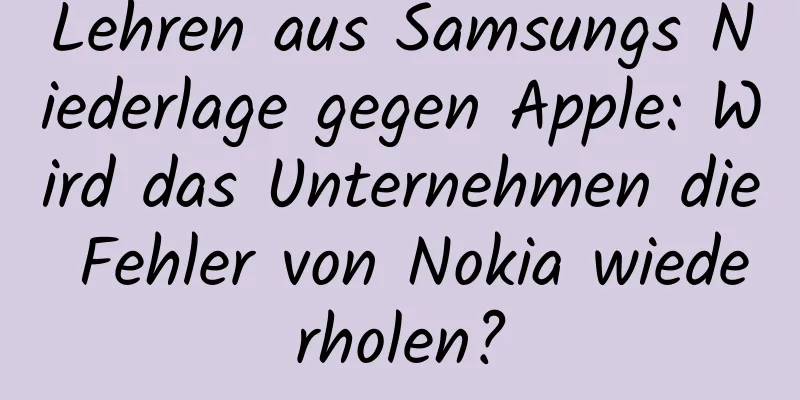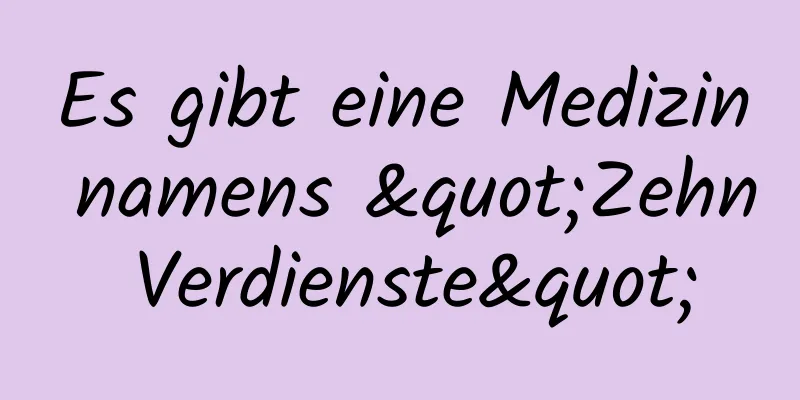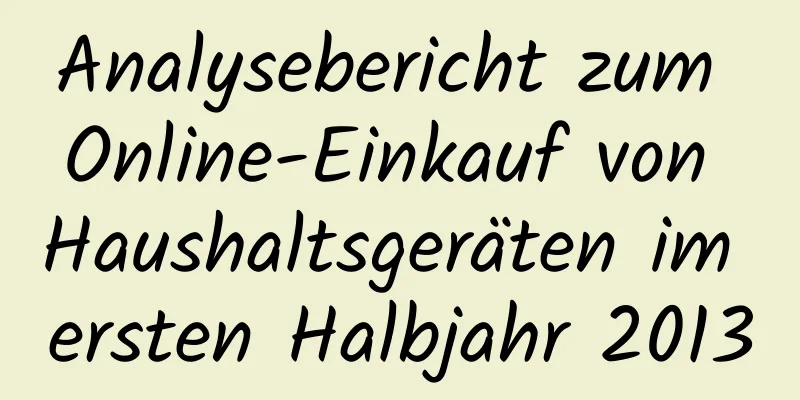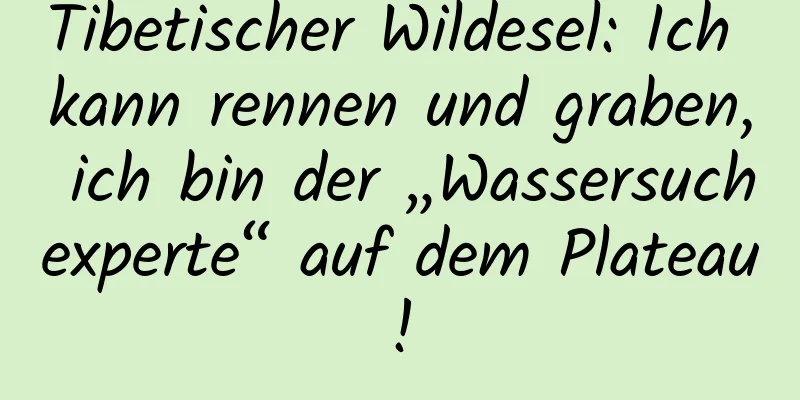Ist Wissenschaft planbar? Wenig bekannte "Nachtwissenschaft"
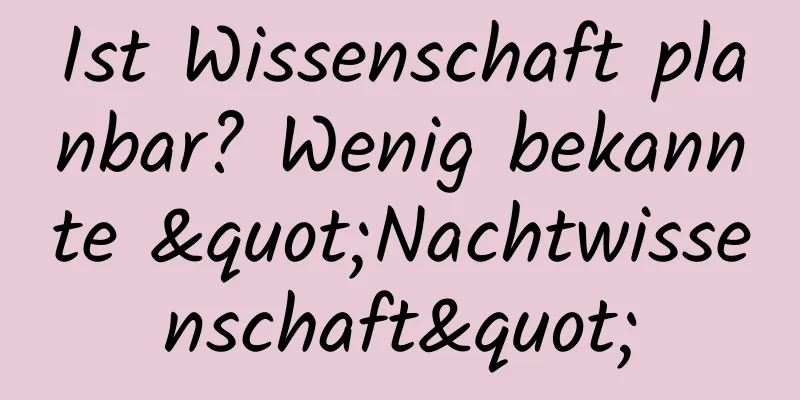
|
Dieser Artikel ist Teil einer Reihe von Kommentarartikeln, die in Genome Biology von Itai Yanai, Professor für Biochemie und Molekularpharmakologie an der NYU School of Medicine, und Martin J. Lercher, Professor für Bioinformatik an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, veröffentlicht wurden. Der Originaltitel lautet „Was ist die Frage?“ Der aktuelle Titel wurde vom Übersetzer hinzugefügt. Der Artikel greift das vom Nobelpreisträger François Jacob vorgeschlagene Konzept der „Nachtwissenschaft“ auf, um die Erfahrungen des Autors bei der Untersuchung von Hypothesen und Problemen im wissenschaftlichen Forschungsprozess zu beschreiben. Anders als die in der Öffentlichkeit gut organisierte und logisch strenge „Wissenschaft am Tag“ bezieht sich die „Wissenschaft in der Nacht“ auf den Erkundungsprozess vor der Formulierung einer Hypothese. Wenn die Idee noch nicht ausgereift ist, hat die Wissenschaft eine andere Seite, die unberechenbar, mehrdeutig und blind ist (siehe den vorherigen Artikel „Was machen Wissenschaftler nachts, wenn sie keine Arbeiten veröffentlichen?“). Geschrieben von | Itai Yanai, Martin Lercher Übersetzt von Zhou Shuyi Stephen Hawking schlug 1976 eine wichtige Idee vor, die als Informationsparadoxon bekannt wurde. Dies ist eine äußerst tiefgründige und wichtige Beobachtung. Hawking hat nicht die richtige Antwort bekommen, aber das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass er die richtige Frage gestellt hat. Dies löste eine Debatte aus, deren Lösung 25 Jahre dauerte. —Leonard Susskind (amerikanischer Physiker) Das größte Missverständnis in der Öffentlichkeit über die Wissenschaft besteht darin, dass sich Wissenschaftler der Lösung von Problemen widmen. Tatsächlich sind es vor allem die Wissenschaftler, die Probleme schaffen. Wir haben zuvor die von François Jacob vorgeschlagenen Konzepte der Tagwissenschaft und der Nachtwissenschaft vorgestellt: Auf ein festgelegtes Ziel hinarbeiten, Probleme in einem Labor oder vor einem Computer lösen, das ist Tagwissenschaft; Der Geist schweift frei umher, bringt neue Ideen hervor und entdeckt verborgene Zusammenhänge. Das ist Nachtwissenschaft. Es ist sicherlich einfacher, sich die Wissenschaft als einen logischen, schrittweisen Prozess vorzustellen. Doch gerade in diesem unvorhersehbaren, ziellosen Prozess der Nachtforschung tauchen neue Fragen auf, ebnen den Weg für neue Entdeckungen und verändern unsere Sicht auf die Realität grundlegend. Was ist Ihre Frage, Einstein? Stellen Sie sich vor, Sie wären Mäuschen im Büro von Professor Heinrich Friedrich Weber an der ETH Zürich im Jahr 1900. „Wie kann ich Ihnen helfen, Herr Einstein?“ sagte der Professor streng und sah seinen am wenigsten beliebten Studenten an. „Herr Professor“, begann der forsche Student, „was sind die großen ungelösten Probleme der theoretischen Physik? Ich möchte sie lösen.“ „Nun, junger Mann, wenn Sie regelmäßig meine Vorlesungen besuchen, müssen Sie wissen, dass es heute drei große ungelöste Probleme gibt. Mit Ihrem Talent ist es Wunschdenken, sie zu lösen. Aber ich sage es Ihnen noch einmal: Erstens, wie ändern wir das Zeitkonzept so, dass Maxwells Gleichungen mit der beobachteten Invarianz der Lichtgeschwindigkeit übereinstimmen? Zweitens, wie vermeiden wir den Widerspruch zwischen der Absorption und Emission von Licht in Form diskreter Einheiten und dem Konzept der Schwarzkörperstrahlung? Und schließlich, wie verstehen wir die Schwerkraft als Krümmung von Zeit und Raum?“ Mit diesen Fragen eilte der junge Einstein zurück zu seiner Werkbank. Dieser neugierige Wissenschaftler ging die Probleme Stück für Stück an, ging jeden logischen Schritt mutig und war nicht aufzuhalten. Jeder Schritt führte zu einer eleganten Schlussfolgerung. Im Alter von 40 Jahren löste er alle drei Probleme und wurde so zum wissenschaftlichen Totem, das wir heute kennen. So funktioniert der wissenschaftliche Fortschritt: Experten auf ihrem Gebiet identifizieren Lücken im wissenschaftlichen Gebäude und listen die wichtigsten zu lösenden Probleme auf. Dann zerbrechen sich Forscher auf der ganzen Welt den Kopf, um diese zu lösen, bis ein glücklicher Mensch die Antwort findet. Um diesen wissenschaftlichen Prozess zu beschleunigen, werden häufig Listen mit wissenschaftlichen Fragen öffentlich zugänglich gemacht. Das National Cancer Institute (NCI) stellt anspruchsvolle Fragen der Krebsforschung und stellt Forschungsgelder bereit. Mathematiker haben sieben ungelöste „Millenium-Probleme“ aufgelistet und bieten für jedes eine Belohnung von einer Million Dollar. Wikipedia listet offene Fragen in 14 verschiedenen Disziplinen auf, darunter Physik, Chemie, Biologie, Medizin und Neurowissenschaften. Können wir also erwarten, dass sich die großen Namen aus den unterschiedlichsten Bereichen zehn Jahre später zusammenfinden, die klugen Köpfe, die diese Fragen beantwortet haben, nominieren, ihnen Prämien und Medaillen verleihen und dann die nächste „Liste der zehn wichtigsten Fragen“ zusammenstellen? Überraschenderweise – oder vielleicht auch nicht – stellt man bei einer Auflistung aller wichtigen Entdeckungen in den Biowissenschaften zwischen 1990 und 2015 und einem Vergleich mit der Liste der von mir identifizierten Probleme fest, dass es zwischen beiden Bereichen kaum Überschneidungen gibt (Tabelle 1). Wie Sie vielleicht schon vermutet haben, waren Einsteins sogenannte „drei Probleme“ von Anfang an reine Fiktion. Alles, was ihm blieb, waren einige Rätsel im Zusammenhang mit physikalischen Phänomenen, die größtenteils aus seinen eigenen Überlegungen stammten. Nehmen wir das erste Problem als Beispiel. Als Einstein noch zur Schule ging, entdeckte er ein interessantes Paradoxon: Wenn man sich vorstellt, man würde einem Lichtstrahl mit Lichtgeschwindigkeit hinterherjagen, dann sollte der Lichtstrahl wie eine Reihe oszillierender und stagnierender elektromagnetischer Wellen erscheinen – dies würde jedoch den Maxwell-Gleichungen widersprechen, die die Eigenschaften elektromagnetischer Strahlung perfekt erklären. Viele Jahre lang versuchte Einstein, die Maxwell-Gleichungen zu modifizieren, um diesen Widerspruch aufzulösen. Er scheiterte immer wieder, bis ihm eines Nachts auf dem Heimweg, nachdem er sich bei einem Freund beschwert hatte, eine Erleuchtung kam: Das Problem war nicht Maxwell, sondern die Zeit. Was wäre, wenn unser Verständnis von der Zeit selbst falsch wäre? Irgendwann hörte Einstein auf, sich mit seinen Gleichungen abzumühen und ließ seinen Gedanken freien Lauf. Mit anderen Worten, in seinen nächtlichen wissenschaftlichen Überlegungen gelangte er schließlich zu der Schlüsselfrage, die das Problem löste: Können wir unser Verständnis von Zeit ändern und alles selbstkonsistent machen? Dieses Problem wurde nicht von jemand anderem zugewiesen, sondern von Einstein selbst entdeckt. Die Schwierigkeit beim Befolgen einer Problemliste besteht darin, dass alle guten Probleme bereits gelöst wurden, insbesondere diejenigen, die gelöst werden können. Warum also legen Wissenschaftler die Frage nicht einfach beiseite und lassen ihre Gedanken schweifen? Stattdessen scheint ihr unterbewusster Gedanke „eine klare Frage haben“ zu sein – schließlich beginnt der Kern fast jeder wissenschaftlichen Arbeit mit einer klaren Frage und bewegt sich dann direkt zur Antwort. Tatsächlich sagt die Art und Weise, wie Wissenschaftler ihre Entdeckungen beschreiben, möglicherweise mehr darüber aus, wie Menschen Wissen kommunizieren, als darüber, wie dieses Wissen tatsächlich entsteht. Das liegt nicht nur daran, dass die Menschen schon immer gute Geschichten geliebt haben – um die ganze Geschichte verständlich zu machen, ist eine lineare Erklärung mit logischen Verknüpfungen tatsächlich die effektivste Methode. Hinter der linearen Erzählung des Papiers tappen sie möglicherweise immer noch viel Zeit im Dunkeln und suchen nach Problemen. Doch wenn wir erst einmal auf die richtige Frage stoßen, kann dies unser Denken verändern und sogar die gesamte Forschungsrichtung komplett umkehren. Unbekannte Unbekannte Wir vergleichen ein Wissenssystem oft mit einer Mauer: Fragmentiertes Wissen wird wie Ziegelsteine zu einem Ganzen zusammengefügt und bildet so ein Wissensgebiet in einem bestimmten Bereich. Diese Metapher legt nahe, dass wir, um die Wissenschaft voranzubringen, diese Mauer des Wissens stärken und erweitern, ihre Erklärungskraft verbessern und sie über Lehrbücher hinaus erweitern müssen. Die Löcher in der Wand werden als „Wissenslücken“ betrachtet, die wir füllen können, um bestehende Theorien zu verbessern und zu bereichern. Die Lösung eines bestimmten Problems bedeutet oft, eine Ecke der Wissensmauer freizumachen. Dieses Bild kann jedoch den falschen Eindruck erwecken, dass die Anhäufung von Wissen und Erkenntnissen sorgfältig geplant und eng terminiert werden kann. Im Gegenteil: Es liegt in der Natur wissenschaftlicher Entdeckungen, dass sie unvorhersehbar sind: Neue Entdeckungen passen möglicherweise nicht in den bestehenden Wissensbestand. Obwohl die ursprüngliche Absicht der Forschung darin besteht, eine Lücke zu schließen, ist das tatsächliche Ergebnis möglicherweise nicht das richtige Puzzleteil, sondern die Erschließung eines unerwarteten neuen Bereichs: Manchmal müssen wir senkrecht zur alten Mauer eine neue Mauer bauen oder sogar einen Teil der alten Mauer abreißen. Für viele Menschen ist dieser Gedanke nicht so angenehm. Schließlich bevorzugen wir eine saubere und schöne Welt, die mit rationaler Logik erklärt werden kann. Doch die interessantesten Unbekannten der Wissenschaft sind die unbekannten Unbekannten – diejenigen, von deren Existenz wir nicht einmal wissen, bis wir auf sie stoßen. Ein wirklich neues Problem, also ein unbekanntes Unbekanntes, ist unvorhersehbar. Das Stellen solcher Fragen erfordert nicht nur die Arbeit der Tageswissenschaft, sondern auch die der Nachtwissenschaft, doch dieser Aspekt wird durch den Problemlösungsprozess oft verdeckt. In manchen Fällen verbringen Wissenschaftler Jahre damit, an einem Problem zu arbeiten, wie Hawking zu Beginn des Artikels erwähnte. Sie erhalten eine systematische Ausbildung und erlernen die Forschungsmethoden der Naturwissenschaften im Alltag – die Gestaltung und Kontrolle von Experimenten; Während der nächtliche naturwissenschaftliche Unterricht von ihnen oft verlangt, langsam und allein zu forschen, sind neue Studenten im Labor normalerweise für die Überprüfung von Hypothesen verantwortlich und setzen Wissenschaft möglicherweise mit der Überprüfung von Hypothesen gleich. Vielen jungen Postdocs wurde gesagt, dass die Lösung von Problemen, die ihnen von anderen zugewiesen wurden, die Aufgabe von Doktoranden sei. Doch jetzt müssen sie das unbekannte Unbekannte selbst erforschen. Die von der wissenschaftlichen Gemeinschaft aufgelisteten bestehenden Probleme (wie etwa die in der linken Spalte der Tabellen 1 und 2 aufgeführten) sind in der Regel sehr allgemein gehalten und geben keine Anregungen für neue Forschungsrichtungen. Um solche Fragen zu beantworten, ist es oft notwendig, die ursprüngliche Frage neu zu organisieren und umzuformulieren, um sie neu auszurichten. Dies wird neue Aspekte des Problems aufdecken und ist nur nach einem tiefen Einblick in das Phänomen möglich. Beispiel: „Hat das Mikrobiom Einfluss auf das Tumorwachstum?“ Dies ist eine berechtigte Frage, sie sollte jedoch nur als Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen dienen. Nach ein wenig Analyse und anschließender eingehender wissenschaftlicher Auseinandersetzung könnten wir zu der Frage zurückkommen, ob das Mikrobiom beispielsweise ein Komplize des Tumors ist und von ihm manipuliert wird. oder „Dringen Bakterien in Tumorzellen ein?“ Diese neuen Fragen können völlig neue Hypothesen hervorbringen, die getestet werden müssen. Manchmal zielt die ursprüngliche Absicht, eine neue Frage zu stellen, nicht einmal auf ein bestimmtes bestehendes Problem ab, sondern führt möglicherweise auf unerwartete Weise zu dessen Antwort. Unsere Unwissenheit auf einem bestimmten Gebiet bietet oft einen fruchtbaren Boden für die Entstehung von Problemen und die Entdeckung neuer Probleme erfordert eingehende Forschung auf dem Gebiet. Francisco Mojica etwa schlug eine völlig neue Hypothese vor, um zu erklären, warum Bakteriengenome eine besondere Struktur aufweisen – die Forscher nennen sie „clustered regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPR)“, mit gleich langen „Spacern“ dazwischen, deren Sequenzen zufällig erscheinen. Vor Mojica interessierten sich nur wenige Wissenschaftler für diese seltsame Struktur. In Bezug auf CRISPR könnte die Frage lauten: „Warum haben Bakterien CRISPR-Elemente?“ Diese Frage ist jedoch zu allgemein, um von Interesse zu sein, und die Spacer-Regionen wurden weitgehend ignoriert. Doch Mojica fragte: „Was bedeutet die Ähnlichkeit zwischen dem Spacer und bekannten DNA-Sequenzen?“ Diese Frage war auf den Punkt gebracht, wurde aus der Nachtwissenschaft geboren und durch die rigorose Tageswissenschaft weiter beantwortet: Der Spacer ist eine Kopie der Virussequenz, die das erworbene Immunsystem der Bakterien anleitet, der Invasion des entsprechenden Virus zu widerstehen und seine DNA zu zerstören. In Tabelle 2 sind weitere Beispiele für die Neuausrichtung von Problemen und das Erreichen von Durchbrüchen aufgeführt. "Geschichtenerzählen" Wie Susskind zu Beginn des Artikels über Stephen Hawking sagte: Wenn ein Wissenschaftler eine wichtige Frage stellt, wird er für das Stellen der Frage gelobt, auch wenn sich seine Antwort später als falsch herausstellt. Dies liegt daran, dass eine Frage, die noch nie zuvor gestellt wurde, natürlich über alte Erkenntnisse hinausgeht: Um die Frage zu beantworten, muss lediglich einem logischen Schritt-für-Schritt-Prozess gefolgt werden, um die Frage jedoch zu stellen, ist ein unlogischer Sprung ins Unbekannte erforderlich – dies ist das Merkmal der nächtlichen Wissenschaft. Warum scheint dies nicht der Fall zu sein? Warum scheinen die Leute Antworten mehr zu schätzen als Fragen? Dies kann daran liegen, dass ein neues Problem stark genug ist, um unsere Realität zu verändern. Fragen neigen dazu, ihren Ursprung zu verwischen. Wenn eine Frage einmal gestellt ist, kann man sich nur schwer vorstellen, wie es war, bevor sie gestellt wurde. Fragen offenbaren einen neuen Aspekt der Realität und die Aufmerksamkeit der Menschen wird sofort auf die Suche nach Antworten gelenkt. Um dies visuell zu veranschaulichen, nehmen Sie als Beispiel den Cartoon-Wettbewerb des New Yorker – Sie müssen sich einen lustigen Titel für einen Cartoon ausdenken. Das ist eine gewaltige Herausforderung, wie jeder, der es schon einmal versucht hat, verstehen wird (siehe Abbildung 1, die Leser werden ermutigt, es einmal zu versuchen!). Wenn man jedoch den Titel einer anderen Person liest, bildet sich leicht ein Stereotyp und es ist schwierig, aus diesem Schema auszubrechen (der Referenztitel ist in der Bildunterschrift von Abbildung 2 versteckt). Ebenso kann eine neue wissenschaftliche Frage offensichtlich erscheinen, sobald sie gestellt wird (wie etwa „Worauf weist die Ähnlichkeit zwischen dem CRISPR-Spacer und bekannten DNA-Sequenzen hin?“), doch das bedeutet nicht, dass sie offensichtlich war, bevor sie gestellt wurde. Abbildung 1: Der New Yorker Cartoon-Wettbewerb: Können Sie diesem Cartoon einen interessanten Titel geben? | Quelle: www.JackZiegler.com, lizenziert aus der New Yorker Ausgabe vom 9. Mai 2005 Das Finden von Fragen kann Spaß machen, wie das Ausdenken eines Comic-Titels, aber es kann sich auch als äußerst schwierig erweisen. Die Öffentlichkeit erwartet von Wissenschaftlern oft, dass sie alles wissen, doch wir selbst haben in unserer täglichen Arbeit oft das Gefühl, ziemlich „dumm“ zu sein. Wissenschaft ist die Kunst, mit Dingen umzugehen, die wir noch nicht verstehen. Wie Wernher von Braun, der Vater der deutschen und amerikanischen Raketen, sagte: „Forschung ist das, was ich mache, wenn ich nicht weiß, was ich tue.“ Die Wissenschaft macht so demütig. Für junge Wissenschaftler ist es oft schwer zu verstehen, dass es normal ist, die Antwort oder nicht einmal die Frage zu kennen. Zu lernen, diese Unsicherheit zu akzeptieren, ist Teil unserer Reifung als Wissenschaftler. Uri Alon (Molekularbiologe) beschreibt anschaulich den Prozess, durch den wir Probleme wiederentdecken. Basierend auf unserem Wissen zu einem bestimmten Thema „A“ sagen Forscher voraus, dass es möglich sein sollte, Punkt „B“ zu erreichen, was ein scheinbar interessantes wissenschaftliches Ziel (Hypothese) ist. Im Laufe des Forschungsprozesses wurde die Situation jedoch zwangsläufig immer komplizierter, ein Hindernis nach dem anderen tauchte auf und die Forscher mussten immer wieder Umwege machen. Bald verlor er die Orientierung und konnte nicht erkennen, wo die Straße begann (sie schien plötzlich zu zerbröckeln) oder wo sie endete (sie schien unerreichbar). Urey nennt diese Situation „in der Cloud sein“ – Sie haben das ursprüngliche Problem aus den Augen verloren, aber der Grund für diese Situation ist selbst seltsam und es könnten sich darin einige aufregende Entdeckungen verbergen, die es wert sind, untersucht zu werden. Von den Wolken aus betrachtet, schien die Situation hoffnungslos, doch Urey betrachtete die Wolken als Zeichen der Wissenschaft: Wenn man sich in den Wolken befand, war man möglicherweise auf etwas sehr Unbekanntes, aber Interessantes gestoßen. Der Student sagt zu Yuri: „Ich bin verwirrt.“ Yuri antwortet: „Oh, gut – du bist also in der Cloud!“ Letztendlich könnten uns neue Fragen aus der Cloud zu einem unerwarteten Ziel führen: „C“. Abbildung 2: Explizite (Tageswissenschaft) und implizite (Nachtwissenschaft) Perspektiven der wissenschaftlichen Methode. Der Gewinnertitel des Cartoons in Abbildung 1 lautet „Weder die Zeit noch der Ort, Doug!“ Akzeptieren Sie die Unsicherheit Obwohl die wiederholte Überarbeitung von Hypothesen viel Zeit in Anspruch nehmen kann, wird die wissenschaftliche Methode oft als ein einfacher Prozess von der Frage bis zur Antwort angesehen. Die Realität ist jedoch weit weniger geordnet: Oft beginnt man mit einem Thema und einigen Phänomenen, aus denen sich einige Muster zusammenfassen und einige damit verbundene Fragen stellen lassen. Doch von der Formulierung klarer Hypothesen oder der Durchführung direkter Tests sind wir möglicherweise noch weit entfernt (Abbildung 2). Unserer Erfahrung nach weicht das Endergebnis oft stark von den ursprünglichen Erwartungen ab, selbst wenn ein Projekt mit einer sehr spezifischen Hypothese begonnen wird. Man kann daher sagen, dass die Nachtwissenschaft, die keine Pläne hat und nicht versucht, spezifische Probleme zu rekonstruieren oder zu lösen, möglicherweise am fruchtbarsten ist. Ein Wissenschaftler, der seine Annahmen aufgibt, hat die Freiheit, zu forschen und Zusammenhänge herzustellen. In gewissem Sinne sind alle Erwartungen darüber, wie die Dinge sein sollten – also Annahmen – eine Belastung, die unsere potenziellen neuen Ideen behindern kann. Sobald die Wissenschaft bei Nacht ein Problem geklärt und neu formuliert hat, können die Forscher die gesamte Leistungsfähigkeit der Wissenschaft bei Tag nutzen, um es zu lösen. In diesem Sinne sind große Entdeckungen oft sowohl die Antwort als auch die Frage selbst. Die Grundlagenforschung wird von Neugier getrieben und ein Großteil der Arbeit besteht aus freier Erforschung, bei der die Nachtforschung einen grundlegenden Teil ausmacht. Allerdings verlangen Förderorganisationen oft, dass die Forschung eine klare Richtung und Hypothese hat. Während ein Teil von Night Science im Sessel bei einer Tasse Kaffee erledigt werden kann, arbeiten wir die restliche Zeit mit großen, komplexen Datensätzen. Wird diese Arbeit nicht finanziell gefördert, könnte dies die Entstehung neuer Fragen verhindern und den wissenschaftlichen Fortschritt behindern: In der wissenschaftlichen Forschung sind die letztlich gelösten Fragen oft nicht die, die ursprünglich gestellt wurden. Natürlich verbringen wir alle viel Zeit damit, die angesprochenen Probleme zu behandeln. Beispielsweise könnten wir die spezifische regulatorische Struktur eines Gens oder die Evolution einer Genfamilie untersuchen. Dies geschieht jedoch normalerweise in der Hoffnung, dass die Lösung dieser Probleme zu neuen und spannenden Problemen führt. Die Sequenzierung des menschlichen Genoms ist ein gutes Beispiel: Die anfängliche wissenschaftliche Frage war klar („Wie lautet die DNA-Sequenz des menschlichen Genoms?“), aber die wirklich spannenden Fragen tauchten erst danach auf. Wenn eine Idee wirklich unerwartet ist, kann sie nicht dadurch entstehen, dass man ausgetretenen Pfaden folgt. Stattdessen können wir uns nur unter der Führung der Nachtwissenschaft vorwärtstasten, indem wir von unterschiedlichen Phänomenen ausgehen und nach unbekannten Problemen suchen. Diese Ungewissheit zu akzeptieren und in die Wolken zu fliegen, ist befreiend und aufregend, selbst wenn man sich unwissend und verloren fühlt. Nachtwissenschaft – dieses Feld, das Fragen und Ideen hervorbringt, scheint so geheimnisvoll, dass es nicht einmal einen Namen hat. Wir sind jedoch der Ansicht, dass es noch immer Muster gibt, denen wir folgen können. Diese werden wir in den nachfolgenden Artikeln dieser Reihe erörtern. Besondere Tipps 1. Gehen Sie zur „Featured Column“ unten im Menü des öffentlichen WeChat-Kontos „Fanpu“, um eine Reihe populärwissenschaftlicher Artikel zu verschiedenen Themen zu lesen. 2. „Fanpu“ bietet die Funktion, Artikel nach Monat zu suchen. Folgen Sie dem offiziellen Account und antworten Sie mit der vierstelligen Jahreszahl + Monat, also etwa „1903“, um den Artikelindex für März 2019 zu erhalten, usw. Copyright-Erklärung: Einzelpersonen können diesen Artikel gerne weiterleiten, es ist jedoch keinem Medium und keiner Organisation gestattet, ihn ohne Genehmigung nachzudrucken oder Auszüge daraus zu verwenden. Für eine Nachdruckgenehmigung wenden Sie sich bitte an den Backstage-Bereich des öffentlichen WeChat-Kontos „Fanpu“. |
Artikel empfehlen
Video-Websites sollten Film- und Fernsehgeschäfte auf diese Weise betreiben
Film- und Fernsehunternehmen sind zum nächsten We...
TCL-Spielkonsole T² Experience: Bringt das Heim-TV-Spielkonsolen-Erlebnis auf ein neues Niveau
Die „Aufhebung des Verbots für die Videospielkonso...
So lindern Sie Muskelschmerzen durch Training
Wenn wir am nächsten Morgen nach dem Training auf...
Die Person, die das Frittieren erfunden hat, ist ein wahres Genie. Können Eiszapfen und Bier gebraten werden?
Das Wetter wird kälter und viele Menschen verlieb...
Honda China: Im August 2023 verkaufte Honda China 102.000 Fahrzeuge, ein starker Rückgang von 25 % gegenüber dem Vorjahr
Honda China gab kürzlich bekannt, dass der Absatz...
Klick, klick! Wissenschaftler entschlüsseln das mysteriöse phonetische Alphabet der Pottwale
Produziert von: Science Popularization China Auto...
So führen Sie das Kurzhanteldrücken hinter dem Nacken aus
In der heutigen Gesellschaft mögen viele Mädchen ...
Die drei großen Betreiber treiben den Gigabit-Breitbandanschluss voran. Wann können wir ihn also nutzen?
Mit der fortschreitenden Umsetzung der Politik de...
Ist es gut, morgens zu laufen?
Menschen, die bei guter Gesundheit sind, haben of...
So verschlanken Sie Ihre Oberschenkel mit Fitness
Wenn Sie lange und schlanke Beine haben, werden I...
Ein berühmter Musiker ist vermutlich an Krebs gestorben. Wie kann man diese 10 häufigen Krebsarten im Voraus erkennen? Überzeugen Sie sich jetzt selbst!
Japanischen Medienberichten zufolge ist der berüh...
Der Wettbewerb unter den drei größten Luxusautoherstellern wird immer enger
Im ersten Quartal 2017 sprang Mercedes-Benz an di...
Baojun ist im Kleinwagenmarkt tätig. Warum sind Geely und Great Wall immer noch gleichgültig?
Ganz gleich, um welche Art von Markt es sich hand...
Wer beendet die seltene hohe Temperatur? Nur Kältewellen und starke Kaltluft!
Im vorherigen Artikel „Je höher man steigt, desto...