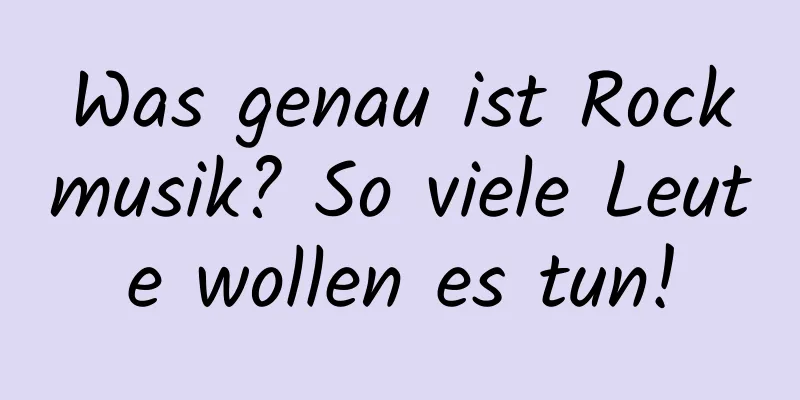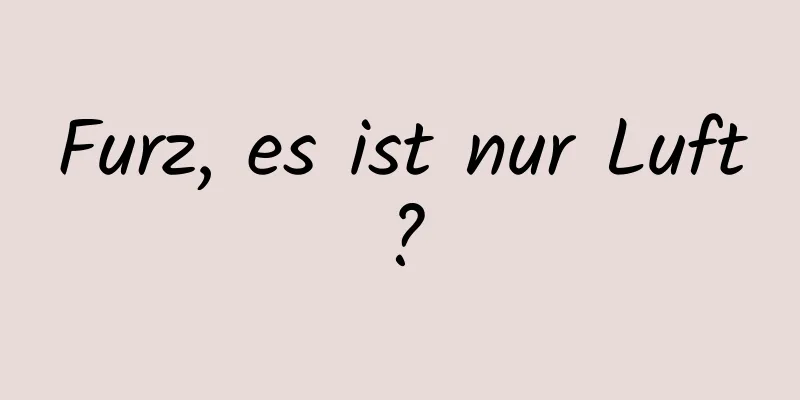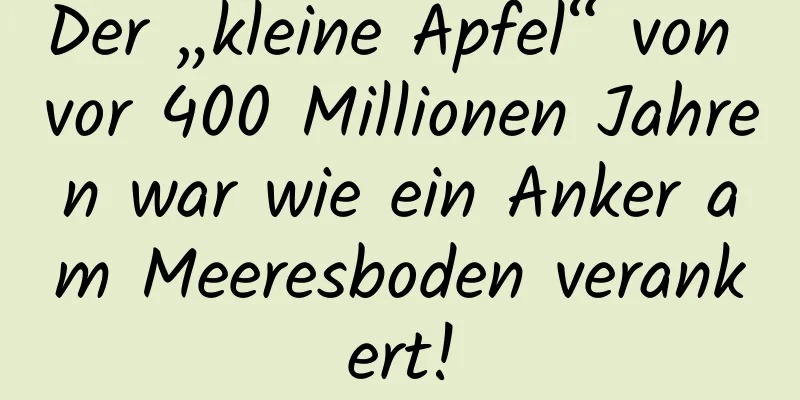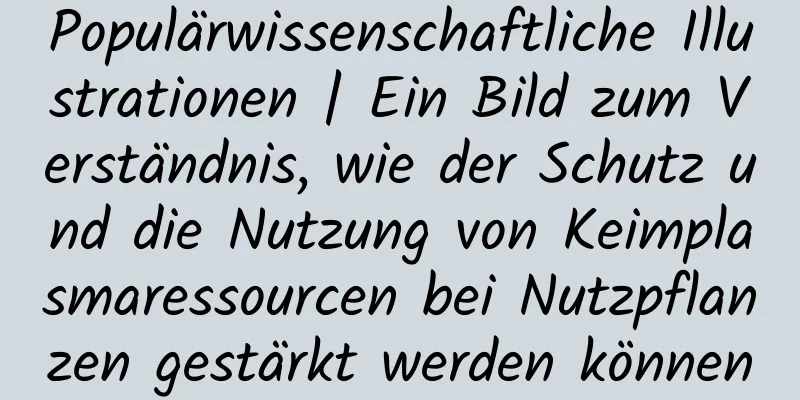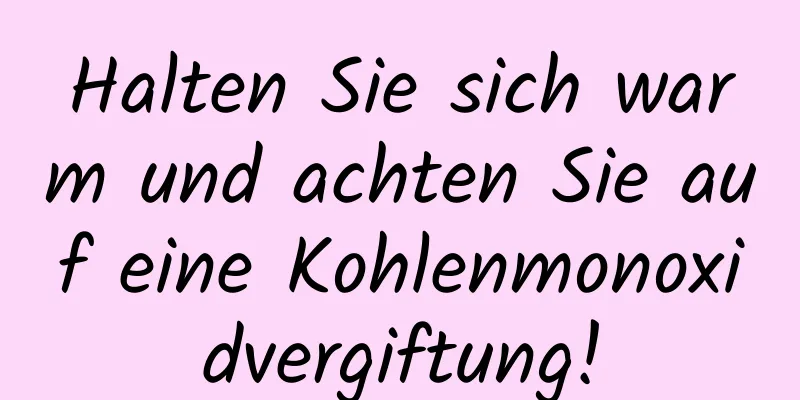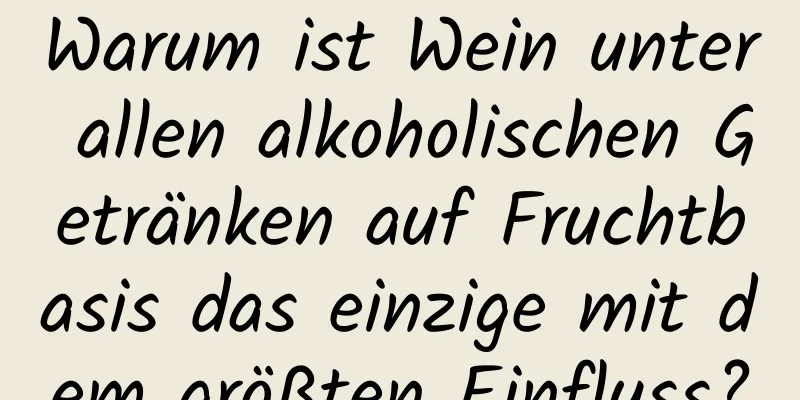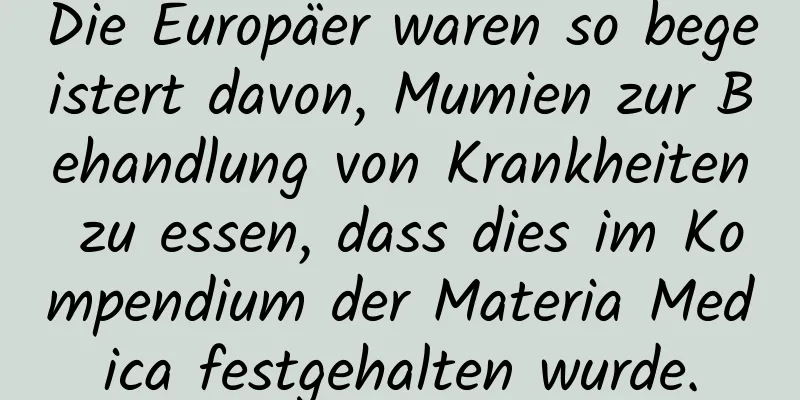Jemand hat sich auf das Sammeln menschlicher Gehirne spezialisiert: Wissenschaftler lüften das Geheimnis der grauen Substanz
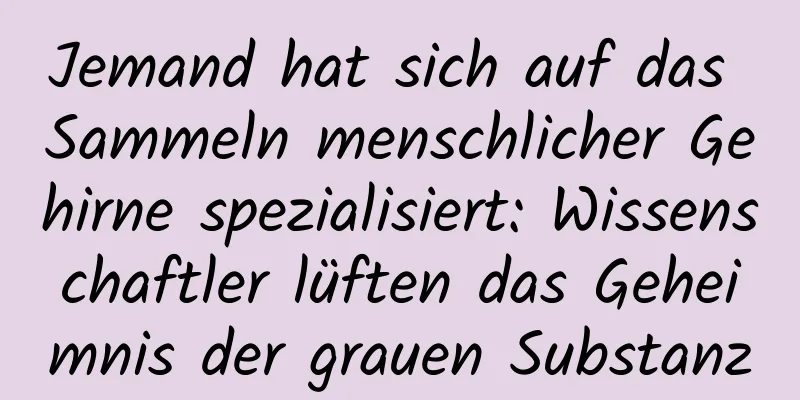
|
Leviathan Press: Es ist tatsächlich eine traurige Tatsache, dass Menschen, die im Laufe ihres Lebens verschiedene Unglücksfälle erlitten haben, mehrere Jahre nach ihrem Tod noch vollständiges Hirngewebe besitzen können. Und alles begann mit einem Molekularpaläontologen, der im Bestattungsgewerbe arbeitete und häufig unter Cluster-Kopfschmerzen litt. Alexandra Morton-Hayward, 35, ist eine ehemalige Bestatterin, die zur Molekularpaläontologin wurde. Nachdem sie in einem gemieteten Vauxhall fünf Stunden durch drei Länder gefahren war, geriet sie in der belgischen Ebene in einen sintflutartigen Regenguss. Die Scheibenwischer liefen auf Hochtouren und die grünen Felder Flanderns verschwammen. Hinter ihr stand eine schwarze Picknick-Kühlbox. Innerhalb von 24 Stunden wird es mit menschlichen Gehirnen gefüllt sein – nicht mit modernen Exemplaren, sondern mit Gehirnen, die im Mittelalter begannen, über dieses Land nachzudenken und wie durch ein Wunder bis zum heutigen Tag überlebt haben. Seit Jahrhunderten sind Archäologen über die Entdeckung bestimmter antiker Überreste verwirrt, denen jegliches Weichgewebe fehlt. Morton-Hayward, die derzeit an der Universität Oxford promoviert, besitzt derzeit die weltweit größte Sammlung antiker Gehirnproben, von denen einige bis zu 8.000 Jahre alt sind. Und indem sie Jahrhunderte alte wissenschaftliche Literatur durchforstete, hat sie einen erstaunlichen Katalog von Fällen zusammengestellt – mehr als 4.400 konservierte Gehirne, die 12.000 Jahre alt sind. Mithilfe hochentwickelter Techniken wie Massenspektrometrie und Teilchenbeschleunigern leitet sie eine neue Studie, die die molekularen Geheimnisse dahinter lüften soll, wie es einigen menschlichen Gehirnen gelang, Stonehenge oder die Große Pyramide von Gizeh zu überdauern. Die Forschung hat das Potenzial, nicht nur Geheimnisse der Vergangenheit, sondern auch der Gegenwart zu lüften. Morton-Hayward geht davon aus, dass die molekularen Prozesse, die unser Gehirn schädigen, stattdessen dazu beitragen könnten, es nach dem Tod zu erhalten – eine Entdeckung, die unser Verständnis des Alterns und neurodegenerativer Erkrankungen grundlegend verändern könnte. An diesem stürmischen Tag machte sich Morton-Hayward auf den Weg zu einem mittelalterlichen Friedhof in Belgien, um 37 kürzlich exhumierte Gehirne zu bergen. Sie strahlte während des Gesprächs Sympathie und Humor aus und schien entspannt, als sie über das Schneiden von Hirngewebe sprach. Während ihrer Arbeit im Bestattungsgewerbe kümmerte sie sich um Tausende von Leichen, bewegte Organe und ließ Körperflüssigkeiten ab, während sie mit einer Leichtigkeit sprach, als wären diese „Klienten“ noch am Leben. Als der Regen stärker wurde, wurde Morton-Hayward langsamer. Sie hatte eine ungute Vorahnung, dass ein Zustand bevorstand, den sie „Werwolf“ nannte. Ihre Wangen begannen heiß zu werden, sie nahm eine Hand vom Lenkrad und tätschelte ihre Wangen. „Ich spüre, wie mein Gesicht heiß wird“, murmelte sie. „Ich brauche Medizin.“ Ein weiterer Sturm braute sich in ihrem eigenen Schädel zusammen. Sie litt jede Nacht unter Cluster-Kopfschmerzen, die sich anfühlten, als würde man ihr wiederholt mit einem Eispickel ins Auge stechen oder mit einem Stock ins Auge schlagen. Die Ermüdung durch lange Autofahrten bei schlechtem Wetter führte zu einem früheren Wiederauftreten der Symptome als üblich. „Es ist eine der schmerzhaftesten Erkrankungen, die der Mensch kennt“, sagte sie. Man nennt es „Selbstmordkopfschmerz“, weil 40 Prozent der Patienten letztlich nur wollen, dass die Schmerzen aufhören. In diesem Sinne bin ich mir meines Gehirns immer bewusst. Manchmal fühlt es sich schlimmer an als die Gehirne in meinem Labor.“ Normalerweise ist das Gehirn unser verletzlichstes Organ. Nach wenigen Minuten der Unterbrechung der Blut- oder Sauerstoffzufuhr kommt es zu Nervenschäden und schließlich zum Nervenzusammenbruch. Innerhalb weniger Stunden nach dem Tod beginnen Enzyme im Gehirn, die Zellen von innen heraus abzubauen. Dieser Vorgang wird Autolyse genannt. Innerhalb weniger Tage reißen die Zellmembranen und das Gehirn verflüssigt sich. Schließlich versagt die Blut-Hirn-Schranke, wodurch Mikroben eindringen und sich an dem nährstoffreichen Festmahl gütlich tun können – ein widerlicher Prozess, der als Fäulnis oder, umgangssprachlich, Verwesung bekannt ist. Wenn ein Körper freiliegt, kann er Maden, Insekten oder Nagetiere anlocken, die sich von den Überresten ernähren. Bald war nur noch ein hohler Schädel übrig. Unter Wasser oder unter der Erde verlangsamt sich die Verwesung jedoch (je tiefer man vergraben ist, desto langsamer verläuft die Verwesung), die meisten Kadaver werden jedoch innerhalb von 5 bis 10 Jahren skelettiert. Aus diesem Grund haben Wissenschaftler lange nicht erkannt, dass das Gehirn manchmal Tausende von Jahren lang intakt bleiben kann, ohne dass es konserviert, eingefroren oder mineralisiert wird. Über Generationen hinweg wurden entdeckte Gehirne aus der Antike oft als exotische Kuriositäten betrachtet und vergessen oder einfach weggeworfen. Das beginnt sich jetzt zu ändern. In ihrem Labor in Oxford füllt Morton-Hayward zwei Kühlschränke mit Gehirnproben in Behältern zum Mitnehmen und Plastiktüten. Weitere Proben wurden in Kisten bei Raumtemperatur gelagert. Über ihrem Schreibtisch werden außerdem Gehirnproben in Keksdosen, kleinen Flaschen und auf Glasobjektträgern aufbewahrt. Ihre Sammlung ist so groß, dass einige Exemplare in ein externes Lager gebracht wurden – genug, um drei zusätzliche Kühlschränke zu füllen. Im Bewusstsein der tragischen Verluste von Exemplaren anderswo kaufte sie für den Fall eines Stromausfalls einen Generator. (1986 wurde eine Gehirnprobe aus einem 8.000 Jahre alten Friedhof in Florida zerstört, als ein Kühlschrank den Strom verlor.) Alexandra Morton-Hayward, Molekularpaläontologin am Institut für Geowissenschaften der Universität Oxford. © Alicia Canter In den letzten fünf Jahren hat Morton-Hayward mehr als 600 Gehirne von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt gesammelt. Ihre größte Beute (450 Gehirne) stammte von einem Friedhof im Südwesten Englands, der die Überreste von Armenhauspatienten, Irrenanstaltspatienten und Kriegsgefangenen aus dem 18. und 19. Jahrhundert enthielt. Dutzende Gehirne stammten aus einem Massengrab in Philadelphia, in dem sich angeblich Opfer einer Gelbfieberepidemie befanden. Die älteste jemals gefundene Hirngewebeprobe stammt von einem unglücklichen Schweden, dessen Kopf vor 8.000 Jahren zertrümmert, abgetrennt und auf eine Stange aufgespießt wurde. „Meiner Erfahrung nach geben mir die Leute gerne Proben“, sagte sie. „Manche Archäologen haben eine regelrechte Abneigung gegen Weichgewebe.“ Im Labor öffnete sie einen Plastikbehälter und entnahm vorsichtig ihren „Showhund“, ein Exemplar, das sie Rusty nannte – ein rotbraunes Gehirn aus dem Grab eines Armen, dessen tiefe Rillen deutlich sichtbar waren. „Er ist mein Liebling“, sagte sie und wiegte ihn in ihren behandschuhten Händen. „Entschuldigen Sie, es kann zu Formaldehydgeruch kommen.“ Morton-Hayward sammelt Gehirne aus der ganzen Welt. © Alicia Canter Diese Gehirne hatten eine eigenartige Gemeinsamkeit: Viele stammten von Menschen, deren Leben unter Qualen geendet hatte. „Viele der Orte, an denen wir diese gut erhaltenen Gehirne finden, sind, offen gesagt, Orte des Leidens“, erklärte Morton-Hayward. Morton-Hayward kann ihre Faszination für das Gehirn auf einen ganz bestimmten Zeitpunkt zurückführen – als ihr eigenes Gehirn begann, sie zu quälen. Während ihres Archäologiestudiums an der Universität St. Andrews litt sie unter starken Kopfschmerzen, für die die Ärzte keine Ursache finden konnten. Schließlich enthüllte ein MRT-Scan eine seltene Anomalie: Ein Teil ihres Gehirns war in die Öffnung gerutscht, wo ihre Wirbelsäule in den Schädel übergeht. Diese seltene Erkrankung wird Chiari-Malformation genannt. In seinem letzten Jahr in St. Andrews unterzog sich Morton-Hayward einer schwierigen Operation, um den Druck auf sein Gehirn zu lindern. Aber die Kopfschmerzen gingen nicht weg. „Es hat alles beeinflusst, was ich getan habe“, sagte sie. „Jeden wachen Moment.“ Schließlich brach sie die Schule ab und verfiel in eine Depression. „Ich hatte keine Ahnung, warum ich solche Schmerzen hatte, und ich fühlte mich völlig nutzlos, wie ein totaler Versager.“ Es stellte sich heraus, dass sie auch an einer anderen Gehirnerkrankung litt: Cluster-Kopfschmerzen, einer Erkrankung, die in der Medizin als eine der schmerzhaftesten gilt. In einem Artikel im Journal of Neurology and Stroke beschrieb ein Betroffener Cluster-Kopfschmerzen als „gewitterartigen Schmerz“, der dazu führt, dass „es sich anfühlt, als würden einem die Augen aus dem Kopf springen“. Diese Kopfschmerzen treten typischerweise zu einer festgelegten Tageszeit auf, verursachen bei den Patienten ständige Angst und führen oft zu Folgeerkrankungen wie Angstzuständen, Depressionen oder posttraumatischen Belastungsstörungen [1]. Die Selbstmordrate bei Menschen mit Cluster-Kopfschmerzen ist etwa 20-mal höher als in der Gesamtbevölkerung. (Der genaue Zusammenhang zwischen Morton-Haywards beiden Erkrankungen ist noch unklar. „Es ist erstaunlich, wie wenig wir über das Gehirn wissen“, sagt sie. „Manchmal finde ich das beängstigend, manchmal aber auch beruhigend.“) Mit der Zeit wurden die Schmerzen für Morton Hayward unerträglich. Sie unternahm einen Selbstmordversuch, wachte jedoch im Krankenhaus auf. „Ich war schon immer eine Pragmatikerin“, flüsterte sie. „Ich dachte: ‚Wenn das nicht funktioniert, dann versuch etwas anderes, versuch zu überleben.‘“ Morton Hayward im Labor. © FEBS-Netzwerk Nachdem sie das College abgebrochen hatte, wechselte sie die verschiedenen Jobs: Trauma-Krankenschwester, Trauerberaterin, Tellerwäscherin und Hochzeitsplanerin (was sie zutiefst frustrierend fand, weil sie dachte, dass Paare sich mehr um die Tischdecke als um die Ehe selbst kümmerten). Da sie unbedingt etwas Neues ausprobieren wollte, bewarb sie sich um eine Stelle bei einem Bestattungsunternehmen in Rochester. Das Bestattungsunternehmen wird von einem Gerichtsmediziner geleitet, der seit seinem 15. Lebensjahr in der Branche tätig ist. Das Vorstellungsgespräch verlief gut und der Kurator führte sie herum. Er führte sie in die Trauerhalle, einen ruhigen Raum mit Vorhängen und sanfter Musik, wo sich die Familienmitglieder vom Verstorbenen verabschiedeten. Zu Morton-Haywards Überraschung sah sie einen offenen Sarg, der die Leiche einer älteren Frau enthielt. „Der Kurator legte seine Hände auf die Seite des Sarges und sprach mit mir“, erinnerte sie sich. Dies war das erste Mal, dass sie eine Leiche sah. „Ich war nicht schockiert, aber ich dachte: Das ist seltsam. Überraschender war ich von seiner scheinbaren Ruhe.“ Später wurde ihr klar, dass es ein Test war, um herauszufinden, ob sie sich bei der Arbeit mit Leichen wohl fühlte. Die Antwort ist ja. „Das ist der lustigste Job, den ich je hatte“, sagte sie. In den nächsten fünf Jahren kümmerte sich Morton Hayward um mehr als 5.000 Leichen. Sie half bei der Organisation von Trauerfeiern, kleidete die Toten ein, nähte durch die Totenstarre entstandene Gesichtsdeformationen zu, platzierte Plastikpflaster unter den Augenlidern, damit die Leichen friedlich schliefen, und erlernte Einbalsamierungstechniken – das Vornehmen eines Einschnitts in die Oberschenkelarterie zum Ablassen von Körperflüssigkeiten und das anschließende Injizieren von Konservierungsmitteln. Ihre eigenen traumatischen Erlebnisse haben ihr ein tiefes Mitgefühl für Tod und Leid verliehen. „Wenn jemand stirbt – egal wie alt er ist und ob es erwartet wurde oder nicht – ist das verheerend“, sagte sie. Bestatter geraten oft in den Fokus von Trauer, Wut und Frustration, weil sie der Familie sagen, sie müsse ihren geliebten Verstorbenen loslassen und begraben. Doch diese Wut verwandelt sich immer in Dankbarkeit. Morton Hayward besitzt ein 1000 Jahre altes menschliches Gehirn. © Graham Poulter/PA Wire Sie begann, über das Geheimnis der Überreste nachzudenken. „Man kennt ihre Lieblingserinnerungen, die Farben und solche Dinge, und dann legt man sie auf den Leichentisch, hält ihr Gehirn in den Händen und fragt sich: Wo sind diese Erinnerungen gespeichert?“ Sie entwickelte eine Faszination für Tod und Verfall und dafür, wie man diese Dinge wissenschaftlich untersuchen kann. „Ich habe mich nie als Wissenschaftlerin gesehen, deshalb habe ich beschlossen, wieder zur Schule zu gehen“, sagte sie. Trotz seines angeschlagenen Gesundheitszustands schloss Morton-Hayward 2015 sein Grundstudium ab, indem er sich für Online-Kurse an der Open University einschrieb. Früher schämte sie sich, die Schule abgebrochen zu haben, doch mittlerweile hat sie begonnen, ihr Selbstvertrauen zurückzugewinnen und erhielt für ihre Bachelorarbeit über die Zeugenaussagen forensischer Experten im Kriegsverbrecherprozess von Srebrenica eine Ehrendoktorwürde und einen Preis. Sie begann zu spüren, dass sie in der Schule kein Versager war. Vielleicht könnte sie sogar eine wissenschaftliche Karriere mit einer neurologischen Erkrankung vereinbaren? Im Jahr 2018 begann sie, Nachtschichten in einem Bestattungsunternehmen zu arbeiten, während sie gleichzeitig am University College London (UCL) einen Master in Bioarchäologie und forensischer Anthropologie machte. „Ich hatte es satt, die Leute in den Dreck zu ziehen, und beschloss, sie auszugraben“, sagte sie lachend. Im Jahr 2022 erhielt Morton Hayward (links) das Stipendium der British-Danish Association. © Universität Oxford Während ihres Graduiertenstudiums machte Morton-Hayward eine merkwürdige Entdeckung, die den Verlauf ihres Lebens veränderte. Vor Jahrzehnten stellte eine Reihe von Entdeckungen von Archäologen das Wissen, das sie sich im Laufe ihrer Jahre in der Bestattungsbranche angeeignet hatte, auf den Kopf. Sie begann sich für die andere Seite des Todes zu interessieren. Im Jahr 1994 wurde eine freimütige Archäologin namens Sonia O'Connor zu einer Ausgrabungsstätte in Hull gerufen, wo etwa 250 Gräber eines mittelalterlichen Klosters freigelegt worden waren. Die Ausgrabungsstätte war voller Überraschungen: antike Unterwäsche, an Syphilis erkrankte Skelette und ein riesiger Sarg, dessen Eichenbretter die Spuren eines fettleibigen Mannes aufwiesen – vom leitenden Archäologen als „typisches Bild von Bruder Tuck aus der Robin-Hood-Legende“ beschrieben. Aus 200 Jahre altem Hirngewebe. © Graham Poulter/PA Wire Was die Ausgräber jedoch am meisten schockierte, war die Tatsache, dass beim Zersplittern eines Schädels eine graubraune Substanz zum Vorschein kam. Als O'Connor das ungewöhnliche Exemplar untersuchte, stellte er fest, dass es sich um ein geschrumpftes, verfärbtes Organ mit zwei Gehirnhälften und den typischen Oberflächenfalten handelte. „Ich dachte: Das ist ein Gehirn!“ erinnerte sie sich. Doch das schien jenseits des gesunden Menschenverstands zu liegen: Der Leichnam lag seit über 400 Jahren begraben. Mit Hilfe des Forensikers Don Brothwell, der auch Massengräber auf dem Balkan untersucht hatte, entdeckte O'Connor, dass jeder zehnte an der Fundstelle gefundene Schädel ein konserviertes Gehirn enthielt. Die Gehirne waren geschrumpft, fühlten sich schwammig oder spröde an und waren überwiegend braun oder rostfarben mit schwarzen Flecken. Die am besten erhaltenen Gehirne stammten aus dem feuchtesten Teil des Friedhofs und viele der Gehirne wiesen eine mysteriöse orangefarbene Ablagerung im Boden auf. Die Gehirne wurden nicht durch bekannte Methoden wie Dehydration, Mumifizierung oder natürliche Gerbung in saurem Wasser konserviert. Mit Ausnahme des Gehirns sind alle anderen Weichteile verschwunden. „Wenn Sie mit Pathologen sprechen, werden sie Ihnen sagen, dass das Gehirn eines der ersten Organe im Körper ist, das sich verflüssigt“, sagte O’Connor. „Und wir sehen genau das Gegenteil.“ Einige der von O’Connor konsultierten Experten waren skeptisch. Ein Experte vermutete sogar, dass es sich bei ihrem sogenannten Gehirn möglicherweise nur um eine Art Pilz handeln könnte. Doch je mehr O'Connor recherchierte, desto überzeugter war er von seinem Urteil. In den frühen Tagen des Internets konnte O'Connor nur wenige Berichte über konservierte Gehirne finden. Im späten 18. Jahrhundert verlegten die französischen Behörden den größten Friedhof von Paris, den berüchtigten Cimetière des Saints-Innocents, und entdeckten dabei Gehirne, die dort seit Jahrzehnten lagen. „Angesichts dieser erstaunlichen Widerstandsfähigkeit gegen die Zerstörung können wir nicht anders, als erstaunt zu sein“, schrieb der Arzt Michel-Augustin Thouret, nachdem er die Überreste im Jahr 1791 untersucht hatte. Die Knochen wurden in Steinbrüche gebracht, die heute als Katakomben bekannt sind, während die Gehirne weitgehend in Vergessenheit gerieten. Im Jahr 1902 grub der australisch-britische Anatom Grafton Elliot Smith auf einem prähistorischen ägyptischen Friedhof fast 500 Gräber mit konservierten Gehirnen aus. „Die Anatomen und Anthropologen scheinen sich dieser Tatsache nicht nur überhaupt nicht bewusst zu sein, sondern sogar ihre Möglichkeit zu leugnen“, schrieb er bedauernd. Bald darauf erfuhr O’Connor, dass konservierte Gehirne auch in England, Dänemark, den Niederlanden und den Vereinigten Staaten gefunden worden waren. Allerdings wurden die meisten dieser erstaunlichen Entdeckungen nicht ernst genug genommen oder sogar direkt verworfen, was dazu führte, dass spätere Wissenschaftler jedes Mal überrascht waren, wenn sie diese alten Exemplare wiederentdeckten. Dann kam die berühmteste Entdeckung. Im Sommer 2008 grub ein Team von Archäologen des York Archaeological Trust einen Entwässerungskanal aus der Eisenzeit in der Nähe des Dorfes Heslington aus und entdeckte dabei einen dunklen Schädel, der mit dem Gesicht nach unten in Lehm vergraben war. Während der Reinigung des Schädels hörte ein Labortechniker ein „pochendes“ Geräusch aus dem Inneren des Schädels und bemerkte später eine gelbe, schwammartige Masse. Zufällig war die Labormitarbeiterin eine Studentin von O'Connor gewesen und erinnerte sich an ihre Vorlesungen über konservierte Gehirne. Sie rief sofort ihren ehemaligen Mentor an, der daraufhin bestätigte, dass es sich bei Heslingtons Entdeckung tatsächlich um ein Stück Gehirn handelte.[2] O'Connor stellte ein interdisziplinäres Forscherteam zusammen und rekonstruierte eine erschreckende Geschichte, die sie 2011 in einem Artikel im Journal of Archaeological Science veröffentlichten. Untersuchungen[3] ergaben, dass der Schädel etwa 2.500 Jahre alt war und einem erwachsenen Mann gehörte, der enthauptet und in einen kleinen Teich geworfen worden war. Abgesehen von einem kleinen Knochen fehlten alle anderen Körperteile, und das einzige übriggebliebene Weichgewebe war das Gehirn – das älteste Gehirn, das jemals in Großbritannien gefunden wurde. Dieses besondere Gehirn stammt aus dem 17. Jahrhundert. © Alexandra Morton-Hayward Nachdem die Entdeckung in den Medien bekannt wurde, nahm Axel Petzold, ein Neurologe am UCL, Kontakt zu O'Connor auf. Er untersucht degenerative Erkrankungen an lebenden Patienten, bei denen häufig Proteinpathologien eine Rolle spielen. Er spekuliert, dass ähnliche abnormale Proteinaggregate in Heslingtons Gehirn vorhanden gewesen sein könnten und möglicherweise sogar zu dessen Erhaltung beigetragen haben. Er überredete O’Connor, eine Probe bereitzustellen, und im Laufe des nächsten Jahrzehnts identifizierte das UCL-Team mehr als 800 Proteine im antiken Gehirn – die größte Zahl, die jemals in einem archäologischen Exemplar gefunden wurde. Irgendwie bildeten diese Proteine hartnäckige Aggregate, die das Gehirn über 2.000 Jahre lang konservierten. Für Morton-Hayward ist die Untersuchung von Heslingtons Gehirn „atemberaubend“. Die Vorstellung eines 2.500 Jahre alten, intakten Gehirns hat sie umgehauen. Selbst in einer gekühlten Leichenhalle verflüssigt sich das Gehirn normalerweise innerhalb weniger Tage. Wie konnte ein so altes Gehirn erhalten werden? Ihre Masterarbeit gab sie schließlich dem Titel „Proteinkonservierungsmechanismen im antiken Gehirn“. Bald darauf begann sie mit O'Connor zu arbeiten. Während der Pandemie brachte sich Morton-Hayward selbst Proteomik, die Lehre von Proteinen, bei und begann, Berichte über konservierte Gehirne aus dem 17. Jahrhundert zusammenzustellen. Sie fand eine Richtung für ihre Doktorarbeit: Sie wollte die zellulären und molekularen Prozesse erforschen, die Nervengewebe widerstandsfähig gegen Zerfall machen, also die grundlegenden Gründe für die Erhaltung des Gehirns aufdecken. Während ihrer Promotion an der Universität Cambridge kam es jedoch zu einem Streit mit ihrem Betreuer und sie musste sich darum bemühen, ihr Forschungsprojekt an die Universität Oxford zu verlegen. Irgendwann befürchtete sie, dass ihre neue Karriere scheitern würde. Das waren dunkle Tage – und ich litt jede Nacht unter Cluster-Kopfschmerzen. „Viele Studenten könnten den Schmerz und die Frustration, die sie durchgemacht hat, wahrscheinlich nicht ertragen“, sagte Erin Saupe, Professorin für Paläontologie an der Universität Oxford und eine ihrer derzeitigen Betreuerinnen. „Der Entdeckungsprozess schien ihr großen Spaß zu machen, und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum sie weiterkam.“ Für das bloße Auge sieht das Urhirn einem normalen Gehirn sehr ähnlich, außer dass es eine dunklere Farbe und eine kleinere Größe hat. Unter dem Mikroskop sind jedoch Reste von Nervenfasern zu erkennen – Reste der Struktur des Gehirns. „Es ist wie ein Spinnennetz“, sagte Morton-Hayward, dessen Forschung sich auf die Entschlüsselung der molekularen Prozesse konzentriert, die das Hirngewebe nach dem Tod erhalten. „Es gibt viele Lücken, was wirklich seltsam ist, weil es so solide aussieht.“ Sie verwendet Massenspektrometrie, um Aminosäuren und Proteine zu identifizieren, die in altem Gewebe konserviert sind (am häufigsten ist hier das Myelin-Basisprotein, ein Teil der Isolierschicht von Neuronen). Sie brachte außerdem Hirngewebe zum nationalen Teilchenbeschleuniger Großbritanniens, der Diamond Light Source in Harwell, wo sie in 19-Stunden-Schichten das Gewebe mit Elektronen bombardierte, die sich mit nahezu Lichtgeschwindigkeit bewegten, um Metalle, Moleküle und Mineralien zu identifizieren, die mit der Konservierung des Gehirns in Verbindung stehen. Sie führte auch Experimente durch, bei denen sie tote Mäuse in mit Wasser oder Quarzpulver gefüllte Gläser legte, um zu untersuchen, wie die Gehirne in verschiedenen Bestattungsumgebungen verwesten. Nach sechs Monaten beobachtete sie einen Anstieg des Anteils an Myelinproteinen – Proteinen, die auch in den alten Gehirnen in großen Mengen gefunden wurden. „Wir fanden heraus, dass die Mäusegehirne in einer sauerstoffarmen, wasserreichen Umgebung besser konserviert wurden. Das ist interessant, weil dies auch die Umgebung ist, in der menschliche Gehirne konserviert werden.“ Diese Analysen weisen alle auf eine Grundursache hin: ein Phänomen namens „molekulare Vernetzung“. Sie vermutet, dass Proteinfragmente und abgebaute Lipide im Gehirn sich an die Metalle binden und so ein schwammartiges Material bilden, das dem Zerfall widersteht. Durch den Vernetzungsprozess wird Wasser verdrängt – was erklärt, warum konservierte Gehirne oft geschrumpft sind – und es entsteht ein haltbares Polymer, das lange halten kann. Da das Gehirn reich an Proteinen und Lipiden ist, bietet es „eine ideale Mischung“ für diese besondere natürliche Konservierung, erklärt Morton-Hayward. Dieser Prozess wird durch Metalle, insbesondere Eisen, katalysiert. Tatsächlich waren gut erhaltene Gehirne reich an Eisen, in manchen Fällen sogar bis zu 25 Prozent. Eisenmineralien im Gehirn lassen alte Gehirne gelb, schwarz, orange oder rot erscheinen, wie „Rusty“. Im lebenden Gehirn unterstützt Eisen lebenswichtige Funktionen wie Atmung und elektrische Signale. Eisen kann jedoch auch gefährlich sein, da es sich mit zunehmendem Alter ansammelt und ein Phänomen fördert, das als oxidative Schäden bekannt ist. Oxidativer Schaden wird mit Alterungsprozessen, neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson sowie anderen Hirnerkrankungen in Verbindung gebracht. Tatsächlich legt Morton-Haywards Forschung nahe, dass oxidativer Stress während des Lebens einen Prozess in Gang setzen kann, der nach dem Tod anhält und unter bestimmten Bedingungen (wie etwa in hypoxischen oder überfluteten Umgebungen) stärkere Querverbindungen hervorbringt. Sie stellte fest, dass viele der konservierten Gehirne von Menschen stammten, deren Leben auf tragische Weise endete – in Massengräbern, durch traumatische Todesfälle oder in Arbeitshäusern und psychiatrischen Kliniken. „Jede Art von körperlichem Stress – wie Hunger – lässt Sie schneller altern und verkürzt Ihre Lebenserwartung“, sagte sie. „Vielleicht finden wir deshalb so viele Gehirne an Orten großen Leids und großer Entbehrung.“ Mit anderen Worten: Der Prozess der beschleunigten Alterung setzt sich auch nach dem Tod fort. Das Ergebnis ist eine grausame Ironie: Die Faktoren, die jemanden im Leben möglicherweise den Verstand gekostet hätten, helfen dabei, manche Gehirne nach dem Tod zu erhalten. Ein Kühlschrank, in dem Gehirne im Labor von Morton-Hayward gelagert werden. © Alicia Canter Im März 2024 veröffentlichte Morton-Hayward die vorläufigen Ergebnisse ihrer Forschung in den Proceedings of the Royal Society B[5]. Nach der Veröffentlichung des Artikels gab sie mehrere Tage lang Medien auf der ganzen Welt Interviews, darunter CNN, BBC, New Scientist und das Magazin Science. „Es ist wunderbar, dass wir diesen Bereich nun zu einem ernsthaften Forschungsthema entwickelt haben“, sagte O’Connor, der inzwischen im Ruhestand ist. Sie freut sich, dass Morton-Hayward seine Forschung fortsetzt. „Es ist großartig, eine Doktorandin zu haben, die bereit ist, diese Forschung voranzutreiben – sie versteht etwas von Chemie, Physik, Genetik und all diesen Bereichen.“ Einer von Morton-Haywards Mentoren, Professor Greger Larson, erwähnte, dass eine ihrer „Superkräfte“ ihre „Fähigkeit“ sei, „mit Experten auf all diesen unterschiedlichen Gebieten Kontakte zu knüpfen und Freundschaften zu schließen“: „Viele Leute helfen ihr, aber sie steht eindeutig im Mittelpunkt dieser Forschung.“ Allerdings wissen nur wenige Menschen, welche Schmerzen Morton-Hayward ertragen musste, um an diesen heutigen Punkt zu gelangen. Cluster-Kopfschmerzattacken folgen einem vorhersehbaren Muster und treten immer spät in der Nacht auf. Ihre Augen und Nase begannen zu tränen, ihre Wangen wurden heiß und sie spürte einen stechenden Schmerz. Sie konnte sich nicht hinlegen: Jeder Druck auf ihren Hinterkopf wäre unerträglich geworden. Ihr Verlobter Richard Thomas, ein Postdoktorand der Geowissenschaften an der Universität Oxford, konnte nur hilflos zusehen. „Es ist schrecklich“, sagte Thomas. „Ich kann nichts tun.“ Alle drei Monate bekommt Morton-Hayward einen Nervenblocker in den Hinterkopf gespritzt; Der Schmerz verstärkt sich eine Woche lang, bevor er nachlässt. Um die Schmerzen zu lindern, nimmt sie ein Triptan, ein Medikament, das die Blutgefäße erweitert. Sie nahm für kurze Zeit Steroide, wenn sie beruflich beschäftigt war, doch die langfristige Einnahme von Steroiden ist mit einem hohen Risiko verbunden. Zu Hause hat sie eine Sauerstoffflasche und einen Vagusnervstimulator. „Extreme Schmerzen können das Herz beeinträchtigen“, sagt sie, „deshalb nehme ich jetzt Herzmedikamente.“ Ihre beste Verteidigung besteht vielleicht darin, bewusste Selbstdistanz zu üben. „Nichts kann es lindern“, sagte sie, „der einzige Weg ist, es nicht zu spüren, sich vorzustellen, man sei nicht in seinem Körper.“ Du legst es außerhalb von dir selbst ab. „Die Dämmerung brach an und der Werwolf zog sich zurück. „Ich leide unter Amnesie“, sagte sie. „Du kannst nur weitermachen, wenn du vergisst, wie schlimm die Schmerzen waren.“ Ich denke, es ist die natürliche Reaktion des Körpers. Sonst können Sie einfach nicht durchhalten und legen sich nie schlafen, weil Sie wissen, dass der Schmerz kommt. „Ich habe versucht, sie zur Ruhe zu bringen, aber sie sagte: ‚Nein, ich muss promovieren!‘“, sagte Thomas. „Wenn ich es wäre, hätte ich schon vor langer Zeit aufgegeben.“ Er übernahm die Rolle des Pflegers und sorgte unter anderem dafür, dass sie gut ernährt war. „Sie versuchte, rund um die Uhr zu arbeiten“, sagte Thomas. „Ich glaube, bevor ich sie kennenlernte, lebte sie praktisch nur von Toast und Bier.“ „Dieses unerbittliche Tempo forderte seinen Tribut von ihrem Körper. Letztes Jahr litt Morton-Hayward unter starken Bauchschmerzen, die sie ignorierte. Tatsächlich handelte es sich jedoch um einen Eierstockabszess und die Infektion hatte sich im ganzen Körper ausgebreitet, was zu einer Sepsis führte. Sie verbrachte zwei Wochen im Krankenhaus und erhielt Bluttransfusionen. „Am dritten Tag stürmte ein riesiges Team in den Raum und wirkte völlig panisch“, erinnert sie sich. „Mein Hämoglobinwert war so niedrig, dass sie dachten, ich hätte einen Herzstillstand.“ © Graham Poulter Im April 2024, kurz nach der Veröffentlichung des Artikels, reiste Morton-Hayward nach New Orleans, um an einer wissenschaftlichen Konferenz teilzunehmen und mit ihrem Verlobten Thomas Urlaub zu machen. Gegen Ende der Reise begann sie jedoch zu husten. Auf dem Rückflug wurde ihre Atmung flach. Bei ihrer Ankunft ging sie sofort in die Notaufnahme, wo sie eine Lungenentzündung erfuhr und erneut ins Krankenhaus eingeliefert wurde. „Ich habe es wirklich satt, krank zu sein“, sagte sie. Selbst als ihr Gehirn und ihr Körper sich gegen sie zu verbünden schienen, machte Morton-Hayward weiter. Niemand kann die Kostbarkeit und Dringlichkeit der Zeit besser verstehen als jemand, der an einer schweren Krankheit gelitten hat oder die Erfahrung von Leben und Tod gemacht hat. ---Ein paar Wochen später nahm Morton Hayward, der gerade eine Lungenentzündung überstanden hatte, eines Morgens eine Kühlbox fürs Picknick und begann, nach weiteren Proben zu suchen. Sie fuhr den ganzen Weg von Oxford nach Belgien bei stürmischem Wetter. Wie üblich hatte sie in der Nacht erneut Kopfschmerzen, diesmal in einem Hotel außerhalb von Gent. Am nächsten Morgen holte sie beim Frühstück ihr Telefon heraus und warf einen Blick auf das Bild eines Gehirns von einem mittelalterlichen Friedhof. Nachdem sie die Kühlbox in ihr Auto geladen hatte, fuhr sie durch die belgische Landschaft. Lange Lastkähne kreuzen den Kanal und riesige, mit Containern hoch beladene Frachtschiffe ragen über die Docks. Das Tiefland ist nicht nur ein bevorzugtes Gebiet für die Schifffahrt, sondern aufgrund seines feuchten Bodens auch ein fruchtbarer Boden für die Konservierung von Gehirnen. Heute kam ein hoffnungsvoller „Sensenmann“, um sie zu ernten. Auf diesen Ebenen muss man nicht sehr tief graben, um menschliche Überreste zu finden. Hunderttausende Menschen starben hier im Ersten Weltkrieg, genau wie John McCrae es in seinem berühmten Gedicht „In Flanders Fields“ beschrieb: „Auf den Feldern Flanderns wiegen sich Mohnblumen im Wind und Kreuze stehen in ordentlichen Reihen.“ Nach einer kurzen Fahrt erreichte Morton-Hayward ein archäologisches Unternehmen namens BAAC. Die Archäologin Nandy Dolman brachte sie in ein großes Lagerhaus voller Überreste von Toten. Hohe Regale sind mit Pappkartons gefüllt, die Tausende von Skeletten enthalten, Überreste aus dem Mittelalter. © Graham Poulter Das Unternehmen gräbt seit 2020 Überreste vom Friedhof der berühmten St. Martinskirche aus. Um Platz für städtische Bauprojekte zu schaffen, wurden die Überreste von etwa 1.300 Menschen, von denen viele Hirngewebe enthielten, entfernt. Bei einem früheren Besuch hatte Morton-Hayward 55 Gehirnproben gesammelt und dieses Mal kam sie zurück, um die letzten 37 abzuholen, die in Plastiktüten mit der Aufschrift „Monster“ (was auf Niederländisch „Probe“ bedeutet) verpackt waren. In einem Konferenzraum im Obergeschoss beschrieb Dolman detailliert die Friedhöfe der Flamen, die in der von Pieter Bruegel dem Älteren und seinem Sohn beschriebenen Epoche gelebt haben. Sie glaubt, dass das gut erhaltene Hirngewebe Hunderte von Jahren alt ist und bis ins 12. Jahrhundert zurückreicht. Die Überreste wurden geolokalisiert, fotografiert und Daten aufgezeichnet, darunter Geschlecht, geschätztes Alter und ob der Schädel ein Gehirn enthielt. Dorman zeigte Fotos von Knochen, die deutliche Spuren blauer und roter Verfärbungen aufwiesen – ein Zeichen für das Vorhandensein von Eisen, das vermutlich ein Schlüsselfaktor für die Erhaltung des Gehirns ist. „Die Dokumentation und die Metadaten sind erstklassig“, sagte Morton-Hayward. Dann enthüllte Dolman eine Überraschung: Das neu entdeckte Hirngewebe umfasste das von 20 Kindern. Morton Hayward öffnete überrascht Mund und Augen. Bisher gehörte nur eine ihrer 600 konservierten Gehirngewebeproben einem Minderjährigen. Leiden diese Kinder ebenfalls unter extremem neurologischem Stress und einer beschleunigten Alterung des Gehirns? Wie während einer Hungersnot? Oder steckt da ein anderer Mechanismus dahinter? Wie zahllose Wissenschaftler festgestellt haben, bringt jeder Fortschritt neue Fragen mit sich. Quellen: [1]medcraveonline.com/JNSK/warum Cluster-Kopfschmerzen-werden-als-Suizid-Kopfschmerzen-bezeichnet.html [2]www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305440311000690 [3]www.sciencedirect.com/journal/journal-of-archaeological-science [4]royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2023.2606[5]royalsocietypublishing.org/journal/rspb Von Kermit Pattison Übersetzt von gross Korrekturlesen/tim Originalartikel/www.theguardian.com/science/2024/oct/22/ancient-brain-collector-alexandra-morton-hayward-heslington Dieser Artikel basiert auf der Creative Commons License (BY-NC) und wird von Gross auf Leviathan veröffentlicht. Der Artikel spiegelt nur die Ansichten des Autors wider und stellt nicht unbedingt die Position von Leviathan dar |
<<: „König des Metalls“ – Warum sind die meisten Metalle nach ihm benannt?
Artikel empfehlen
Ist es besser, morgens oder abends zu trainieren?
Viele Menschen möchten wissen, ob es besser ist, ...
Der Physikgigant, der die Molekulartheorie verteidigte, fiel am Vorabend der Morgendämmerung ...
Er wusste, dass er den intelligentesten Verstand ...
Was sind einige Yoga-Aufwärmübungen?
Yoga ist ein Sport, der nicht an Alter oder Gesch...
Die Seele der Frau verwandelte sich in einen Vogel? Obwohl der Name bitter und hasserfüllt ist, bin ich supersüß!
Am frühen Morgen oder Abend des Frühsommers kann ...
Was sind Übungen zur Bänderdehnung?
Das Dehnen der Bänder ist sehr wichtig und kann a...
Wenn Sie jeden Tag um ein oder zwei Uhr morgens ins Bett gehen, wie lange dauert es, bis Sie plötzlich sterben? Ich kann es nicht mehr ertragen, es anzusehen ...
Experte dieses Artikels: Zhao Wei, MD, stellvertr...
Wenn ein Wildschwein hinfällt, hilft ihm dann ein vorbeilaufendes Wildschwein?
Wildschweinen begegnet man nicht nur in den Berge...
Was kann Yangzhou außer dem Feuerwerk im März und der Huaiyang-Küche noch wirklich repräsentieren?
Erwähnen Sie Yangzhou Manche Menschen denken an f...
Wann ist die beste Zeit, um abends Sport zu treiben?
Jeden Tag auf ausreichend Bewegung zu bestehen, i...
Wann ist die beste Zeit zum Laufen zum Abnehmen?
Laufen ist eine Trainingsmethode zum Abnehmen. Re...
Neue Forschungsergebnisse lösen das Rätsel, wie Eidechsen abgebrochene Schwänze regenerieren! Kann menschlicher Knorpel in Zukunft repariert werden?
Eidechsen sind die einzigen Amnioten, die über di...
Gibt es Bären in der Wüste Gobi? Ja, aber nicht viel
Wenn man von der Wüste Gobi spricht, denken viele...
Die furchterregend aussehenden „Weltuntergangsfische“ kommen einer nach dem anderen an Land. Droht eine Katastrophe? Sei nicht albern ...
Eines Tages Anfang November ging Allison, eine Do...
Vor der Fahrt braucht es ein gutes Stück Gummi!
Dieser Artikel wurde zuerst von „Hunzhi“ (WeChat-...
ReviewPro: Globaler Hotelbewertungsbericht für das erste Quartal 2022
ReviewPro hat den Global Hotel Review Report für ...