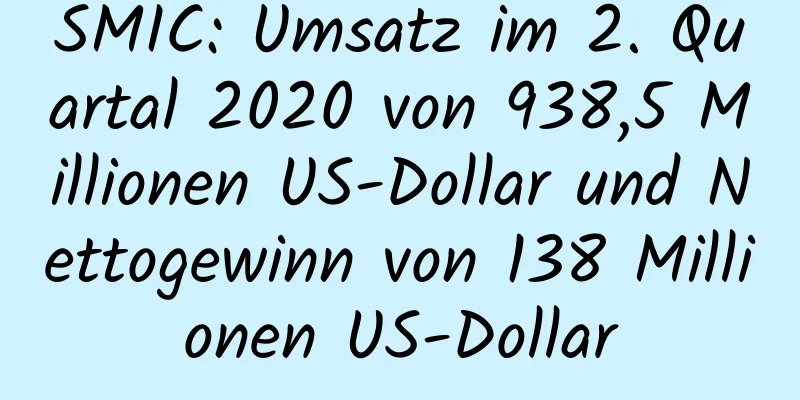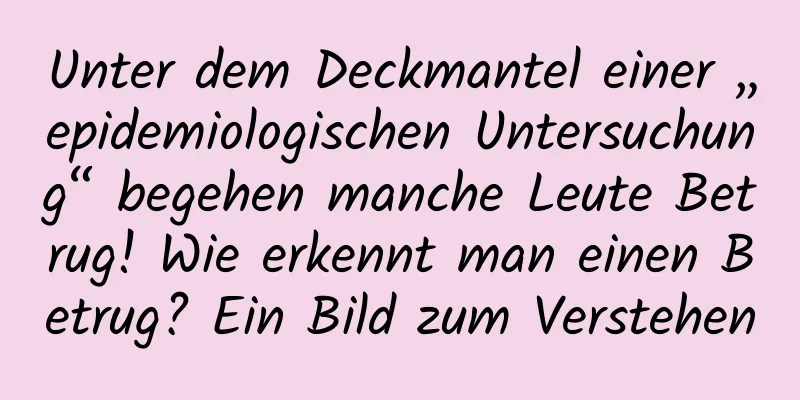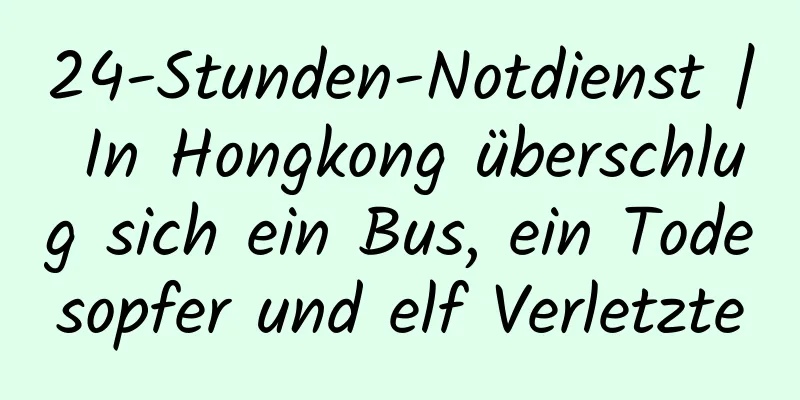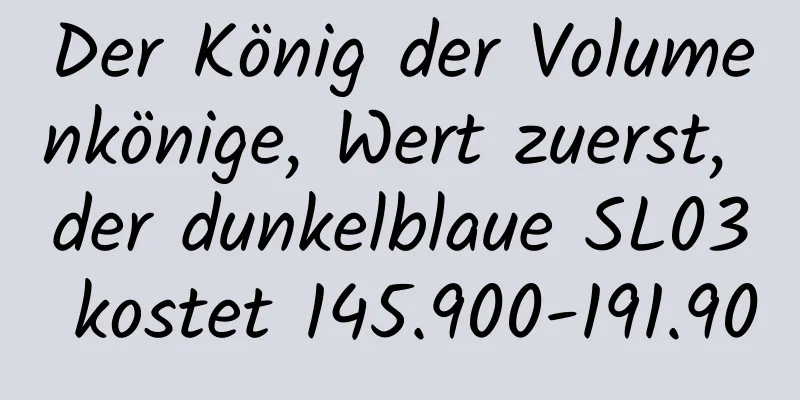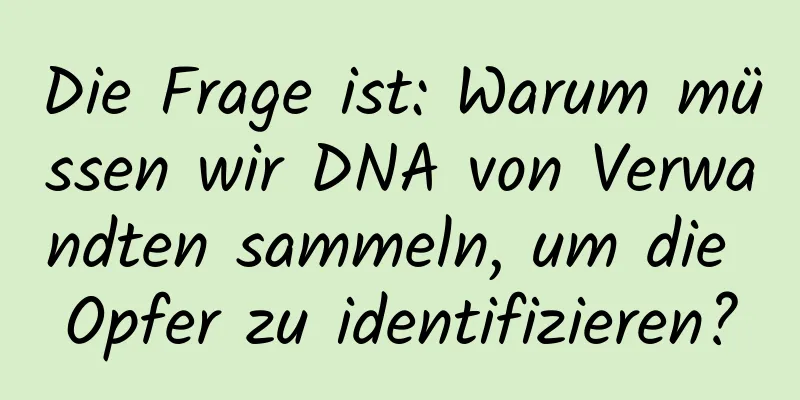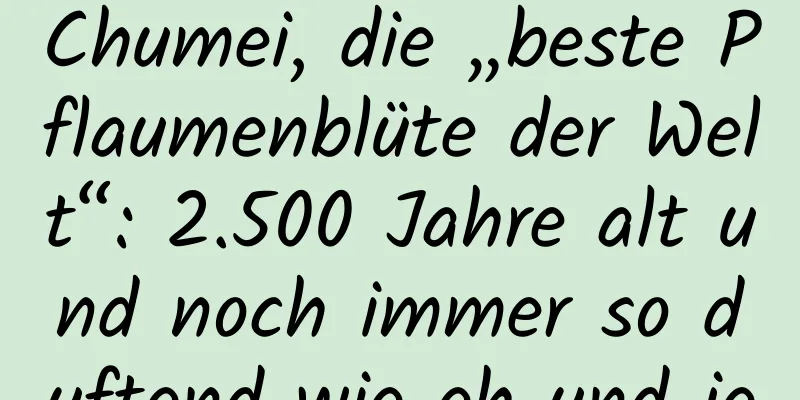Um Schnee zu machen, müssen Sie zuerst „Schnee pflanzen“. Wie können „Schneesamen“ „aus dem Nichts“ entstehen? Wie machen Schneekanonen das?
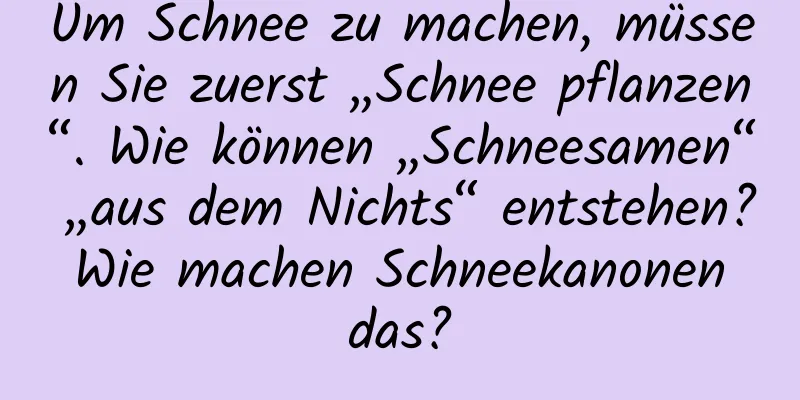
|
Bei den Olympischen Winterspielen wurde mit der künstlichen Beschneiung begonnen, wodurch mehr Menschen von Schneekanonen erfahren haben. Um Schnee zu erzeugen, müssen allerdings zunächst „Schneesamen“ gesät werden. Woher kommt der Begriff „Schneesamen“? Wie machen Schneekanonen Schnee? Schneesport (Fotoquelle: new.qq.com) Die „Vorlage“ für die künstliche Beschneiung Natürlicher Schneefall ist ein langsamer Prozess, dessen Grundlage winzige Eiskristalle sind, die durch Kondensation oder Sublimation von Wasserdampf an Kristallkeimen (Kondensationskeimen) entstehen. Der Kristallkern ist hier das, was wir oft als „Schneesamen“ bezeichnen. Es kann ein Staubkorn oder ein Pollenkorn sein ... Während kleine Eiskristalle in der Atmosphäre schweben, kondensieren mehr Wasserpartikel auf den Eiskristallen und bilden langsam Schneeflocken. Wenn das Wetter kalt genug ist, fallen die Schneeflocken mit zunehmendem Gewicht langsam auf die Erdoberfläche. Wenn die Bodentemperatur hoch ist, schmilzt der fallende Schnee natürlich. Was würde passieren, wenn es keinen Kristallkern gäbe? Kurz gesagt: Es können keine kleinen Eiskristalle gebildet werden, und ohne kleine Eiskristalle können keine Schneeflocken gebildet werden. Es stellt sich heraus, dass reine Wassertropfen am Gefrierpunkt nicht gefrieren und sich bei weiter sinkender Temperatur in einem unterkühlten Zustand befinden. Tatsächlich erfordert das Gefrieren (Keimbildung) von reinem Wasser eine niedrige Temperatur von etwa -40 °C. Dieser unterkühlte Zustand ist jedoch instabil. Sofern ein Kondensationskern wie etwa etwas Staub den Auslöser bildet, bilden Wassertropfen kleine Eiskristalle, ohne dass die Temperatur auf minus 40 °C sinkt. Entstehung von Naturschnee (Bildquelle: Referenz [2]) Das Prinzip der Schneeerzeugung mit Schneekanonen besteht darin, den Prozess der natürlichen Schneebildung zu simulieren. Die Frage ist, wie man „Schnee wachsen lässt“, ohne „Schneesamen“ zu verwenden? Es gibt keinen „Schneesamen“, den man selbst herstellen kann! Allerdings entsteht der „Schneesamen“ nicht aus dem Nichts, sondern durch das schnelle Gefrieren zerstäubter Wassertropfen. Die treibende Kraft hinter „Wasser wird zu Schnee“ Aus energetischer Sicht ist die treibende Kraft hinter der „Verwandlung von Wasser in Schnee“ „Kälte“! Damit Schneekanonen Schnee erzeugen können, ist für den Übergang von flüssigem Wasser zu Schneekristallen ein Phasenwechselprozess erforderlich. Um diesen Prozess abzuschließen, muss dem flüssigen Wasser eine gewisse Wärmemenge entzogen werden. Die hier erwähnte Wärme besteht aus zwei Teilen: fühlbare Wärme und latente Wärme. Beschneiungsanlage (Screenshot von CCTV News) Wir können den Wärmeaustauschprozess in zwei Prozesse vereinfachen. Die erste besteht darin, die Temperatur von flüssigem Wasser auf 0 °C zu senken. Für jede Absenkung der Temperatur eines Kilogramms flüssigen Wassers um 1 °C müssen 4,2 Kilojoule Wärme übertragen werden. Die zweite besteht darin, flüssiges Wasser mit 0 °C in Eiskristalle mit 0 °C umzuwandeln. Für jedes Kilogramm flüssiges Wasser müssen 336 Kilojoule latente Wärme übertragen werden. Angesichts der Unterkühlung der Wassertropfen und des Kälteverlusts muss natürlich tatsächlich mehr Wärme abgeführt werden. Die Frage ist, wer für die Übertragung dieser Wärme verantwortlich ist? Die beiden Hauptkräfte, die Wärme transportieren, sind die Ausdehnung der Druckluft durch Dekompression und Wärmeaufnahme sowie die Konvektion und Verdampfung des zerstäubten Wassers. Wie stellt eine Schneekanone „Schneesamen“ her? Der oben am Sprührohr der Schneekanone verteilte Nukleator (Keimbildner) ist das Kernstück zur schnellen Herstellung von Kristallkeimen. Schneekanonen sind in der Regel über Rohrleitungen mit Druckluft und Hochdruckwasser verbunden. Druckluft wird mit Hochdruckwasser gemischt und durch die Düse des Nukleators ausgesprüht. Die Druckluft zerstäubt das Wasser schnell in kleine Tröpfchen, kühlt es rasch ab und gefriert zu winzigen Kristallkeimen. Dabei handelt es sich um den Vorgang, bei dem Schneekanonen schnell „Schneesamen“ erzeugen und verteilen. Warum kann die augenblickliche Ausdehnung von Druckluft Kühlung erzeugen? Mitte des 19. Jahrhunderts entdeckten die berühmten Physiker Joule und Thomson, dass es bei der Passage eines bestimmten Gases durch ein Drosselventil zu einer plötzlichen Druckänderung kommt und die Temperatur der meisten Gase (außer Wasserstoff und Helium) sinkt. Dies ist der berühmte Joule-Thomson-Effekt. Nukleare Schneekanonen nutzen diesen Effekt zur Herstellung von „Schneesamen“. Dieser Effekt wird auch in vielen Bereichen wie der Gaskühlung und -verflüssigung häufig genutzt. Auch Klimaanlagen und Kühlschränke, die zu einem Teil unseres Lebens geworden sind, nutzen diesen Effekt in ihren Kühlkreisläufen. Neben der Düse für das Kerngerät oben am Sprührohr der Schneekanone befinden sich zahlreiche Schneedüsen, die Wasser mit hohem Druck versprühen. Nach der Zerstäubung durch die Düse wird das Hochdruckwasser ebenfalls in die Luft geschleudert. Durch die Verdunstung der Wassermoleküle auf der Oberfläche dieser kleinen Wassertröpfchen in der Luft wird viel Wärme abgeführt, wodurch die Wassertröpfchen selbst gekühlt werden. Durch die Verschmelzung dieser abgekühlten Wassertropfen und Kristallkeime bilden sich weitere kleine Eiskristalle. Das Gefrieren der Wassertropfen auf kleinen Eiskristallen und die Verbindung der Eiskristalle führt dazu, dass die Eiskristalle schnell wachsen und schließlich „Schneeflocken“ bilden, die zu Boden fallen. Für die Beschneiung ist nicht der „richtige Zeitpunkt“ erforderlich? Die Erzeugung von Schnee mit Schneekanonen fällt in die Kategorie der maschinellen Beschneiung und erfolgt grundsätzlich in einer künstlichen Umgebung. Ist für die künstliche Beschneiung „gutes Timing“ erforderlich? Tatsächlich simulieren Schneekanonen den Prozess der natürlichen Schneebildung nur teilweise. Man kann sagen, dass die Wachstumskurve der künstlichen Beschneiung im Freien, die beim Kristallisationskern beginnt, in der atmosphärischen Umgebung abgeschlossen ist. Daher ist bei der künstlichen Beschneiung auch die Mitwirkung der „Wetterbedingungen“ erforderlich. Es wird allgemein angenommen, dass für die künstliche Beschneiung „kalte und trockene“ Wetterbedingungen erforderlich sind. Mit „Kälte“ ist hier die niedrige Lufttemperatur gemeint, die die Qualität und Leistung der Beschneiung verbessern kann. Die „Trockenheit“ bezieht sich hier auf die niedrige relative Luftfeuchtigkeit der atmosphärischen Umgebung, die die Verdunstung von Wasser auf der Oberfläche von Wassertropfen in der Mikroumgebung der Schneeerzeugung begünstigt und somit den Kühleffekt deutlicher macht. Stellen Sie sich vor: Wenn die relative Luftfeuchtigkeit 100 % erreicht, bedeutet das, dass sie keinen Wasserdampf mehr aufnehmen kann. Daher kann das Wasser auf der Oberfläche der Wassertropfen in der Mikroumgebung der Beschneiung nicht mehr verdunsten. Sofern die Lufttemperatur nicht extrem niedrig ist, können die Wassertropfen nicht weiter abkühlen, was das Wachstum der Schneekristalle beeinträchtigt. Feuchtkugelthermometer (Bildquelle: [5]) In der Praxis der künstlichen Beschneiung ist die „Feuchtkugeltemperatur“ ein wichtiger Richtwert. Wenn Sie die Feuchtkugeltemperatur messen, können Sie den Temperaturfühler eines gewöhnlichen Thermometers mit feuchter Gaze umwickeln und das untere Ende der Gaze in einen mit Wasser gefüllten Behälter tauchen. Dadurch wird es zu einem Feuchtkugelthermometer. Stellen Sie es an einen belüfteten Ort. Der Messwert des Thermometers entspricht der Feuchtkugeltemperatur. Auf dieser Grundlage können wir das passende Zeitfenster für die künstliche Beschneiung auswählen und so die Effizienz und Qualität der Beschneiung verbessern. Ist Naturschnee besser als Kunstschnee? Vom Wasserdampf in der Atmosphäre bis zur Bildung von Eiskristallen und dann zum Wachstum von Eiskristallen und der Bildung von Schneeflocken ... die Wachstumskurve von natürlichem Schnee zeichnet tatsächlich viele Informationen über atmosphärische Umweltfaktoren auf. Natürliche Schneeflocken bestehen meist aus sechseckigen Eiskristallen in Form von Ästen und Blättern. Sie sind leicht und weich und schmelzen leicht, wenn sie zu Boden fallen. Die Form von Schneekristallen ändert sich mit der Temperatur und Übersättigung (siehe Wasserzeichen für die Bildquelle) Obwohl Kunstschnee den Entstehungsprozess von natürlichem Schnee nachahmt, ist sein Lebenszyklus durch den Einsatz physikalischer Mittel erheblich verkürzt, da Wassertropfen augenblicklich gefrieren und schnell wachsen. Obwohl Kunstschnee im Wesentlichen dem Naturschnee entspricht, ist seine Form grundsätzlich kugelförmig und es gibt keine astartigen sechseckigen Eiskristalle. Der Unterschied zwischen Naturschnee und Kunstschnee unter dem Mikroskop (Bildquelle: https://newtoski.com/snowmachine-vs-natural-snow/) Allerdings lässt sich bei einer hergestellten Skipiste in der Regel nicht erkennen, ob es sich um Kunstschnee oder Naturschnee handelt. Was ist besser, Kunstschnee oder Naturschnee? Wenn er zum Skifahren verwendet wird, ist Kunstschnee besser als Naturschnee. Kunstschnee ist widerstandsfähiger gegen Sonnenlicht als Naturschnee. Natürlicher Schnee schmilzt aufgrund seines hohen Wassergehalts leicht und verträgt daher keine direkte Sonneneinstrahlung. Während Kunstschnee im Allgemeinen einen geringeren Wassergehalt aufweist und daher die Sonne nicht fürchtet. Unter gleichen Temperaturbedingungen ist Kunstschnee mit guter Schneequalität 5-6 mal widerstandsfähiger gegen Schmelzen als Naturschnee. Der Kunstschnee ist klein und sieht pulverförmig aus. Da seine kugelförmige Struktur kompakter und dichter ist, ist seine Dichte größer als bei natürlichem Schnee. Die Dichte von Naturschnee beträgt im Allgemeinen etwa 328 kg/Kubikmeter, während die Dichte von Kunstschnee bis zu 856 kg/Kubikmeter beträgt. Kunstschnee lässt sich leichter verdichten und die Schneeoberfläche ist nach der Verdichtung härter und weist weniger Reibung auf. Da Kunstschnee bei Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen nicht so leicht schmilzt, kann das Aufsprühen einer kleinen Menge Wasser auf die Schneeoberfläche diese wieder weiß wie neu machen. Da natürlicher Schnee leicht schmilzt, kann er seine ursprüngliche weiße Farbe nur schwer behalten. Das Projekt „Science and Technology Winter Olympics“ hat klare Anforderungen an die Forschung und Entwicklung sowie die Anwendungsdemonstration von Beschneiungsanlagen gestellt. Beschneiungsanlagen und deren Düsen sowie Kernkraftwerke sollen das Ziel erfüllen, bei einer Temperatur von 0 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 50 % unter unterschiedlichen geografischen und klimatischen Bedingungen eine normale Schneeproduktion zu erreichen und die Schneequalität muss den Standards des Internationalen Skiverbandes entsprechen. Verweise [1] Li Jing. Einfluss meteorologischer Bedingungen auf Kunstschneeaktivitäten. Fortschritte in der meteorologischen Wissenschaft und Technologie, 7(1)-2017. [2] Encyclopædia Britannica, Inc., übersetzt von Chen Yiquan. Wetter und Klima (Britannic Illustrated Science Series), China Agriculture Press, März 2013. [3] Yang Lixiang. Forschung und Analyse von Beschneiungsmaschinen, Entwicklung und Innovation mechanischer und elektrischer Produkte, Bd. 23, Nr. 3 (Mai 2010). [4] https://nsidc.org/cryosphere/snow/science/formation.html [5]https://www.snowathome.com/pdf/wet_bulb_chart_celsius.pdf |
<<: Shi Jun | Erstaunliche chinesische Pflanzen
Artikel empfehlen
Die COVID-19-Situation ist ernst. Wie können wir uns und unsere Familien schützen?
In jüngster Zeit ist die Zahl der Neuinfektionen ...
Sehen Sie sich Chinas Rechenleistung im Handumdrehen an! Der Name dieses Computers stammt aus „Neun Kapiteln über die mathematische Kunst“.
Wenn eine Nation auf der Grundlage von Wissenscha...
Wie ist die „Hehe“-Antwort des PR-Direktors von Tencent zu verstehen, als Internetnutzer sagten, WeChat habe MiTalk plagiiert?
In letzter Zeit tauchte der PR-Direktor von Tence...
Schock! Ein Ungleichgewicht der Darmflora eines zweijährigen Mädchens führte dazu, dass sie sich selbst verletzte, und der Grund dafür ist schockierend!
Kürzlich litt ein zweijähriges Mädchen namens Xia...
Kann sich HTC noch von seinen Tiefpunkten erholen?
Die nachlassende Leistung von HTC in den letzten ...
Subversion! Es stellt sich heraus, dass Katzen nicht nur gähnen, weil sie müde sind! Oder vielleicht...
Jetzt Immer mehr Freunde Gehört zu den Katzenbesi...
Wie hat „Sheep of Sheep“ Sie „süchtig“ gemacht?
In letzter Zeit ist im Internet ein Stapel-Aussch...
Sind Brustschmerzen ein Herzinfarkt? Ärzte erinnern: Diese Krankheiten verursachen Brustschmerzen
Dieser Artikel wurde von Li Jiehui, stellvertrete...
Gilt das Laufband als aerobes Training?
Laufen ist eigentlich ein sehr guter Sport, aber ...
Bauchmuskel schnelle Methode, diese müssen getan werden
Ein Mann wirkt männlicher und attraktiver, wenn e...
Die neuesten weltweiten Daten zum Handy-Ausverkauf: Android hat die Nase vorn
Der jüngste Bericht des Marktforschungsunternehme...
Wie lange nach einer normalen Geburt kann ich mit dem Laufen beginnen?
Menschen, die regelmäßig Sport treiben, sollten g...
Kann ich während meiner Periode Yoga machen?
Yoga ist zu einem sehr modischen Sport geworden. ...
Die Klimaanlagenindustrie ist in die Ära des Oligopols eingetreten, und eine intelligente differenzierte Entwicklung ist der Schlüssel
Angesichts des immer härteren Wettbewerbs auf dem...
Erinnern Sie sich noch an diese Momente im Jahr 2021?
Rückblick auf 2021 Wir sind berührt und stolz Es ...