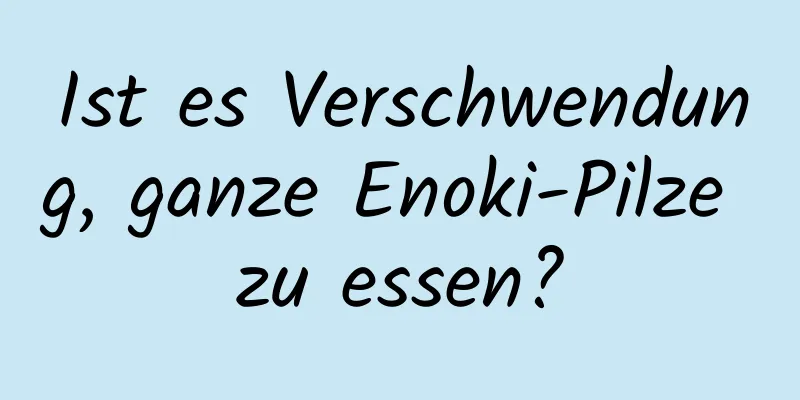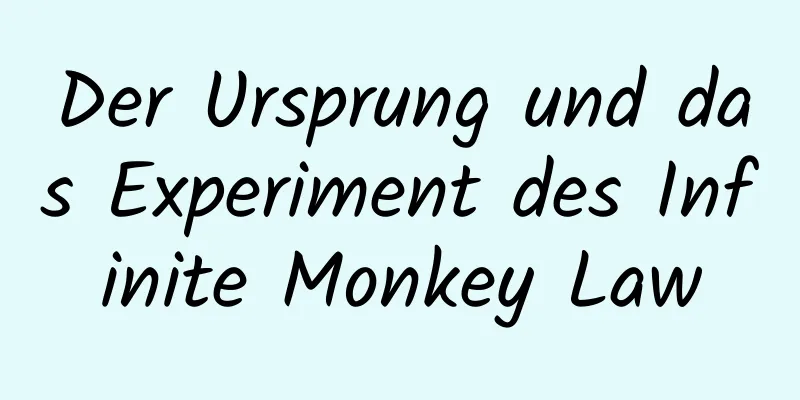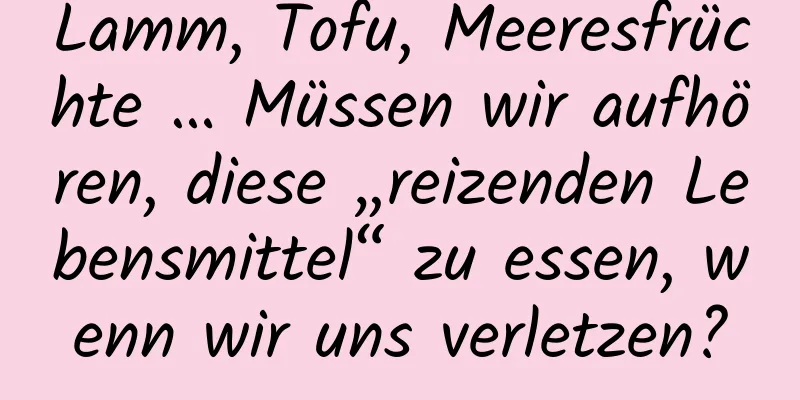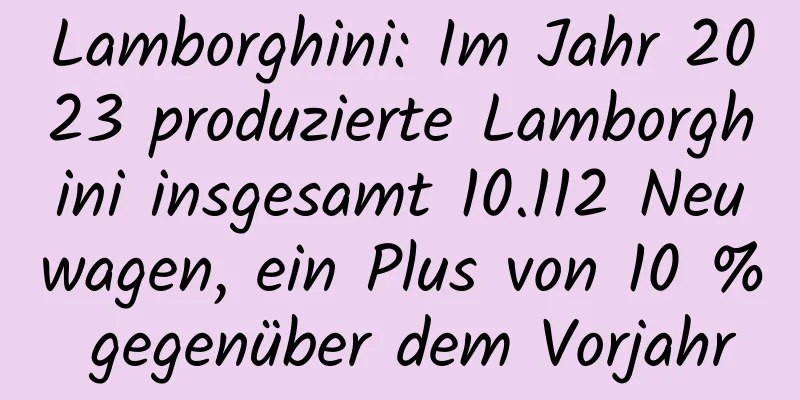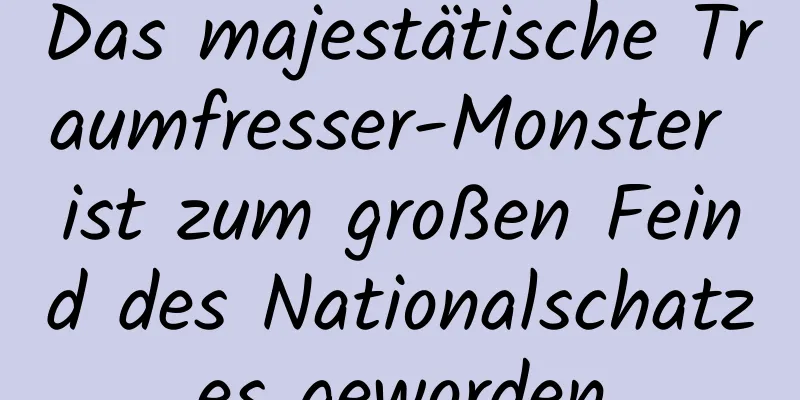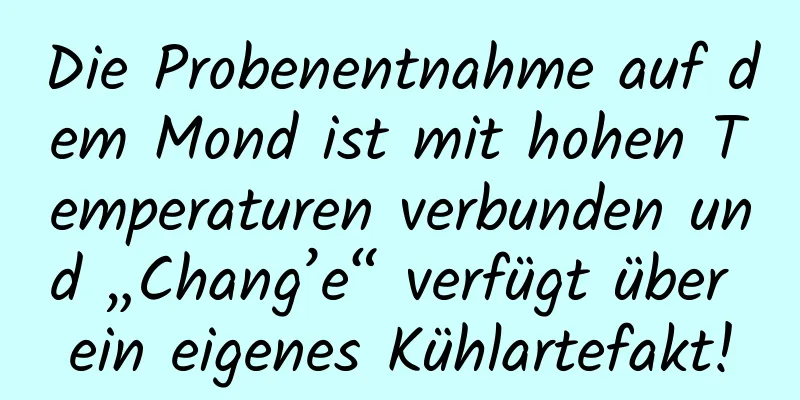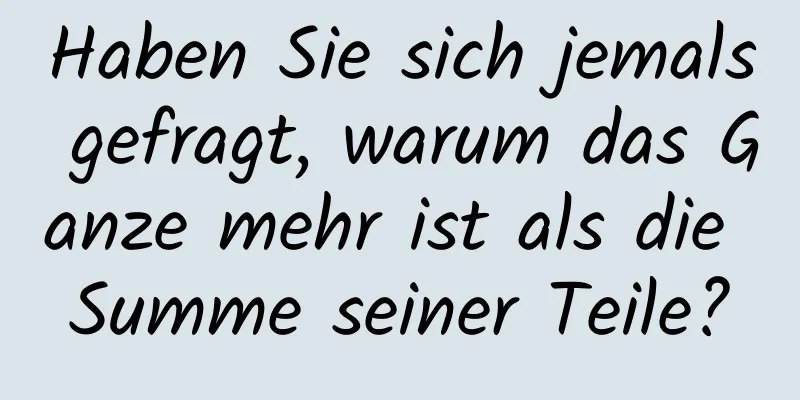Künstliche Intelligenz im Glas
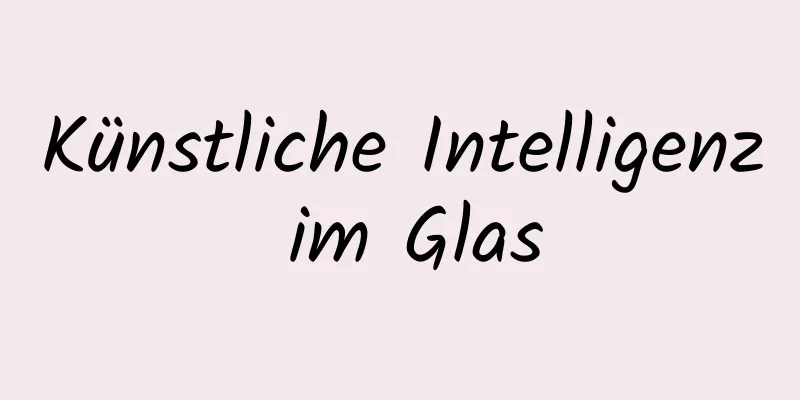
|
Von Rich Heimann „Gehirn im Glas“ ist ein Gedankenexperiment, bei dem es um ein menschliches Gehirn geht, das körperlos ist und in einem Glas mit Lebensmitteln lebt. Dieses Gedankenexperiment untersucht menschliche Konzepte von Realität, Geist und Bewusstsein. In diesem Artikel wird ein metaphysisches Argument gegen künstliche Intelligenz (KI) untersucht, das auf der Annahme beruht, dass eine körperlose KI oder ein „Gehirn“ ohne Körper mit der Natur der Intelligenz unvereinbar sei. Das „Gehirn im Glas“ ist eine Fragestellung, die sich von den traditionellen Fragen der künstlichen Intelligenz unterscheidet. Die Frage, die berücksichtigt werden muss, ist, ob das Denken (dieser Prozess) einen Denker erfordert. Die Möglichkeit künstlicher Intelligenz hängt entscheidend davon ab, was erforderlich ist, um einen Computer (oder ein Computerprogramm) intelligent zu machen. Aus dieser Perspektive ist (echte) künstliche Intelligenz erreichbar, wenn wir Intelligenz verstehen und herausfinden, wie wir sie in Computer programmieren können. René Descartes, dem französischen Philosophen des 17. Jahrhunderts, wurde oft vorgeworfen, er habe ein „Gehirn in einem Glas“. Der Materialismus geht davon aus, dass die Welt und alles darin aus Materie besteht, doch Descartes war damals ein Gegner des Materialismus. Er trennte Geist und Körper und erforschte immaterielle Dinge wie Bewusstsein, Seele und sogar Gott. Diese Philosophie des Geistes ist der Geist-Körper-Dualismus. Abbildung | Der französische Philosoph René Descartes Der Dualismus geht davon aus, dass Körper und Geist nicht identisch sind, sondern getrennte und gegensätzliche Aspekte darstellen, die aus verschiedenen, miteinander interagierenden Substanzen bestehen. Descartes‘ Methodologie ist fragwürdig. Er zweifelt an allem, sogar an seinem eigenen Körper, um seine eigenen Gedanken zu untermauern. Er versucht, die „unzweifelhaften“ Dinge zu finden, an denen er am wenigsten zweifeln würde. Das Ergebnis ist eine erschöpfende erkenntnistheoretische Suche nach dem Verständnis dessen, was wir wissen können und was existiert, indem wir die Metaphysik manipulieren. Dieses solipsistische Denken ist unbegründet, doch im 17. Jahrhundert hätte man es nicht als Persönlichkeitsstörung angesehen. Wir haben Grund, mit Descartes zu sympathisieren. Das Nachdenken über das Denken hat Denker seit der Aufklärung verwirrt und seltsame Philosophien, Theorien, Paradoxe und Aberglauben hervorgebracht. In vielerlei Hinsicht ist der Dualismus keine Ausnahme. Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde der Dualismus ernsthaft in Frage gestellt. Der Behaviorismus ist die Ansicht, dass mentale Zustände auf physische Zustände reduziert werden können, die Verhaltensweisen sind. Das Problem des Behaviorismus besteht – abgesehen vom Reduktionismus, der sich aus der Betrachtung des Menschen als Verhalten ergibt – darin, dass er psychologische Phänomene ignoriert und die Gehirnaktivität so interpretiert, als würde sie eine Reihe von Verhaltensweisen hervorbringen, die nur beobachtet werden können. Konzepte wie Gedanken, Intelligenz, Emotionen, Überzeugungen, Wünsche und sogar Genetik werden durch Umweltreize und Verhaltensreaktionen ersetzt. Daher können wir den Behaviorismus niemals zur Erklärung psychologischer Phänomene heranziehen, da sein Schwerpunkt auf äußerlich beobachtbarem Verhalten liegt. Philosophen machen gerne Witze darüber, wie zwei Behavioristen nach dem Sex reagieren: „Gut für dich, wie wäre es für mich?“ sagt einer zum anderen. Durch die Konzentration auf beobachtbares physisches Verhalten statt auf dessen Ursprünge im Gehirn wurde der Behaviorismus für die Quellen intellektuellen Wissens irrelevant. Aus diesem Grund können Behavioristen Intelligenz nicht definieren. Sie denken, es ist nichts. Nehmen Sie als Beispiel den Turing-Test von Alan Turing. Turing vermied die Definition von Intelligenz und sagte, Intelligenz sei das, was Intelligenz tut. Wenn ein Glas ein anderes Glas durch scheinbar intelligente Antworten glauben machen kann, dass es sich intelligent verhält, dann hat dieses Glas den Turing-Test bestanden. Turing war ein Behaviorist. Abbildung | Informatiker Alan Turing Der Behaviorismus hatte bei der Erklärung von Intelligenz weniger Einfluss als je zuvor. In den 1950er Jahren war der Behaviorismus bei den meisten Menschen nicht mehr beliebt. Der bedeutendste Angriff erfolgte 1959 durch den amerikanischen Linguisten Noam Chomsky. Chomsky übte scharfe Kritik an B. F. Skinners Buch „Verbal Behavior“. Chomskys Rezension von Skinners „Verbal Behavior“ ist sein am häufigsten zitiertes Werk und trotz des unscheinbaren Titels bekannter als Skinners Originalbuch. Chomsky leitete die Neuausrichtung der Psychologie auf das Gehirn ein, die als kognitive Revolution bekannt ist und zur modernen Kognitionswissenschaft führte. Infolgedessen wurde der Funktionalismus zur neuen vorherrschenden ideologischen Theorie. Der Funktionalismus betrachtet Intelligenz (d. h. psychologische Phänomene) als die funktionale Organisation des Gehirns, in der individualisierte Funktionen (wie Sprache und Sehen) im Hinblick auf ihre kausalen Rollen verstanden werden. Im Gegensatz zum Behaviorismus konzentriert sich der Funktionalismus darauf, was das Gehirn tut und wo Gehirnfunktionen stattfinden. Allerdings interessiert den Funktionalismus nicht, wie etwas funktioniert oder ob es aus dem gleichen Material besteht. Dabei ist es egal, ob das denkende Ding ein Gehirn ist oder ob das Gehirn einen Körper hat. Wenn die Funktion intelligent wäre, wäre das so, als würde man alles, was die Zeit anzeigt, als Uhr klassifizieren. Dabei spielt es keine Rolle, woraus eine Uhr besteht, solange sie die Zeit anzeigt. Abbildung: Amerikanischer Psychologe B.F. Skinner Die amerikanische Philosophin und Informatikerin Hilary Putnam kombinierte in „Psychological Predicates“ Funktionalismus mit rechnerischen Konzepten und schlug den rechnerischen Funktionalismus vor. Kurz gesagt geht der Computationalismus davon aus, dass die mentale Welt auf einem physischen System (d. h. einem Computer) basiert, das Konzepte wie Information, Berechnung (Denken), Gedächtnis (Speicherung) und Feedback verwendet. Heutzutage stützt sich die Forschung im Bereich der künstlichen Intelligenz stark auf den rechnergestützten Funktionalismus, bei dem Intelligenz in Fähigkeiten wie Computersehen und Verarbeitung natürlicher Sprache gegliedert und in rechnergestützten Begriffen erklärt wird. Leider spiegeln (diese) Funktionen nicht das Denken wider, sondern nur Aspekte des Denkens. Abgesehen vom Reduktionismus, der sich aus der Betrachtung des Geistes als einer Ansammlung von Funktionen (und des Menschen als Gehirn) ergibt, besteht das Problem des Funktionalismus darin, dass er das Denken ignoriert. Während das Gehirn über lokale Funktionen verfügt, die als Eingabe-Ausgabe-Paare physikalischer Systeme innerhalb eines Computers dargestellt werden können (wie etwa die Wahrnehmung), ist der Geist keine lose Ansammlung lokaler Funktionen. John Searle ist ein Philosoph und ehemaliger Professor der UC Berkeley, dessen Gedankenexperiment „Chinesisches Zimmer“ einen der stärksten Angriffe auf den Computerfunktionalismus darstellt. Seiner Ansicht nach ist es unmöglich, einen intelligenten Computer zu bauen, da Intelligenz ein biologisches Phänomen ist, das einen bewussten Denker voraussetzt. Dieses Argument ist das Gegenteil des Funktionalismus. Der Funktionalismus geht davon aus, dass Intelligenz erreichbar ist, wenn sich die kausale Interaktion zwischen bestimmten mentalen Zuständen und Rechenprozessen durch irgendetwas nachahmen lässt. Bild: Amerikanischer Philosoph John Searle Ironischerweise hätte Descartes in „Gehirn im Glas“ künstliche Intelligenz überhaupt nicht in Betracht gezogen. Descartes war mit Verkaufsautomaten und mechanischem Spielzeug des 17. Jahrhunderts vertraut. Das „Ich“ in Descartes‘ Diktum „Ich denke, also bin ich“ begreift das menschliche Denken jedoch als nicht-mechanisch und nicht-rechnerisch. Das „Ich denke“-Argument impliziert, dass es ein denkendes Subjekt geben muss, damit Denken stattfinden kann. Während der Dualismus die Existenz eines Gehirns in einem Glas durch Ausschluss des Körpers zuzulassen scheint, widerspricht er auch der Behauptung, dass KI denken kann, da jedem Denken ein denkendes Subjekt fehlt und jeder Intelligenz ein intelligentes Subjekt fehlt. Hubert Dreyfus erklärt, wie die künstliche Intelligenz die „Zitronen“-Philosophie geerbt hat. Dreyfus, Professor für Philosophie an der University of California in Berkeley, war stark von der Phänomenologie, der Philosophie der bewussten Erfahrung, beeinflusst. Ironischerweise, erklärt Dreyfus, haben Philosophen viele der philosophischen Rahmenkonzepte abgelehnt, die in den Anfängen der KI verwendet wurden, darunter Behaviorismus, Funktionalismus und Repräsentationalismus, die alle die Verkörperung ignorieren. Diese Rahmenbedingungen sind widersprüchlich und unvereinbar mit biologischen Gehirnen und natürlicher Intelligenz. Abbildung: Amerikanischer Philosoph Hubert Dreyfus Künstliche Intelligenz wurde zweifellos in einem philosophisch seltsamen Moment geboren. Dies beeinträchtigte das Verständnis der Menschen für Intelligenz und ihre Bedeutung damals erheblich. Natürlich zeigen die Erfolge des Fachgebiets in den letzten 70 Jahren auch, dass die Disziplin nicht zum Scheitern verurteilt ist. Der Grund dafür liegt darin, dass die Philosophie des Pragmatismus von Praktikern im Bereich der künstlichen Intelligenz am häufigsten vertreten wird. Pragmatismus ist keine Philosophie des Geistes, sondern vielmehr eine Philosophie, die sich auf praktische Lösungen für Probleme wie Computer Vision und natürliche Sprachverarbeitung konzentriert. Dieses Feld findet Abkürzungen zur Lösung einiger Probleme, die wir fälschlicherweise als Intelligenz interpretieren, hauptsächlich aufgrund unserer Tendenz, menschliche Eigenschaften auf unbelebte Objekte zu projizieren. Die Unfähigkeit der KI, das Intelligenzproblem zu verstehen und letztlich zu lösen, legt nahe, dass für das hypothetische Schicksal der KI möglicherweise Metaphysik notwendig ist. Der Pragmatismus legt jedoch nahe, dass Metaphysik zur Lösung realer Probleme nicht erforderlich ist. Dieses seltsame Problem legt nahe, dass echte KI nur dann real sein kann, wenn „das Gehirn im Glas auch Beine hat“, was für einige KI-Repositories auf GitHub und für alle KI-Unternehmen das Ende bedeutet. Denn jenseits der metaphysischen Natur des Problems stehen wir vor einer tiefgreifenden und möglicherweise unbeantwortbaren ethischen Frage: Wie können wir es vermeiden zu sagen, dass wir unseren Computern ein Netzkabel und eine Maus gegeben haben, weil intelligente Wesen oder Tierversuche Arme und Beine benötigen? Über den Autor Rich Heimann ist Chief AI Officer bei Cybraics und Autor von „Doing AI“, einem Buch, das untersucht, was KI ist, was sie nicht ist, was die Menschen von KI erwarten, welche Lösungen Sie benötigen und wie Sie Probleme lösen. Originallink: https://bdtechtalks.com/2022/04/08/ai-brain-in-jar/ Akademische Schlagzeilen |
>>: Weltquantentag | Warum ist es für Wissenschaftler so schwer zu fassen? Das Geheimnis der Quanten
Artikel empfehlen
Ist das Bauchmuskel-Trainingsrad effektiv?
Um eine gute Figur zu bekommen und Bauchfett zu v...
Welche Methoden gibt es, um Basketballverletzungen vorzubeugen?
Basketball ist ein Sport, den viele Freunde mögen...
Car Talks: Brain-Computer-Interface-Technologie verändert die Art und Weise, wie wir in Zukunft reisen
Im Science-Fiction-Klassiker „Matrix“ sind die Ge...
Schauen Sie sich diese Fälle an. Auch autonomes Fahren ist nicht einfach.
In letzter Zeit machte Teslas autonome Fahrfunkti...
Was ist vor dem Laufen zu tun?
Jeden Abend packen viele Leute ihre Sachen und be...
Kommt durch die Zugabe von Propylenglykol wieder giftige Milch?
Kürzlich gab das Marktaufsichtsamt des Kreises Qi...
Welche Methoden des Muskeltrainings gibt es?
Es gibt viele Möglichkeiten, Muskeln zu trainiere...
So können Sie Ihre Brüste effektiv durch Training vergrößern
Viele Freundinnen sind sehr stolz auf ihr Paar sc...
Wie sieht ein pandafreundliches Familienessen aus?
Die Shenzhen One Planet Nature Foundation ist ein...
Die Sonne niest, und das Raumschiff gerät ins Kreuzfeuer
Die zunehmende Häufigkeit menschlicher Weltraumak...
Wie führt man aerobe Schlankheits- und Bodybuildingübungen durch? Worauf muss ich achten?
Jeder möchte eine gute Figur haben. Um eine schön...
Wenn Sie während der Herbst-Tagundnachtgleiche nicht auf sich selbst aufpassen, wird die ganze harte Arbeit des Jahres umsonst gewesen sein! Nehmen Sie diesen Gesundheitsratgeber
Es ist Zeit, Ihre Herbstunterhosen zu finden! Zur...
Die EUV-Technologie ist noch unausgereift, Intel und Samsung stoßen bei 7 nm auf Hindernisse
Obwohl der Prozessfanatiker TSMC immer wieder von ...
Schmerzen zu haben und glücklich zu sein, ist eigentlich eine Art von Vergnügen
Beim Yin Yoga geht es, wie der Name schon sagt, d...