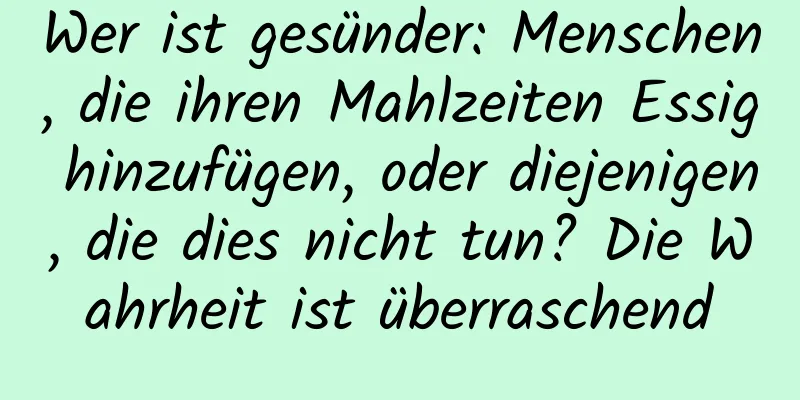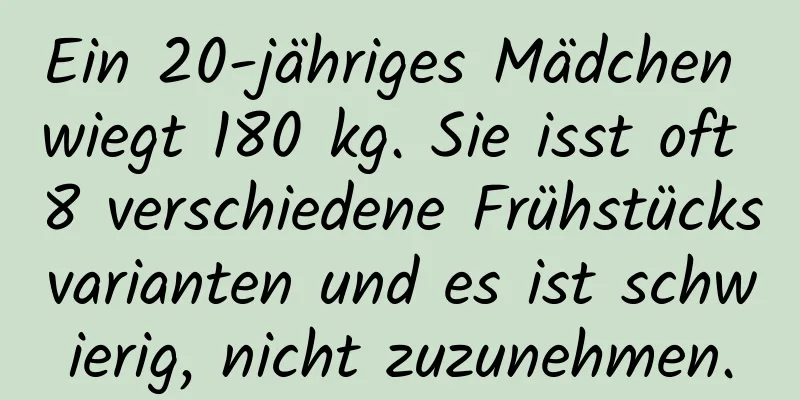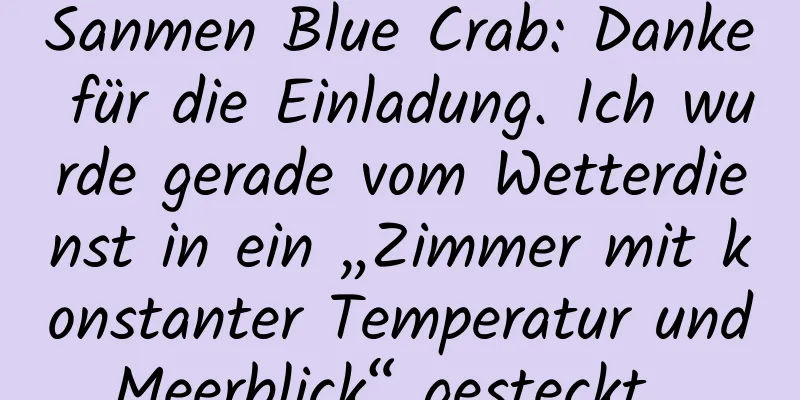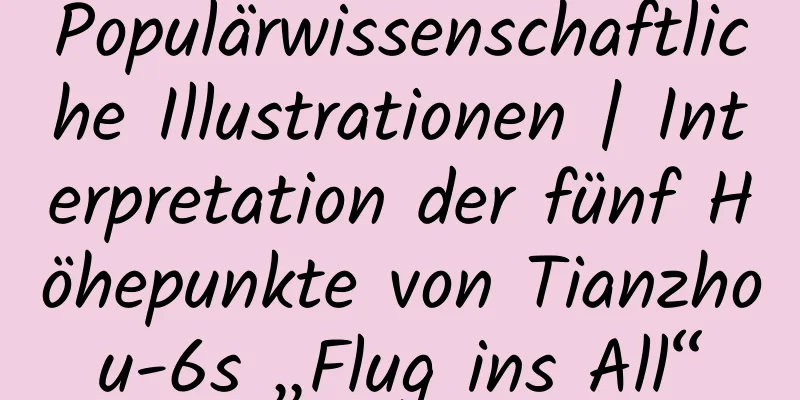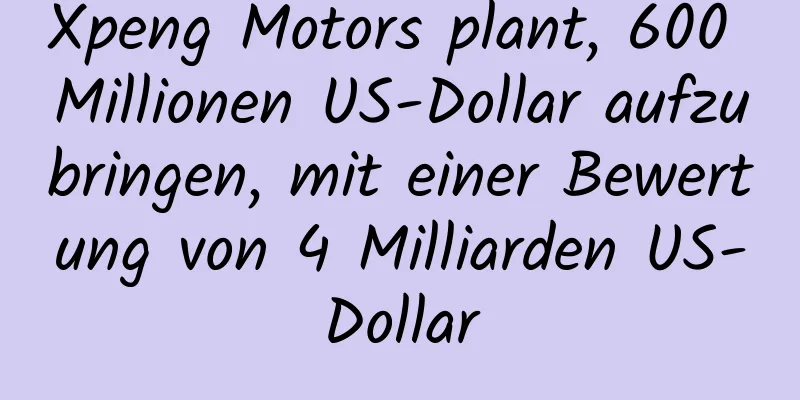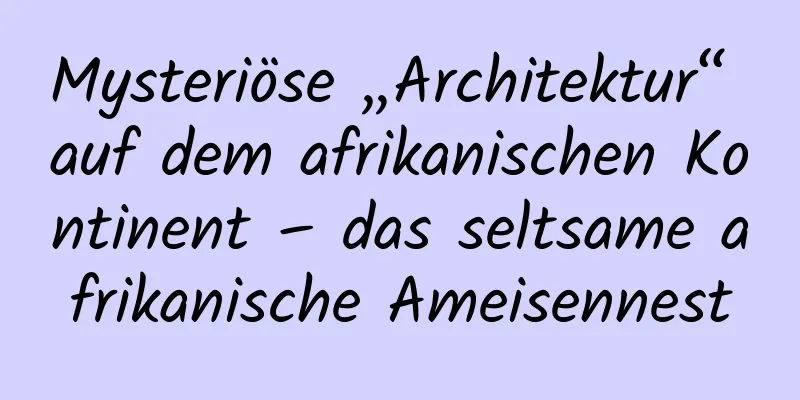Am nächsten bin ich dem Mond noch nie durch ein Teleskop gekommen.
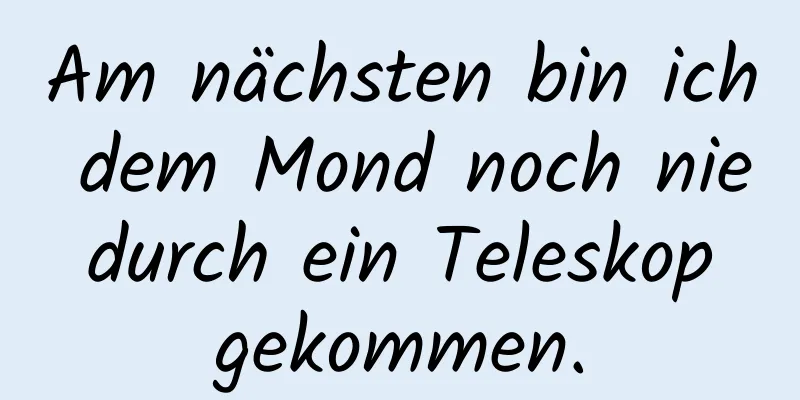
|
Im Frühling erwacht alles wieder zum Leben und die Erde ist mit Grün bedeckt; im Sommer kann man im grünen Teich immer Lotusblumen sehen, die zart auf dem Wasser stehen und die wunderschöne Szene erzeugen: „Die Lotusblätter sind endlos grün und die Lotusblumen leuchten rot in der Sonne“; im Herbst ist das Wetter klar und kühl und goldene Weizenwellen wiegen sich auf den Feldern; im Winter ist alles mit Silber bedeckt. Die Natur zeigt den Menschen zu verschiedenen Jahreszeiten auf einzigartige Weise ihre Schönheit. 1. Wie sehen Menschen Objekte? Wir können diese farbenfrohe Welt dank des Sehorgans des menschlichen Körpers sehen – den Augen. Um zu verstehen, wie das menschliche Auge Bilder erzeugt, müssen wir zunächst den Aufbau des menschlichen Auges kennen. Von außen betrachtet bestehen unsere Augen aus zwei Teilen: dem Weiß des Auges und dem Augapfel. Der äußerste Teil des schwarzen Augapfels ist eine dünne, durchsichtige Hornhaut. In der Hornhaut befindet sich eine durchsichtige Flüssigkeit, die als Kammerwasser bezeichnet wird. Hinter dem Kammerwasser befindet sich eine elastische, in ihrer Krümmung anpassbare Linse. Hinter der Linse befindet sich ein transparentes Gelee, der sogenannte Glaskörper. Sie sind alle lichtdurchlässig. Sie sind in drei Membranschichten eingewickelt. Die innerste Schicht wird Netzhaut genannt und enthält viele Fotorezeptorzellen, die Lichtreize wahrnehmen können. Die mittlere Schicht wird Aderhaut genannt und enthält viele Pigmente. Seine Funktion besteht darin, das Innere des Auges dunkel zu halten (wie die Dunkelkammer einer Kamera), um zu verhindern, dass anderes Licht eindringt und die Sicht beeinträchtigt. Die äußerste Schicht wird Sklera genannt und ist das, was wir als das Weiße des Auges wahrnehmen. Es enthält viele Blutgefäße und Nerven und spielt eine Rolle beim Schutz und der Erhaltung der Form des Augapfels[1]. Wenn das Licht eines Objekts durch die Hornhaut, das Kammerwasser, die Linse und den Glaskörper fällt, wird es gebrochen und auf der Netzhaut fokussiert, wodurch ein umgekehrtes Bild entsteht. Die Photorezeptorzellen auf der Netzhaut werden durch das Licht stimuliert und erzeugen Impulse, die über den Sehnerv an das Gehirn weitergeleitet werden und so das Sehvermögen erzeugen, das wir üblicherweise als „Sehen“ bezeichnen. Abbildung 1 Anatomie des Augapfels Das vom Augapfel erzeugte Bild ist ein umgekehrtes Bild, das unter der Kontrolle unseres Gehirns schließlich zu einem aufrechten Bild wird. Abbildung 2 Bildgebung des menschlichen Auges Das menschliche Auge kann Objekte sehen. Theoretisch kann das menschliche Auge Objekte von 0 bis unendlich sehen, indem es die Krümmung der Linse durch Muskeln anpasst. Die Fähigkeit des menschlichen Auges, Objekte zu unterscheiden, wird jedoch anhand des Betrachtungswinkels und der Helligkeit gemessen. Mit anderen Worten: Das Licht des Objekts muss das menschliche Auge in einem bestimmten Winkel erreichen, damit das menschliche Auge es sehen kann. gleichzeitig muss es auch eine gewisse Helligkeit aufweisen, damit es vom menschlichen Auge wahrgenommen werden kann. Zusammenfassend lässt sich sagen: Je größer und heller ein Objekt ist, desto weiter kann es gesehen werden. Umgekehrt gilt: Je geringer die Helligkeit und Größe eines Objekts, desto näher kann es gesehen werden. Der Winkel desselben Objekts zum Auge nimmt mit zunehmender Entfernung vom Auge ab. Im Alltag achten wir beispielsweise auf die Nummernschilder der Fahrzeuge auf der Straße. Beim Wegfahren des Fahrzeugs verändern sich die Kennzeichen. Zunächst sind nur noch die Umrisse der Kennzeichen zu erkennen, schließlich verschwimmen sie. Abbildung 3: Abbildung des menschlichen Auges bei unterschiedlichen Entfernungen Wer von zu Hause aus Landschaften in Tausenden von Metern Entfernung betrachten und das Sternenmeer des Universums erkunden möchte, benötigt die Hilfe der Hellseherin unserer Zeit – des Teleskops. 2. Die Entstehung des Teleskops Ein Teleskop ist ein visuelles optisches Instrument zur Beobachtung weit entfernter Objekte. Es kann den sehr kleinen Winkel weit entfernter Szenen um einen bestimmten Faktor vergrößern, sodass diese einen größeren Winkel im Bildraum haben und Objekte, die ursprünglich mit bloßem Auge nicht zu sehen oder zu unterscheiden waren, klar und erkennbar werden. Die Geschichte des Teleskops lässt sich bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgen. Über die Erfindung des Teleskops gibt es viele Versionen. Eine davon wird wie folgt beschrieben: Im Jahr 1608 spielten im niederländischen Middelburg zwei Kinder vor dem Laden des Optikers Hans Lippershey mit ein paar Linsen. Durch die Vorder- und Rücklinse sahen sie in der Ferne die Wetterfahne auf der Kirche und die beiden waren sehr aufgeregt. Hans Liebersche war sehr neugierig und nahm daher auch die Zwei-Linsen-Kombination zur Hand, um die Wetterfahne in der Ferne zu beobachten. Dabei stellte er fest, dass die Wetterfahne in der Ferne stark vergrößert war. Liepcher rannte zurück zum Laden und steckte die beiden Linsen in eine Röhre. Nach vielen Experimenten erfand Hans Liepcher das Teleskop[2]. Abbildung 4 Das erste Teleskop der Welt Seit seiner Erfindung vor 400 Jahren hat die Erfindung und Entwicklung des Teleskops dazu geführt, dass die Entfernung zwischen Objekten ständig „verkleinert“ wurde. Mithilfe des Teleskops haben die Menschen ihre Position im Universum neu definiert und erkannt, dass nicht nur die Erde nicht der Mittelpunkt des Universums ist, sondern auch die Sonne nicht das Zentrum der Milchstraße. Eine riesige Galaxie wie die Milchstraße mit einem Durchmesser von 100.000 Lichtjahren und mehr als 100 Milliarden Sternen ist im riesigen Universum nur ein Tropfen auf den heißen Stein. In gewissem Sinne ist die Entwicklung des Teleskops auch die Entwicklung der modernen Astronomie[3]. Interessanterweise sehen wir diese Art wissenschaftlicher Geräte oft an vielen Orten. Ob Sie es glauben oder nicht, das Teleskop ist eines der wichtigsten wissenschaftlichen Instrumente aller Zeiten. 3. Klassifizierung von Teleskopen Nachdem wir die Entwicklungsgeschichte der Teleskope und ihre Bedeutung für die Menschheit vorgestellt haben, wollen wir über die Klassifizierung von Teleskopen sprechen. Es gibt drei allgemeine Arten von Teleskopen.[4] 1. Refraktorteleskop Ein Teleskop, das eine Linse als Objektiv verwendet, wird als Linsenteleskop bezeichnet. Refraktorteleskope können in zwei Typen unterteilt werden: Diejenigen, die eine konkave Linse als Okular verwenden, werden Galilei-Teleskope genannt; Diejenigen, die eine konvexe Linse als Okular verwenden, werden Kepler-Teleskope genannt. Die Vorteile des Galilei-Teleskops liegen in seinem einfachen Aufbau, dem geringen Lichtenergieverlust, dem kurzen Tubus, dem geringen Gewicht und der aufrechten Abbildung der Szene. Seine Nachteile sind die geringe Vergrößerung und das enge Sichtfeld, sodass es im Allgemeinen nur als Opernteleskop und Spielzeugteleskop verwendet wird. Der Vorteil des Kepler-Teleskops liegt in seinem großen Sichtfeld, das erhaltene Bild ist jedoch invertiert, sodass hinter der Objektivlinse eine Prismen- oder Linsengruppe hinzugefügt werden muss, um das Bild zu drehen, damit das Auge ein aufrechtes Bild wahrnimmt. Die meisten Linsenteleskope verwenden die Kepler-Struktur. Da Refraktorteleskope eine bessere Abbildungsqualität als Spiegelteleskope und ein größeres Sichtfeld aufweisen sowie einfach zu bedienen und zu warten sind, werden bei kleinen und mittelgroßen astronomischen Teleskopen sowie bei vielen Spezialinstrumenten überwiegend Refraktorsysteme eingesetzt. Allerdings ist die Herstellung großer Linsenteleskope wesentlich schwieriger als die von Spiegelteleskopen, da die Herstellung hochwertiger Linsen mit großer Apertur sehr schwierig ist und außerdem das Problem besteht, dass Glas Licht absorbiert. Aus diesem Grund werden bei Teleskopen mit großer Apertur ausschließlich reflektierende Typen verwendet. Abbildung 5 Aufbau und Abbildungsprinzip des Galileo-Teleskops Abbildung 6 Aufbau und Abbildungsprinzip des Kepler-Teleskops 2. Spiegelteleskop Ein Teleskop, das einen konkaven Reflektorspiegel als Objektivlinse verwendet, wird als Spiegelteleskop bezeichnet. Spiegelteleskope können in verschiedene Typen unterteilt werden, beispielsweise Newton-Teleskope und Cassegrain-Teleskope. Abbildung 7 Newton-Teleskop Abbildung 8 Cassegrain-Teleskop Der Hauptvorteil eines Spiegelteleskops besteht darin, dass keine chromatische Aberration auftritt. Wenn die Objektivlinse eine Parabel ist, kann auch die sphärische Aberration eliminiert werden. Um den Einfluss anderer Aberrationen zu verringern, ist das nutzbare Sichtfeld jedoch kleiner. Da nur eine Oberfläche des Primärspiegels bearbeitet werden muss, werden die Herstellungskosten und der Herstellungsaufwand im Hinblick auf den Verarbeitungs- und Herstellungsprozess erheblich reduziert. Daher sind derzeit alle optischen Teleskope mit einer Öffnung größer als 1,34 Meter Spiegelteleskope. Ein Spiegelteleskop mit größerer Apertur kann durch den Austausch verschiedener Sekundärspiegel das Primärfokussystem (oder Newton-System), das Cassegrain-System und das gefaltete Achsensystem erhalten. Auf diese Weise kann ein Teleskop mehrere unterschiedliche relative Öffnungen und Sichtfelder haben. Anwendungstechnisch werden Spiegelteleskope vor allem in der Astrophysik eingesetzt. 3. Katadioptrisches Teleskop Das katadioptrische Teleskop basiert auf einem sphärischen Reflektor, dem zur Korrektur von Aberrationen ein Brechungselement hinzugefügt wurde. Dadurch wird nicht nur die aufwendige Bearbeitung großer asphärischer Spiegel vermieden, sondern auch eine gute Abbildungsqualität erreicht. Das berühmtere ist das Schmidt-Teleskop, das der deutsche Optiker Schmidt 1931 erfand. Seine Struktur besteht darin, dass sich in der Mitte des sphärischen Reflektors eine asphärische Schmidt-Linse befindet, sodass der zentrale Teil des Lichtstrahls leicht konvergiert, während der äußere Teil leicht divergent ist, wodurch lediglich die sphärische Aberration und das Koma korrigiert werden. Abbildung 9 Schmidt-Teleskop Ein weiteres berühmtes katadioptrisches Teleskop ist das Maksutov-Teleskop, das 1941 vom ehemaligen sowjetischen Optiker Maksutov gebaut wurde. Seine Struktur besteht darin, vor dem sphärischen Reflektor eine negative Meniskuslinse hinzuzufügen. Durch die Wahl geeigneter Parameter und die Position der Meniskuslinse können sphärische Aberration und Koma gleichzeitig korrigiert werden. Bei einem katadioptrischen Teleskop wird das Bild durch einen reflektierenden Spiegel erzeugt und ein Brechungsspiegel wird zur Korrektur von Aberrationen verwendet. Seine Merkmale sind eine relativ große Blendenöffnung, eine starke Lichtleistung, ein weites Sichtfeld und eine hervorragende Bildqualität. Anwendungstechnisch eignet sich das katadioptrische Teleskop für die Himmelsdurchmusterungsfotografie und die Beobachtung von Himmelskörpern wie Nebeln, Kometen und Meteoren. Wenn ein kleines visuelles Teleskop ein katadioptrisches Cassegrain-System verwendet, kann das Rohr sehr kurz gemacht werden. Abbildung 1 0 Maksutov-Teleskop 4. Positives Bildsystem Was wir durch das Kepler-Teleskop sehen, ist das umgekehrte Bild des Objekts. Um die Beobachtung zu erleichtern, sollte dem System ein Umkehrprismensystem hinzugefügt werden, um das umgekehrte Bild umzudrehen. Zu den Prismen, die zum Spiegeln des umgekehrten Bildes verwendet werden können, gehören das Dachkantprismensystem (auch bekannt als Schmidt-Biehan-Dachkantprismensystem) und das Porroprismensystem (auch bekannt als Porroprismensystem). Die Prinzipien und Anwendungen der beiden Systeme sind ähnlich. Der einzige Unterschied besteht darin, dass sich das Bild nach der Umkehrung durch das Bihan-Prismensystem noch immer auf derselben Achse befindet, während sich das Bild nach der Umkehrung durch das Porro-Prisma auf einer anderen Achse befindet als das Bild vor der Umkehrung. Die Systemstruktur ist also nicht dicht genug. Schauen wir uns zunächst die Strukturen dieser beiden positiven Bildsysteme an: Das Pechan-Prismensystem besteht aus zwei Glasprismen, die durch einen Luftspalt getrennt sind. Durch mehrfache Totalreflexionen wird das Bild vertikal gespiegelt und das „Dach“ des zweiten Prismas dreht das Bild seitlich, was zu einer 180°-Drehung des Bildes führt. Das Bild zeigt ein Leica-Teleskop, das das sogenannte Pechan-Prismensystem verwendet. Abbildung 11. Behan-Prismensystem Das Porroprismensystem ist ein gleichschenkliges rechtwinkliges Prisma aus einem Glasblock, dessen flache Enden im rechten Winkel zueinander stehen. Bei der Verwendung tritt das Licht von der größten rechteckigen Oberfläche des Prismas ein, erfährt zwei Totalreflexionen an der geneigten Oberfläche und durchdringt dann die ursprüngliche Einfallsebene und tritt aus. Da das Licht normal ein- und austritt, erzeugt das Prisma keinen Dispersionseffekt. Das Bild, das durch das Porroprisma geht, wird jedoch um 180° gedreht und bewegt sich in die Richtung, in der es ursprünglich eingetreten ist, d. h., die Bewegungsrichtung ändert sich ebenfalls um 180°. Abbildung 12 Porroprismensystem 5. Verwendung einer mehrachsigen Käfigstruktur zum Bau eines Teleskops Die Teleskope, die wir in unserem täglichen Leben sehen, sind in speziellen Gehäusen verpackt und befestigt. Die Struktur und die Richtung des Lichtwegs sind nicht erkennbar, was bei den Menschen oft ein Gefühl des Mysteriösen hervorruft. Doch wenn sich sein geheimnisvoller Schleier lüftet, werden Sie seufzen und feststellen, dass das Teleskop nur aus ein paar Linsen besteht. Das mit einer mehrachsigen Käfigstruktur aufgebaute Kepler-Teleskopsystem ermöglicht Ihnen eine intuitive Sicht auf die innere Struktur des Teleskops. Wenn Sie das Abbildungsprinzip des Teleskops und die damit verbundenen optischen Kenntnisse verstehen, können Sie mithilfe mehrachsiger Käfig-Optomechanikteile und optischer Elemente ein DIY-Teleskop wie aus Bausteinen bauen. Das Behan-Prismensystem wird als Umkehrsystem verwendet und ist in einem Kepler-Teleskopsystem mit mehrachsiger Käfigstruktur untergebracht. Die optischen Elemente im System sind koaxial und die Struktur ist einfach und kompakt. Im Unterricht und in der Populärwissenschaft können die optischen Phänomene intuitiv beobachtet und gleichzeitig die Rolle des Behan-Prismensystems demonstriert werden. Durch Bewegen der Objektivlinse oder des Okulars können Szenen in unterschiedlichen Entfernungen beobachtet werden. Abbildung 13 Kepler-Teleskopsystem mit RayCage-Mehrachsenkäfigstruktur zum Aufbau eines Behan-Prismensystems Obwohl das Porroprismensystem die Systemstruktur nicht kompakt macht, wird es aufgrund seiner Vorteile wie einfacher Aufbau, geringer Kosten und guter optischer Wirkung in den meisten Teleskopen häufig verwendet. Basierend auf dem Vorteil der mehrachsigen Käfigstruktur, die mit mehreren optischen Achsen verwendet werden kann, wurde eine einzigartige Prismenklemme entwickelt, um das Por-Prismensystem in einem Mikroskop mit mehrachsiger Käfigstruktur zu verwenden und so den Effekt der Bildumkehr zu erzielen. Abbildung 14: Kepler-Teleskopsystem mit RayCage-Mehrachsen-Käfigstruktur zum Aufbau eines Porroprismensystems Die Erfindung des Teleskops veränderte die Art und Weise, wie wir das Universum beobachten, und dieser Wandel hält seit mehr als 400 Jahren an. Aber auch der Mensch selbst macht einige Veränderungen durch, wenn es um die Nutzung von Teleskopen geht. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass das Teleskop, bevor wir verstehen, was es uns zeigt, nicht nur eine Erweiterung unserer Sicht, sondern auch eine Erweiterung unseres Denkens darstellt. Dieser Artikel vermittelt nur kurz die Grundlagen zum Thema Teleskope. Interessierte Leser können entsprechende Materialien zu Rate ziehen, um mehr über Teleskope zu erfahren. Hier verwendet die Ruiguang Cage Company lediglich eine mehrachsige Käfigstruktur, um ein einfaches Kepler-Teleskop zu bauen. Wenn Sie sich für Galileo-Teleskope und Spiegelteleskope interessieren, können Sie auch Ihr eigenes DIY-Teleskop bauen, um die Sterne und den Mond zu „umarmen“! Verweise 1. Davson, Hugh und Perkins, Edward S. „Das menschliche Auge.“ Encyclopedia Britannica , 1. Dezember 2021, https://www.britannica.com/science/human-eye . 2. Hua Qingfu. Weiter sehen, klarer sehen: Teleskop und Mikroskop[J]. Die heutigen Mittelschüler, 2019(35):20-22. 3. Su Dingqiang. Teleskop und Astronomie: 400 Jahre Rückblick und Ausblick[J]. Physik, 2008(12):836-843. 4. Xia Xiongping. Die Erfindung und Entwicklung des optischen Teleskops[J]. Erfindung und Innovation (Studentenausgabe), 2007(04):12-13. Schöpfer: Chen Tingxiao, Ruiguang Kaiqi (Zhenjiang) Optoelectronics Technology Co., Ltd. , China Instrument and Meter Society Youth Optical Science (Zhenjiang) Thema Populärwissenschaftliche Bildungsbasis (Hinweis: Dieser Artikel ist ein Beitrag zur populärwissenschaftlichen Sammelaktion „Instrumente und Instrumentierungstechniker um uns herum“, die von der Chinese Instrument Society ins Leben gerufen wurde.) |
Artikel empfehlen
Tsinghua Unigroup übernimmt möglicherweise den GPU-Lieferanten von Apple und verfügt nun über eine eigene CPU und GPU
Am 3. April kündigte Apple an, dass es innerhalb ...
Wie oft sollte man im Winter duschen? Für diese Menschen empfiehlt es sich, ein wenig „faul“ zu sein, um gesünder zu sein
Aktuelle Situation des Badens im Winter↓ Ich schi...
Hu Q&A: Wie misst man eine Temperatur von 100 Millionen Grad?
Wie misst man eine Temperatur von 100 Millionen G...
Was ist mehr als ein Jahr nach der Umsetzung des Gesetzes zum Schutz schwarzer Böden mit den „Großen Pandas“ auf den Ackerflächen geschehen?
Geschrieben von Reporter Chen Yongjie Foto- und T...
Lösen Sie einen weiteren Fall! Der dritte Bruder des Jiangxia-Fisches tauchte plötzlich 4.000 Kilometer entfernt auf und der „Übeltäter“ stellte sich als Plattendrift heraus!
Produziert von: Science Popularization China Auto...
So trainieren Sie, um Muskeln aufzubauen
Muskeln sind der Traum eines jeden Mannes und Mus...
Was ist besser zum Training der Armmuskulatur: Armkraftmaschine oder Hanteln?
Viele unserer Freunde trainieren gerne. Besonders...
Können Sit-ups Bauchfett reduzieren?
Ob Sit-ups Bauchfett reduzieren können, darüber g...
Das intelligente Fahren von Huawei ist bereits in Toyota installiert und Nissan könnte bald folgen. Honda läuft die Zeit davon.
Toyota kann es nicht mehr zurückhalten. Die jüngs...
Was ist der schnellste Weg, Muskeln aufzubauen?
Egal, was wir tun, wir alle möchten wissen, wie w...
Was ist die beste Aerobic-Übung?
Mit der kontinuierlichen Verbesserung des Lebenss...
Hantel-Heimtrainingsmethode
Aufgrund des zunehmenden sozialen Drucks haben vi...
Welche Sicherheitsvorkehrungen gibt es beim Bergsteigen?
Heutzutage hat sich das materielle Leben erheblic...
Erinnern Sie sich, wovon Sie letzte Nacht geträumt haben?
Jeder träumt nachts, aber nicht jeder erinnert si...
Tesla entlässt die Hälfte seines globalen Rekrutierungsteams, um Kosten zu senken
Nachrichten vom 13. März: Laut Electrek hat Tesla...