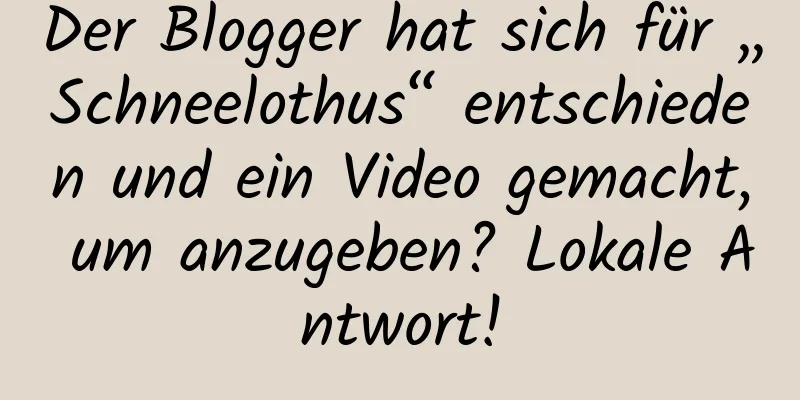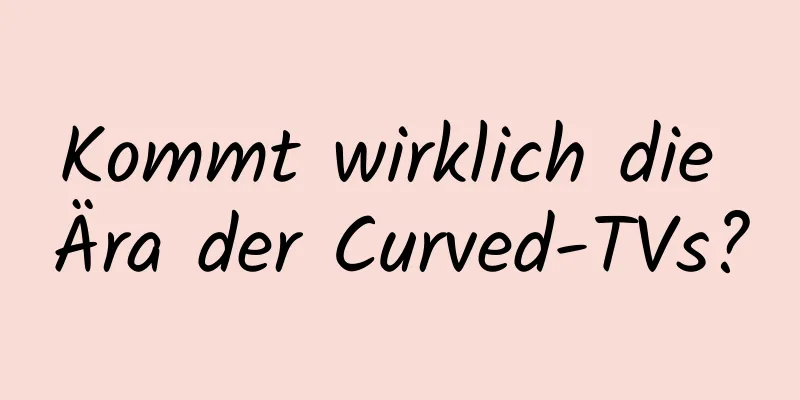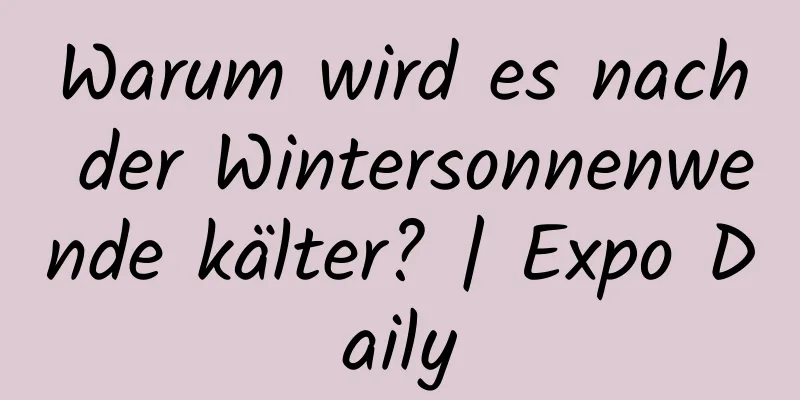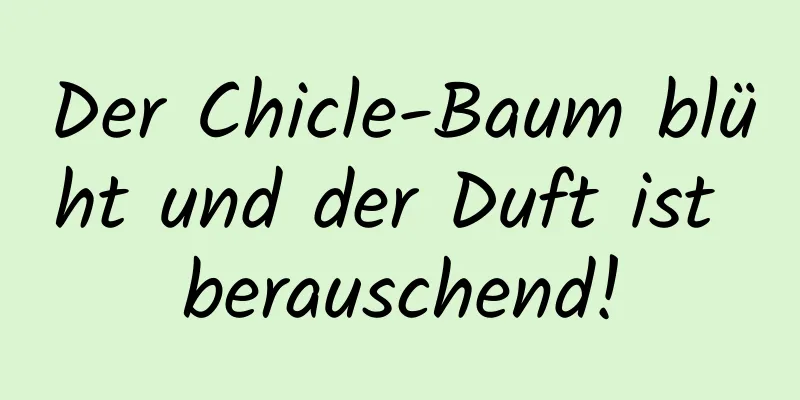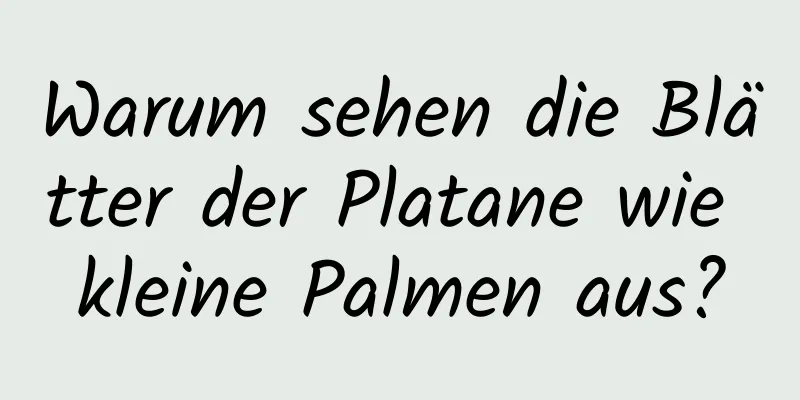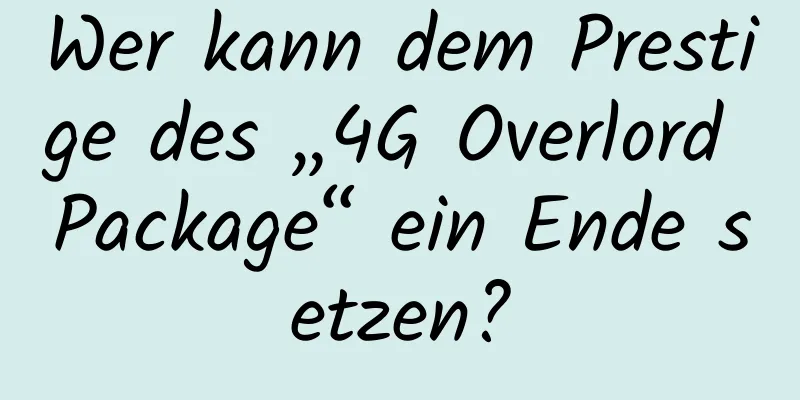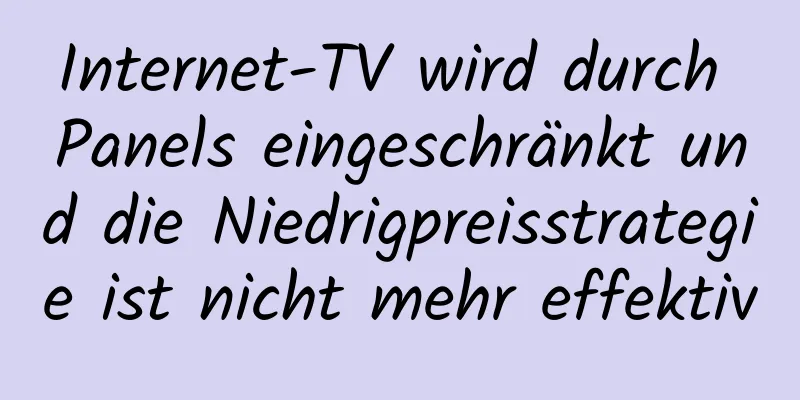Diese automatischen Puppen können Musik spielen und sprechen. Sind sie die Vorläufer der künstlichen Intelligenz?
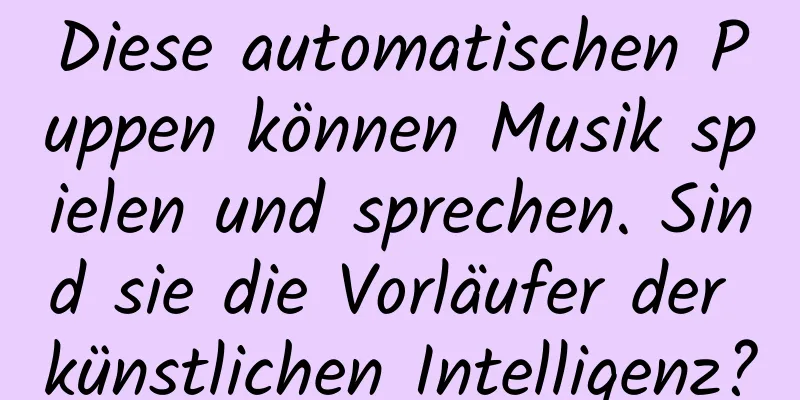
|
Leviathan Press: Das englische Wort Automaton bedeutet Automat oder automatische Marionette. Das Wort stammt vom altgriechischen Wort αὐτόματον (autómaton), was „nach eigenem Willen handeln“ bedeutet. Aber strenggenommen ist Android für den Automaten, der in diesem Artikel vorkommt, besser geeignet. In Automatenanwendungen gibt es viele spieluhrähnliche Geräte, die sich stark von den in diesem Artikel besprochenen Maschinen unterscheiden. Obwohl es sich im Wesentlichen um Reproduktionen menschlicher/humanoider Mechanismen handelt, ist die Komplexität von Androiden weitaus größer als die von Spieluhren. Das Wort „Android“ ist griechischen Ursprungs und bedeutet „menschenähnlich“ und wurde vom französischen Arzt und Bibliothekar Gabriel Naudé geprägt. Er war Leibarzt von Ludwig XIII. und später Gestalter der 40.000 Bände umfassenden Bibliothek von Kardinal Jules Mazarin. Noddy war Rationalist und lehnte den Aberglauben ab. Im Jahr 1625 veröffentlichte er eine Verteidigung der scholastischen Philosophen. Der Text erwähnt Albertus Magnus (Albert der Große), einen Theologen und Philosophen aus dem 13. Jahrhundert, der einen Roboter aus Bronze geschaffen haben soll. Die Geschichte scheint lange nach dem Tod Alberts des Großen von dem produktiven Kritiker des 15. Jahrhunderts, Alfonso de Madrigal, auch bekannt als El Tostado, geschrieben worden zu sein. Er adaptierte und verschönerte mittelalterliche Legenden von beweglichen Statuen und sprechenden Bronzeköpfen. El Tostado sagte, Big Albert habe 30 Jahre gebraucht, um einen ganzen Menschen aus Metall zu erschaffen. Der Automat lieferte Antworten auf alle kniffligsten Fragen von Big Albert und diktierte in einigen Versionen der Geschichte sogar fröhlich einen Großteil von Big Alberts Schriften. Laut El Tostado fiel das Schicksal der Maschine letztlich in die Hände von Thomas von Aquin, einem Schüler Alberts des Großen. Thomas von Aquin konnte „das unaufhörliche Geschwätz“ nicht ertragen und zerschmetterte es in Stücke. Noddy glaubt nicht an Big Alberts sogenannten sprechenden Roboter. Er wies diese Geschichte, ebenso wie andere Geschichten über Leute, die über ihren eigenen Kopf reden, als „falsch, lächerlich und falsch“ zurück. Nordy weist darauf hin, dass diesen Geräten „Muskeln, Lungen, Kehldeckel und alle notwendigen Organe für eine perfekte Stimmproduktion“ völlig fehlen. Noddy kam zu dem Schluss, dass Big Albert allen Berichten zufolge wahrscheinlich tatsächlich einen Roboter gebaut hatte, konnte jedoch nie eine klare und deutliche Antwort auf seine Frage geben. Alberts Maschine ähnelt möglicherweise eher dem ägyptischen Memnonkoloss, einer Statue, die von antiken Schriftstellern ausführlich besprochen wurde: Als Sonnenlicht auf sie traf, gab sie ein angenehmes Murmeln von sich, da die Hitze dazu führte, dass die Luft im Inneren der Statue „verdünnt“ wurde und durch kleine Rohre ausgestoßen wurde, wodurch ein flüsterndes Geräusch entstand. Abbildung der Memnonkolosse aus einem Ägyptenbericht aus dem Jahr 1800. © Wikipedia Obwohl er dem sprechenden Kopf von Big Albert nicht traute, gab Noddy ihm einen wirkungsvollen neuen Namen: „Android“. Auf diese Weise führte er geschickt einen neuen Begriff in die Sprache ein, denn laut dem Wörterbuch des französischen Philosophen und Schriftstellers Pierre Bayle aus dem Jahr 1695 war „Android“ „ein völlig unbekanntes Wort, die reine Erfindung von Nordi, der die Kühnheit besitzt, es zu verwenden, als wäre es bereits etabliert.“ Es war eine günstige Zeit für ein neues Vokabular: Noddys Begriffe fanden schnell Eingang in neue Wörterbücher und Enzyklopädien. Baylor wiederholt diesen Begriff in seinem Wörterbucheintrag für „Great Albert“. So wurde „Android“ als Eintrag im ersten Band des Nachtrags zur Enzyklopädie von Ephraim Chambers, dem Herausgeber der Britischen Enzyklopädie, verewigt. Während er die Existenz des „Androiden“ von Albert dem Großen leugnete, hauchte Noddy dem „Androiden“ als Maschinenkategorie neues Leben ein. „Albert Magnus‘ sprechender Kopf“ aus J. H. Peppers Encyclopedia of Science Simplified (1885). © archive.org Der erste echte Roboter in der Geschichte, der die neue experimentelle Philosophie prägte – ein „Android“ im etymologischen Sinne von Noddy, ein funktionierender Humanoid, der aus „notwendigen Teilen“ besteht – wurde am 3. Februar 1738 auf der jährlichen Exposition Saint-Germain am linken Seineufer in Paris ausgestellt. Dieser Android unterscheidet sich von früheren Musikautomaten, hydraulischen Orgeln und Figuren auf Spieluhren dadurch, dass er die komplexe Aufgabe, die er scheinbar ausführt, nämlich in diesem Fall das Spielen der Flöte, tatsächlich ausführt und nicht einfach nur suggestive Bewegungen ausführt. Der Hirte mit der Flöte von Antoine Kosevoc. © Wikipedia Das Gerät war eine Neuheit, doch vielen Messebesuchern muss es vertraut gewesen sein, da es das Aussehen einer berühmten Statue imitierte, die am Eingang zum Tuileriengarten stand und sich heute im Louvre-Museum befindet: „Flöte spielender Hirte“ von Antoine Coysevox. Wie die Statue wird der Android als Faun dargestellt – ein mechanischer Faun, der eine Flöte hält. Der mechanische Faun erwachte plötzlich zum Leben und begann, sein Instrument zu spielen, wobei er 12 Stücke hintereinander vortrug. Zunächst vermutete das Publikum, dass es sich um eine Spieldose handeln müsse, bei der im Inneren ein automatischer Mechanismus die Töne erzeuge und die Figuren außen nur so täten, als würden sie spielen. Automaten von Jacques Vaucanson: ein Flötenspieler, eine automatisch defäkierende Ente und ein Tamburinspieler. © Wikimedia Commons Aber das ist nicht der Fall; Der Android spielt tatsächlich eine echte Flöte, indem er Luft aus seinen „Lungen“ (drei Blasebälgen) bläst und dabei seine Lippen, seine weiche Zunge und seine lederbedeckten Finger verwendet. Es gibt sogar Berichte von Zuschauern, die ihre eigenen Flöten mitbrachten und von der Maschine gespielt wurden. Dieser Flöte spielende Android ist das Werk eines jungen Ingenieurs namens Jacques Vaucanson. Als jüngstes von zehn Kindern eines Handschuhmachers aus Grenoble wurde er im kalten Winter 1709 geboren, im letzten Alter der langen Herrschaft Ludwigs XIV., im blutigsten Jahr der schrecklichen Hungersnot und der französischen Niederlage. Vaucanson ging aus diesem dunklen Moment hervor, sein Leben fiel mit der Zeit der Aufklärung zusammen und sein Werk wurde zu einer Inspirationsquelle für die Literatur. Als Kind machte es ihm Spaß, Uhren zu bauen und zu reparieren. Während seiner Schulzeit begann er, Automaten zu entwerfen. Während seines kurzen Klosterlebens in Lyon ordnete ein Kirchenbeamter die Zerstörung von Vaucansons Werkstatt an und im Alter von 19 Jahren kam er nach Paris, um nach Möglichkeiten zu suchen. Ursprünglich wollte er Arzt werden und belegte einige Kurse in Anatomie und Medizin, doch schon bald beschloss er, sein Wissen auf ein neues Gebiet anzuwenden: die Nachbildung von Lebensvorgängen in Maschinen. Der Flötenspieler ist das Ergebnis von fünf Jahren harter Arbeit von Vaucanson. Nach der Fertigstellung reichte Vaucanson ein Memorandum mit der Erläuterung der Grundsätze bei der Pariser Akademie der Wissenschaften ein. Dieses Memorandum enthält die erste bekannte experimentelle und theoretische Studie zur Akustik der Flöte. „Vaucanson“, aus Die großen Erfinder der Antike und der Moderne, 1864. © gallica.bnf.fr Nach einem achttägigen Debüt auf der Ausstellung in Saint-Germain verlegte Vaucanson seinen Roboter in das Hôtel de Longueville, ein prächtiges Herrenhaus aus dem 16. Jahrhundert im Stadtzentrum. In den prächtigen Saal kamen täglich etwa 75 Menschen, die jeweils den teuren Eintrittspreis von 3 Livres (entspricht etwa dem durchschnittlichen Wochenlohn eines Pariser Arbeiters) bezahlten. Auch Mitglieder der Pariser Akademie der Wissenschaften besuchten das Hotel Longueville, um den Flöte spielenden Android-Roboter zu sehen. Vaucanson trifft sich jeweils mit 10 bis 15 Personen, erklärt dem Publikum die Prinzipien des Flöten spielenden Roboters und lässt ihn dann mit dem Musizieren beginnen. Der Film erhielt begeisterte Kritiken von den Kritikern. Ein Kritiker schrieb, dass „ganz Paris gekommen war, um … das vielleicht einzigartigste und entzückendste mechanische Phänomen zu bewundern, das je geschaffen wurde“, und bemerkte, dass der Androide „tatsächlich Flöte spielte“. Ein anderer Kritiker stimmte dem zu und bezeichnete es als „das erstaunlichste Stück Maschinerie, das je geschaffen wurde“. Der Journalist und Populärschriftsteller Pierre Desfontaines beschrieb in seinem Literaturjournal das Innere des Flöten spielenden Roboters als „zahllose Drähte und Stahlketten …, die durch die Simulation der Ausdehnung und Kontraktion der Muskeln die Bewegungen der Finger erzeugen, genau wie bei einem lebenden Menschen. Zweifellos leitete dieses Wissen über die menschliche Anatomie … den Autor bei seinem mechanischen Entwurf.“ Vaucansons Arbeit wurde zum Vorbild für Android-Roboter im Eintrag „Android“ im populärwissenschaftlichen Meisterwerk „Enzyklopädie“, das vom Philosophen und Schriftsteller Denis Diderot und dem Mathematiker und Philosophen Jean d'Alembert herausgegeben wurde. Dieser von d'Alembert verfasste Eintrag definiert einen Androiden als einen humanoiden Roboter, der menschliche Funktionen ausführt. Kurz nachdem Mitglieder der Pariser Akademie der Wissenschaften das Hôtel de Langueville besucht hatten, verlas Vaucanson ein Memorandum über den Aufbau und die Funktion eines Flöten spielenden Roboters. Der Android-Roboter wird durch ein Gewicht angetrieben, das von zwei Zahnradsätzen angetrieben wird. Das Zahnrad an der Unterseite dreht eine Welle mit einer Kurbel und treibt drei Sätze Blasebälge an, die mit drei Luftschläuchen verbunden sind, wodurch drei verschiedene Blasdrücke für die Lunge des Flöte spielenden Roboters bereitgestellt werden. Der obere Zahnradsatz dreht einen Zylinder mit einer Nocke und löst einen Hebelrahmen aus, der die Finger, die Luftröhre, die Zunge und die Lippen des Flöte spielenden Roboters steuert. Um eine Maschine zu entwickeln, die Flöte spielen kann, führte Vaucanson eine detaillierte Studie an menschlichen Flötenspielern durch. Er entwickelte Möglichkeiten, Aspekte ihres Spiels in das Design seiner Android-Roboter zu übertragen. Um beispielsweise Takte zu markieren, ließ er einen Flötisten die Melodie spielen, während eine andere Person mit einem spitzen Stift den Takt auf einen rotierenden Zylinder klopfte. In diesem Winter fügte Vaucanson der Ausstellung zwei neue Maschinen hinzu. Einer davon ist der zweite Musikautomat, ein lebensgroßer provenzalischer Hirte, der 20 Menuette auf einer Flöte spielt, die er in seiner linken Hand hält, während er mit der rechten Hand auf eine Trommel schlägt, die an seiner Schulter hängt. Die Flöte hat nur drei Löcher, was bedeutet, dass die Töne fast ausschließlich durch Veränderungen des Blasdrucks und der Zunge erzeugt werden. Bei dem Versuch, diese Feinheiten nachzubilden, entdeckte Vaucanson, dass menschliche Flötenspieler einen viel größeren Bereich an Blasdrücken verwenden, als ihnen selbst bewusst ist. Der Pfeifer machte auch eine weitere überraschende Entdeckung. Vaucanson dachte ursprünglich, dass jede Note durch eine bestimmte Kombination aus Fingerposition und Luftdruck erzeugt werde, doch er entdeckte, dass der für jede gegebene Note erforderliche Luftdruck von der vorherigen Note abhing. Beispielsweise erfordert der Ton D nach dem Ton E mehr Druck als der Ton D nach dem Ton C, er muss also den doppelten Blasdruck wie die Anzahl der Töne aufbringen. Die höheren Obertöne der hohen Töne schwingen in der Flöte stärker mit als die tieferen Obertöne der tiefen Töne; Der Flötenspieler selbst ist sich jedoch nicht bewusst, dass er diesen Effekt kompensieren muss. Die Physik dieser Obertöne wurde erst in den 1860er Jahren von Hermann von Helmholtz vollständig aufgeklärt. Diese Automaten machen nicht nur Musik – das wurde schließlich schon vor zwei Jahrhunderten mit Spieldosen erreicht –, sondern die Androiden können mit ihren flexiblen Lippen, Zungen, Fingern und dem Öffnen und Schließen der Lungen Musik spielen. Sie simulierten den Vorgang des Musizierens durch Menschen, und im Laufe des Jahrhunderts begannen die Entwickler solcher Simulationen, sich der komplexeren Aufgabe zuzuwenden, nämlich Maschinen zu bauen, die die menschliche Sprache imitieren konnten. Vaucansons automatische Ente: Diese automatische Ente kann mit den Flügeln schlagen und hüpfen, aber das Auffälligste an ihr ist, dass Sie sie etwas Getreide schlucken lassen und den Verdauungs- und Ausscheidungsprozess beobachten können. Scientific American, 21. Januar 1899. © Linda Hall Library Im Jahr 1739, ein Jahr nach der Einführung von Vaucansons Automat, veröffentlichte ein Chirurg namens Claude-Nicolas le Cat einen heute verlorenen Artikel, in dem er einen „Automaten beschrieb, in dem man die Hauptfunktionen des Tieres sehen kann: Kreislauf, Atmung und ‚Sekretion‘“. Es ist unklar, was aus diesem frühen Projekt wurde, aber Le Ca griff die Idee im Jahr 1744 erneut auf und verlas dabei ein aufsehenerregendes Memorandum, wie aus dem Protokoll einer Sitzung der Akademie von Rouen hervorgeht. Das Publikum sagte: „Herr Leca erzählte uns von seinem Plan für einen Automaten … Sein Automat wird über Atmung, Kreislauf, Verdauung, Sekretion, Chylus, Herz, Lunge, Leber und Blase mit allen dazugehörigen Funktionen verfügen.“ Lecas Automat wäre zu „allen Vorgängen eines Lebewesens“ fähig, darunter nicht nur den Blutkreislauf, den Herzschlag, die Lungenfunktion, das Schlucken von Nahrung, die Verdauung, die Ausscheidung, das Füllen der Blutgefäße und die Blutentleerung, sondern – und damit eindeutig die kartesische Grenze zwischen mechanischem Körper und rationaler Seele überschreitend – „sogar die Aussprache von Sprache“. Don Quijote untersucht den sprechenden Kopf. Nach einem Stich von Martin Engelbrecht, 1662. © The British Library Diese Idee, die Möglichkeit, artikulierte Sprache zu simulieren, hatte im vorherigen Jahrhundert eine Flut philosophischer Diskussionen ausgelöst. Manche halten dies noch immer für eine Fantasie aus quichotote (Weltuntergangsstimmung). Doch als Don Quijote selbst einem sprechenden Bronzekopf begegnet (der in Wirklichkeit mit einer verborgenen Person verbunden ist), ist er völlig verzaubert, während sein weniger empfänglicher Knappe Sancho Panza überhaupt kein Interesse zeigt. Cervantes’ Zeitgenosse, der spanische Schriftsteller Martín del Río, stimmte zu: „Es ist unvernünftig, wenn ein unbelebter Gegenstand menschliche Laute von sich gibt und Fragen beantwortet. Dies erfordert Leben, Atmung, die Koordination aller lebenswichtigen Organe und ein gewisses logisches Denkvermögen des Sprechers.“ Jahrzehnte später scheinen die künstlichen Maschinen, von denen Del Rio sprach, realisierbar. Athanasius Kircher schrieb 1673 über die Legenden vom sprechenden Kopf Alberts des Großen und den Memnonkolosse im alten Ägypten. Während manche Skeptiker diese Geräte für „entweder nicht existent, betrügerisch oder mit Hilfe böser Geister hergestellt“ hielten, glaubten viele, dass man eine Statue mit einer Kehle, einer Zunge und anderen Stimmorganen erschaffen könnte, die bei Aktivierung durch Wind einen verständlichen Laut erzeugen würde. Kircher fügte eine Entwurfsskizze für eine sprechende Puppe bei. Sein Student Gaspar Schott, ebenfalls ein produktiver Naturphilosoph und Ingenieur, erwähnte sogar eine Statue, die Kircher für die damalige Königin Christina von Schweden errichtet hatte und die Fragen beantwortete. Zweifellos hatte ihr ehemaliger Philosophielehrer Descartes ihr Interesse an der Beziehung zwischen rationaler Sprache und mechanischen Körpern geweckt. Obwohl die Idee der Sprachsimulation nicht neu war, erfuhr sie Mitte des 18. Jahrhunderts unter Experimentalphilosophen und Maschinenbauingenieuren erneutes Interesse. Sie glaubten, dass Sprache eine Körperfunktion wie Atmung oder Verdauung sei – sie machten keine klare Unterscheidung zwischen dem Gehirn und den physiologischen Mechanismen der Sprache – und selbst Skeptiker äußerten ihre Zweifel eher aufgrund physiologischer Details als aufgrund grundsätzlicher Einwände. In einer begeisterten Kritik des „Pierre de Vaucanson“ aus dem Jahr 1738 sagte de Fontaine beispielsweise voraus, dass künstliche Maschinen nie in der Lage sein würden, verständliche Sprache hervorzubringen, da die physikalischen Mechanismen des Sprechens unverständlich blieben: Man könne nie genau wissen, „was im Kehlkopf vor sich geht … [und] alle Bewegungen der Zunge, des Kiefers und der Lippen“. De Fontaine glaubte, dass Sprechen ein im Wesentlichen organischer Prozess sei, der nur in einer lebenden Kehle stattfinden könne. De Fontaine ist mit dieser Ansicht nicht allein. Damals glaubten Skeptiker, die der Möglichkeit künstlicher Sprache gegenüberstanden, im Allgemeinen, dass der menschliche Kehlkopf, der Stimmapparat und der Mund zu weich und flexibel seien, um mechanisch simuliert zu werden. Um 1700 legte Denys Dodart, der Leibarzt von Ludwig XIV., der Pariser Akademie der Wissenschaften mehrere Denkschriften über die menschliche Stimme vor. Darin argumentierte er, dass der Klang durch die Kontraktion der Stimmritze verursacht werde und dass diese „von der Kunst nicht nachgeahmt werden könne“. Der Schriftsteller und Gelehrte Bernard le Bovier de Fontenelle, der damalige ständige Sekretär der Akademie, bemerkte, dass kein Blasinstrument durch einen solchen Mechanismus (die Variation einer einzigen Öffnung) Töne erzeugen könne und dass dieser „völlig jenseits des Bereichs der Nachahmung“ scheine. „Die Natur hat Zugang zu Materialien, die uns völlig unzugänglich sind, und sie weiß diese auf eine Art und Weise zu verwenden, die uns völlig unbekannt ist.“ Der letzte Verfechter der „Theorie der materiellen Schwierigkeit“ war der Philosoph und Schriftsteller Antoine Court de Gébelin. Er stellte fest, dass „die Vibrationen, die sich auf alle Teile der Stimmritze ausbreiten, das Zittern der Muskeln, ihre Auswirkungen auf das Zungenbein, das sich auf und ab bewegt, die Luftschwingungen an den Seiten des Mundes … diese Phänomene“ nur in einem lebenden Körper auftreten könnten. Es gibt auch viele Menschen, die dieser Ansicht nicht zustimmen. So kam etwa der polemische Materialist Julien Offray de La Mettrie nach der Betrachtung von Vaucansons „Flötenspieler“ zu dem Schluss, dass eine sprechende Maschine „nicht länger als unmöglich angesehen werden kann“. „Stimmorgane“, Illustration aus Antoine Cour de Gerbelins „Die Urwelt“ (ca. 1773–1782). © gallica.bnf.fr Im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts begannen mehrere Menschen an Projekten zur künstlichen Sprache zu arbeiten. Sie waren sich beide einig, dass die Laute der gesprochenen Sprache eine Struktur erfordern, die dem Rachen und Mund möglichst nahe kommt. Die Annahme, dass Sprechmaschinen den Stimmapparat simulieren müssen, war nicht immer der bestimmende Faktor im Denken über künstliche Sprache. Im Jahr 1648 beschrieb John Wilkins, der erste Sekretär der Royal Society, Pläne für eine sprechende Statue, die durch die Verwendung „unverständlicher Laute“ Sprache synthetisieren statt simulieren sollte: „Wir können beobachten, dass das Wellen des Wassers wie der Buchstabe L ist, das Abkühlen heißer Körper wie der Buchstabe Z, der Klang von Saiten wie der Buchstabe Ng (sic), der Peitschenschlag wie der Buchstabe Q und so weiter.“ Doch in den 1770er und 1780er Jahren glaubten die Erbauer von Sprechmaschinen überwiegend, dass es unmöglich sei, künstliche Sprache zu erzeugen, ohne einen sprechenden Kopf zu bauen: um die Stimmorgane nachzubilden und den Sprechvorgang zu simulieren. Der erste, der versuchte, eine solche Maschine zu bauen, war der englische Dichter und Naturforscher Erasmus Darwin (Großvater von Charles Darwin), der 1771 berichtete, er habe „einen hölzernen Mund konstruiert, mit Lippen aus weichem Leder und einer Klappe an der Rückseite als Nasenlöcher.“ Darwins sprechender Kopf verwendete als Kehle ein „Band …, das zwischen zwei leicht konkaven Stücken glatten Holzes gespannt war“. Es heißt „Mama, Papa, Map und Pam“ in einem „sehr klagenden Ton“. Die beiden sprechenden Köpfe von Pater Mikael, gezeichnet von EA Tilly. © wikimedia Der nächste, der Sprache simulierte, war der Franzose Abbé Mical, der der Pariser Akademie der Wissenschaften im Jahr 1778 ein Paar sprechende Köpfe vorstellte. Der Kopf enthält „mehrere künstliche Stimmritzen, die in unterschiedlicher Form auf einer gespannten Membran angeordnet sind“. Durch diese Stimmritzen führen die beiden Köpfe einen Dialog, in dem sie Ludwig XVI. loben. Einer der Köpfe sagte: „Der König hat Europa Frieden gebracht“, und der andere antwortete: „Frieden bringt dem König Ruhm“, und der erste fügte hinzu: „Frieden bringt den Menschen Glück“, und der zweite schloss mit den Worten: „Oh, König, du bist der liebevolle Vater deines Volkes, und sein Glück zeigt Europa die Herrlichkeit deines Throns.“ Der Pariser Klatschjournalist Louis Petit de Bachaumont bemerkte, dass die Köpfe lebensgroß, aber mit auffälligem Gold bedeckt waren. Sie haben einige Wörter verschluckt und bestimmte Bytes verschluckt; außerdem waren ihre Stimmen heiser und ihre Worte langsam. Dennoch ist ihre „Fähigkeit zu sprechen“ unbestreitbar. Wissenschaftler, die mit der Untersuchung von Mikals sprechenden Köpfen beauftragt wurden, waren sich zwar einig, dass deren Aussprache „sehr unvollkommen“ sei, billigten das Werk aber dennoch, weil es die Natur nachahmte und „dieselben Strukturen enthielt, die wir bei der Zergliederung … der Stimmorgane sehen“. Bachaumont berichtete, dass die Gelehrten von Pater Micard so beeindruckt waren, dass sechs Vertreter der Akademie der Wissenschaften Micard einluden, sie zu begleiten und dem König den Erfinder des berühmten sprechenden Kopfes vorzustellen, als am 19. September 1783 bei der Montgolfier-Heißluftballonvorführung in Versailles ein Schaf, ein Hahn und eine Ente die ersten Flugpassagiere der Welt wurden. Im folgenden Jahr veranstaltete die St. Petersburger Akademie der Wissenschaften, möglicherweise auf Anregung des Mathematikers Leonhard Euler, einen Preiswettbewerb mit dem Ziel, die Eigenschaften von Vokalen zu bestimmen und ein Instrument zu konstruieren, das den menschlichen Orgelpfeifen ähnelte, um diese auszudrücken. Den Preis gewann Akademiemitglied CG Kratzenstein. Er verwendete eine künstliche Stimmritze (Rohrblatt) und Orgelpfeifen, die sich je nach Position der Zunge, der Lippen und des Mundes während der Aussprache veränderten. Wolfgang von Kempelens Entwurf für Komponenten einer Sprechmaschine, 1791. Der Blasebalg fungiert als Lunge und pumpt Luft in ein mit einer vibrierenden Zunge ausgestattetes Stimmorgan, dessen Klang durch das Öffnen und Schließen von Ventilen gesteuert wird. Nicht abgebildet ist der „Mund“-Aufsatz aus Gummi, der durch einen Rand mit nasenlochartigen Öffnungen mit dem „O“ verbunden ist. © digital.slub-dresden.de Vor der Jahrhundertwende schufen noch mehrere andere Menschen sprechende Köpfe. Unter ihnen war ein ungarischer Ingenieur namens Wolfgang von Kempelen, der im Alter von 21 Jahren von Kaiserin Maria Theresia angestellt wurde, um am Heiligen Römischen Hof zu arbeiten. Der Türke: Diese Maschine scheint in der Lage zu sein, ein wettbewerbsfähiges Schachspiel gegen einen menschlichen Gegner zu spielen, aber tatsächlich ist sie nur eine ausgeklügelte Simulation mechanischer Automatisierung: Ein menschlicher Schachmeister, der in einem Schrank versteckt ist, steuert den Turk-Roboter von unten über eine Reihe von Hebeln. © digital.slub-dresden.de Im Jahr 1769 wurde er durch die Erfindung einer schachspielenden türkischen Marionette berühmt (in deren Innerem geschickt ein äußerst geschickter menschlicher Schachspieler versteckt war). Jahrzehnte später begann Kempelen, die Geheimnisse der klaren Sprache zu erforschen. Diagramm, das die Komponenten künstlicher und natürlicher Sprache aus Wolfgang von Kempelens „Der Mechanismus der Sprache“ (1791) darstellt. © digital.slub-dresden.de Im Jahr 1791 veröffentlichte er „A Summary of a Talking Machine“ und berichtete, dass er Blasebälge und Resonatoren an Instrumente angeschlossen hatte, die der menschlichen Stimme ähnelten, etwa an Oboe und Klarinette. Er versuchte auch, die menschliche Stimme so zu modifizieren, dass sie Orgelpfeifen spielen konnte, wie es Kratzenstein getan hatte. In seinen zwanzig Jahren des Experimentierens war er stets davon überzeugt, dass „Sprache imitiert werden kann“. Das resultierende Gerät hatte einen Blasebalg als Lunge, eine Stimmritze aus Elfenbein, einen Stimmapparat aus Leder mit einer Zunge mit Scharnier und einen Mund mit einer Mundplatte aus Gummi, deren Resonanz durch Öffnen und Schließen eines Ventils verändert werden konnte, sowie zwei kleine Schläuche, die als Nasenlöcher dienten. Am Gerät befinden sich zwei Hebel, die mit der Pfeife verbunden sind und ein dritter Hebel ist mit einem Draht verbunden, der auf das Rohrblatt gelegt werden kann. Diese ermöglichen die Erzeugung von Liquid- und Frikativlauten: Ss, Zs und Rs. Diese Maschine erinnert an Vaucansons Entdeckung, dass der Blasdruck für eine bestimmte Note von der vorherigen Note abhängt. Kempelen berichtete, dass er zunächst versuchte, jeden Laut eines gegebenen Wortes oder einer gegebenen Phrase unabhängig auszusprechen. Dies sei ihm jedoch nicht gelungen, weil aufeinanderfolgende Laute sich aneinander anpassen müssten, um richtig ausgesprochen zu werden: „Die Verständlichkeit von Sprachlauten zeigt sich nur in ihrem proportionalen Verhältnis zueinander und in ihrer Verbindung zu ganzen Wörtern und Phrasen.“ Als Kempelen seiner maschinenartigen Sprache lauschte, wurde ihm eine weitere Grenze der Mechanisierung der Sprache bewusst: ihre Abhängigkeit vom Kontext. Kempelens Maschine war nur mäßig erfolgreich. Berichten zufolge zwitscherte es mit seiner kindlichen Stimme Vokale und Konsonanten, äußerte Wörter wie „Mama“ und „Papa“ und lallte Sätze wie „Du bist mein Freund – ich liebe dich von ganzem Herzen“, „Meine Frau ist meine Freundin“ und „Komm mit mir nach Paris“. Heute wird die Maschine im Deutschen Museum in München aufbewahrt. Kempelen und seine Unterstützer betonten, dass das Gerät nicht perfekt sei und an sich keine echte Sprechmaschine darstelle, sondern vielmehr ein Gerät, das die Möglichkeit demonstriere, eine Sprechmaschine zu bauen. Nach dieser Boomphase in den 1770er, 1780er und 1790er Jahren nahm das Interesse an Sprachsimulation ab. Mehrere Menschen im 19. Jahrhundert, darunter die Erfinder Charles Wheatstone und Alexander Graham Bell, bauten ihre eigenen Versionen von Sprechmaschinen. Doch die Entwickler künstlicher Sprache haben ihre Aufmerksamkeit größtenteils wieder der Sprachsynthese und nicht der Simulation zugewandt: Sie reproduzieren die Klänge der menschlichen Sprache mit anderen Mitteln, statt zu versuchen, die tatsächlichen Stimmorgane und physiologischen Mechanismen zu reproduzieren. Im Jahr 1828 schrieb Robert Willis, Professor für angewandte Mechanik in Cambridge, der zuvor die Möglichkeit intelligenter Schachroboter verworfen hatte, verächtlich, dass die meisten Leute, die sich mit Vokalen beschäftigen, „anscheinend nie über die Stimmorgane hinausgegangen sind, um ihren Ursprung zu erforschen“, und nahm offenbar an, dass Vokale ohne Stimmorgane nicht existieren könnten. Mit anderen Worten betrachteten sie Vokale als „eine physiologische Funktion des menschlichen Körpers“ und nicht als „einen Zweig der Akustik“. Willis glaubte, dass Vokale auch auf andere Weise erzeugt werden könnten. Ob die Stimmorgane selbst künstlich simuliert werden können, ist mittlerweile eine andere Frage als die Frage, ob die Laute der Sprache reproduziert werden können. Noch im Jahr 1850 schrieb der französische Physiologe Claude Bernard in seine Notizbücher: „Der Kehlkopf ist der Kehlkopf, die Linse ist die Linse, das heißt, ihre mechanischen oder physikalischen Bedingungen können nur in einem lebenden Körper realisiert werden.“ Josef Fabers sprechender Kopf Euphonia. © wikimedia Die Enttäuschung über die Sprachsimulation war so groß, dass niemand darauf achtete, als der deutsche Einwanderer Joseph Faber Ende der 1840er Jahre in die USA einen ziemlich beeindruckenden sprechenden Kopf entwarf. Fabers sprechende Köpfe basierten auf den Modellen von Kempelen und Mikael, waren jedoch viel komplexer. Es hat einen menschlichen Kopf und Oberkörper, wiederum als Türke verkleidet, mit Blasebalg, Stimmritze, Zunge, variabler Resonanzkammer und einem Mund mit Kiefer und Wangen aus Gummi. Die Maschine konnte alle Vokale und Konsonanten erzeugen und war über Hebel mit einer Tastatur mit 17 Tasten verbunden, die Faber wie ein Klavier spielen konnte. Faber führte die Maschine erstmals 1844 in New York City vor, erregte jedoch wenig öffentliches Interesse. Anschließend brachte er es nach Philadelphia, wo es ebenfalls nur verhaltene Resonanz fand. PT Barnum fand Faber in Philadelphia, nannte die Maschine Euphonia und ging damit auf Tournee nach London, aber selbst Barnum konnte ihr keinen Erfolg bescheren. Schließlich wurde Euphria Ende der 1870er Jahre in Paris ausgestellt und bald darauf verschwanden alle Berichte darüber. Die Zeiten der Talking Heads sind vorbei. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wandten sich die Designer künstlicher Sprachen von der mechanischen zur elektronischen Sprachsynthese ab. Die Simulation des Stimmapparats und des Sprechvorgangs – die zitternde Stimmritze, der plastische Stimmtrakt, die geschmeidige Zunge und der Mund – war ein Phänomen, das spezifisch für die letzten Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts war, als Philosophen und Mechaniker für kurze Zeit von der Idee besessen waren, dass artikulierte Sprache eine Körperfunktion sei und dass Descartes’ Kluft zwischen Geist und Körper durch den Stimmapparat überbrückt werden könne. Von Jessica Riskin Tempura Korrekturlesen/Rabbits leichte Schritte Originalartikel/publicdomainreview.org/essay/early-androids-and-artificial-speech/ Dieser Artikel basiert auf der Creative Commons License (BY-NC) und wird von Tempura auf Leviathan veröffentlicht Der Artikel spiegelt nur die Ansichten des Autors wider und stellt nicht unbedingt die Position von Leviathan dar |
>>: Menschen, die regelmäßig Fisch essen, leben länger!
Artikel empfehlen
Der maximale Rabatt von "Deyuanlang" beträgt bis zu 30.000, aber das 1,6-Liter-Modell ist immer noch nicht die beste Wahl
Unter den Internetnutzern hatte Lavida schon imme...
China Passenger Car Association & Anluqin: Der neue vier Modernisierungsindex für Personenkraftwagen im Dezember 2021 beträgt 69,4
Der Passenger Car New Four Modernizations Index, ...
Lehrer der Zhejiang-Universität konnte Herzstillstand erfolgreich verhindern. Wie kann eine Erfolgsquote von weniger als 1 % erreicht werden?
Am Abend des 2. September spielte die medizinisch...
Wann ist die beste Zeit zum Seilspringen zum Abnehmen?
Seilspringen ist eine sehr verbreitete Methode zu...
Können wir die Frühlingszwiebeln essen?
Jeden Sommer ist in Yunnan Pilzsaison. In den let...
Neue Fortschritte! Der längste Unterwasser-Straßentunnel der Welt beginnt seine „Reise durchs Meer“!
Am 26. Januar wurde mit dem Bau des zweiten Unter...
Baidu investiert strategisch in Uber
Eröffnung eines neuen Modells für die chinesisch-...
EPA schockiert Automobilindustrie mit Vorschlag, Kraftstoffeffizienzstandards vorzeitig festzulegen
Jüngsten Berichten ausländischer Medien zufolge h...
Der kumulierte Jahresabsatz von Honda China wird im Jahr 2023 1.234.181 Einheiten betragen, ein Rückgang von mehr als 10 % gegenüber dem Vorjahr.
Kürzlich berichteten inländische Medien, dass die...
Ist es hygienischer, die Bettdecke gleich nach dem Aufstehen zusammenzulegen? 10 Lebensstile, die gesund erscheinen, aber tatsächlich ungesund sind. Wie viele davon hast du?
Ist es hygienischer, die Bettdecke gleich nach de...
Wie trainiert man die Beine beim Fitness?
Fitness ist für uns in unserem täglichen Leben se...
Besuch im Apple Store in Hongkong: Schwarzhändler stürmen in Scharen, um das iPhone 6 zu ergattern, und schockieren die Hongkonger
Mit der kürzlichen Markteinführung des iPhone 6 k...
Was sollen wir tun, wenn auch der Ozean seine Haare verliert? Sein "Haarverpflanzer" entpuppte sich als Seetang
Produziert von: Science Popularization China Auto...
Wie entstehen Wassertropfen, die fast überall sind? Das Prinzip der Tröpfchenbildung ist nicht einfach
Der Autor oder die Quelle dieses Artikels oder se...
Achten Sie nach der College-Aufnahmeprüfung auf die versteckten Dinge in Meeresfrüchten
Nach der College-Aufnahmeprüfung können die Leute...