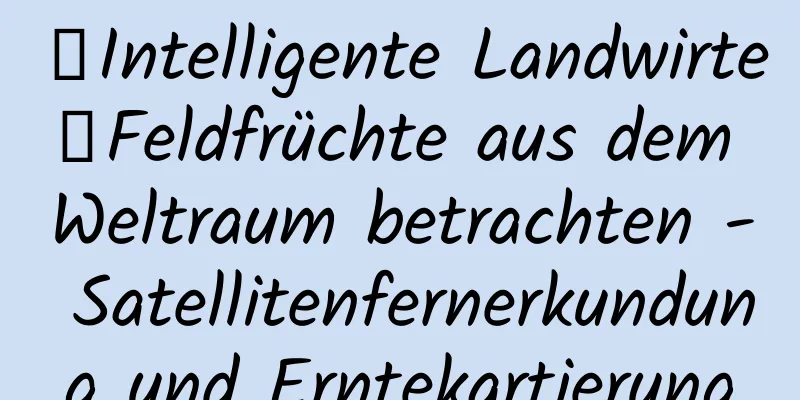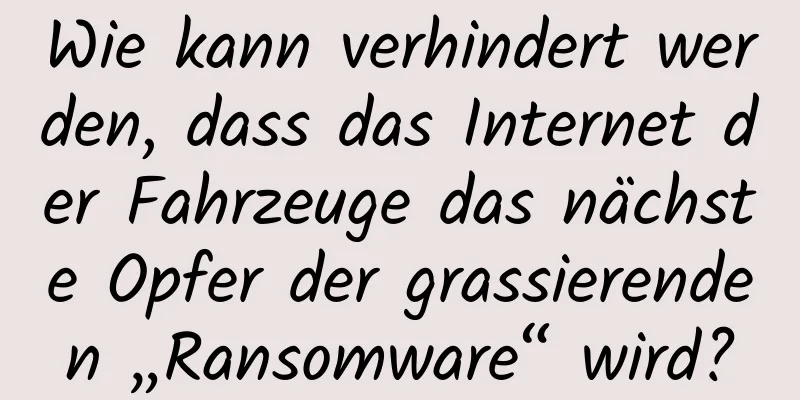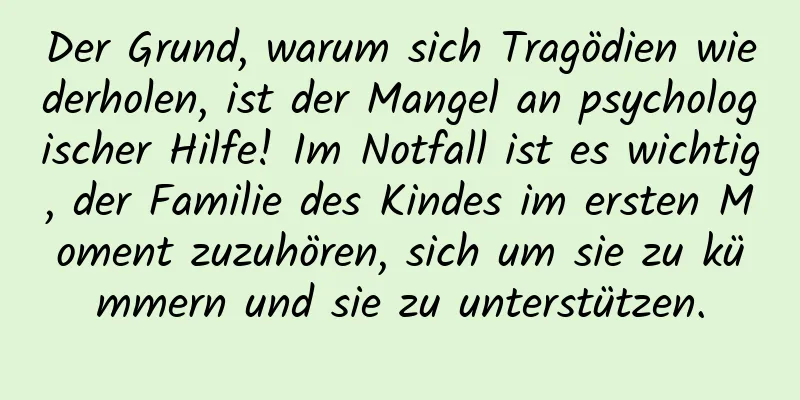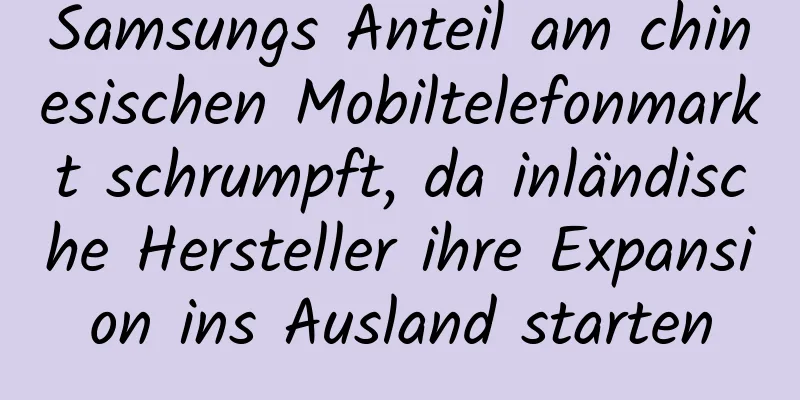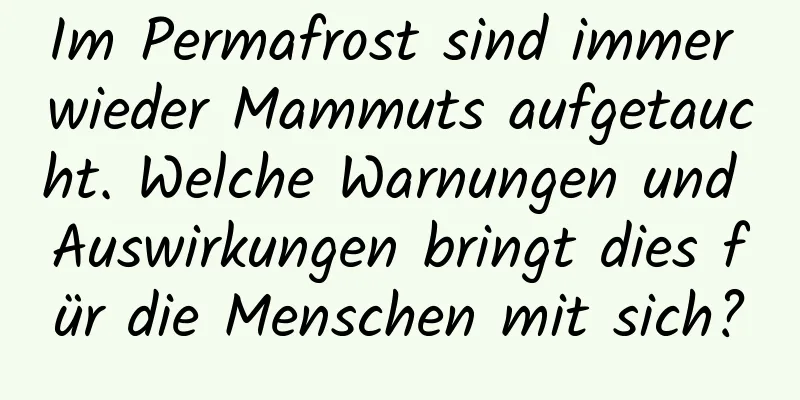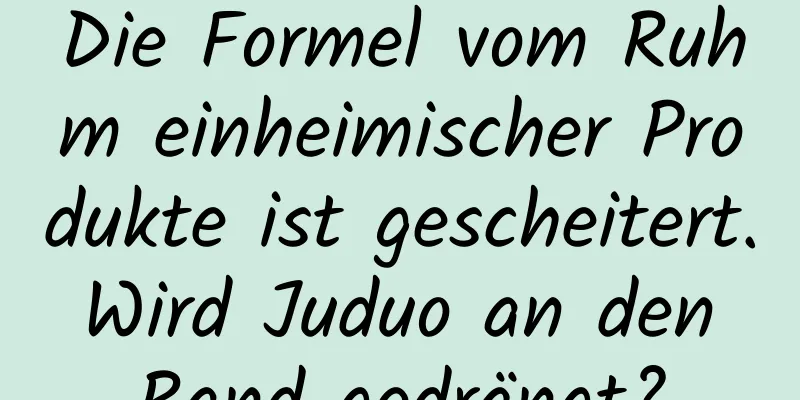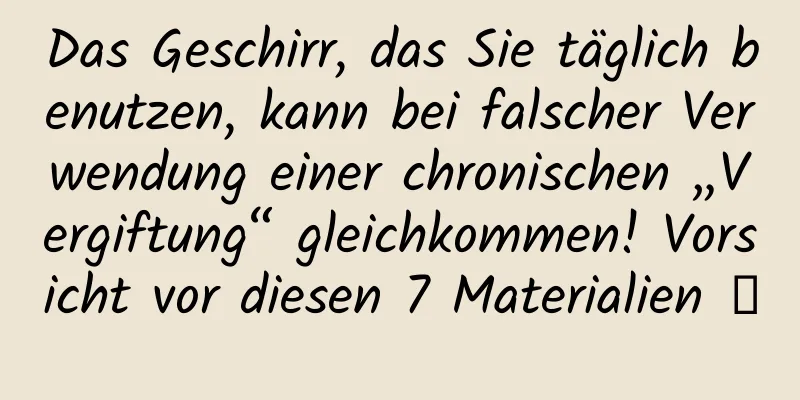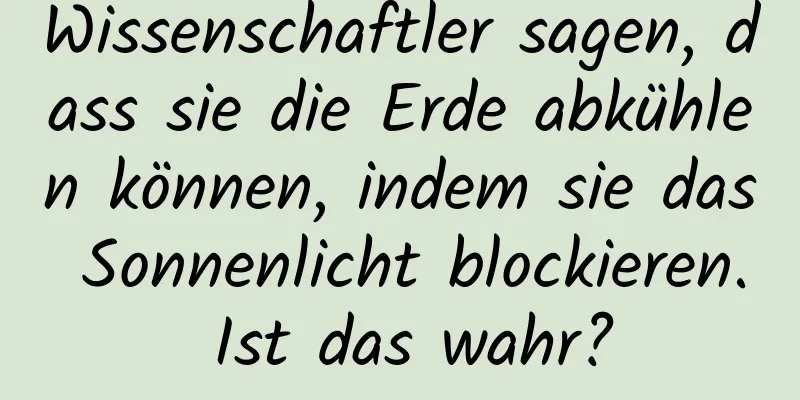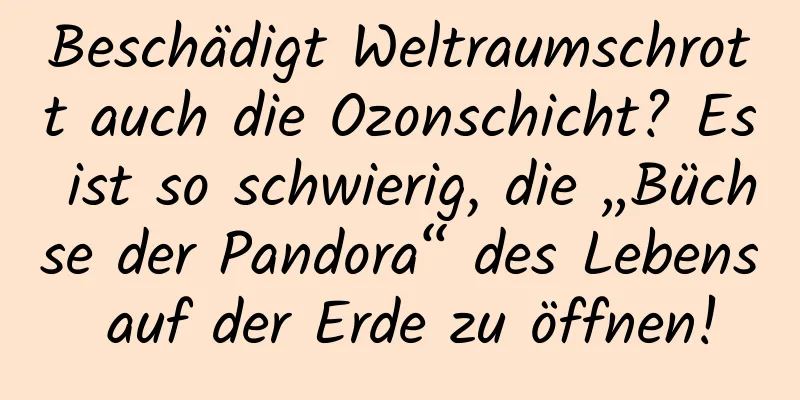Dieser „Aktivkohleschwamm“ kann Kohlendioxid in der Luft direkt „auffangen“.
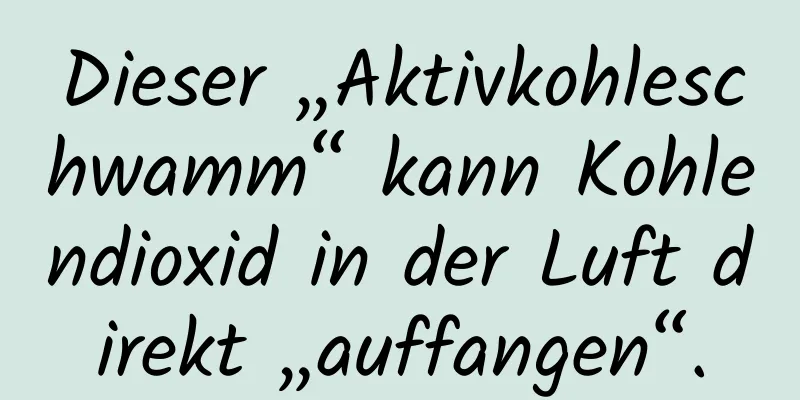
|
Produziert von: Science Popularization China Autor: Guo Fei (Yantai-Universität) Hersteller: China Science Expo Anmerkung des Herausgebers: Um die neuesten Entwicklungen in Spitzenwissenschaft und -technologie zu verstehen, hat das Spitzenwissenschafts- und -technologieprojekt von China Science Popularization eine Artikelserie mit dem Titel „Hilfe beim Verstehen führender wissenschaftlicher Zeitschriften“ veröffentlicht, in der herausragende Artikel aus maßgeblichen Zeitschriften ausgewählt und so schnell wie möglich in einfacher Sprache interpretiert werden. Erweitern wir unseren wissenschaftlichen Horizont und genießen wir den Spaß an der Wissenschaft durch das Fenster der Top-Zeitschriften. Die Auswirkungen des Klimawandels auf die menschliche Gesellschaft und die natürliche Umwelt werden immer bedeutender. Die Reduzierung der Treibhausgasemissionen und die Eindämmung des Treibhauseffekts sind weltweiter Konsens. Regierungen und die wissenschaftliche Gemeinschaft erforschen aktiv verschiedene Lösungen, und die Technologie zur Kohlendioxidabscheidung und -speicherung ist einer der Schwerpunkte, der viel Aufmerksamkeit erregt hat. Kürzlich hat ein Forschungsteam der Universität Cambridge eine neue Methode entwickelt, bei der modifizierte Aktivkohle verwendet wird, um Kohlendioxid effizient und kostengünstig aus der Atmosphäre zu filtern. Dieser Durchbruch bietet neue Möglichkeiten, das immer schwerwiegendere Problem der globalen Erwärmung anzugehen und das Ziel der CO2-Neutralität zu erreichen. Vergleich der weltweit vorgeschlagenen CO2-Sequestrierung (alle unterschiedlichen Tiefen in Grau) mit dem, was erreicht wurde (alle unterschiedlichen Tiefen in Blau). Die Erfolgsquote beim Abfangen und Speichern liegt bei Erdgasverarbeitungsanlagen bei über 75 %, bei anderen Industrieprojekten bei etwa 60 % und bei Kraftwerken bei etwa 10 %. (Bildquelle: Wikipedia) Aktivkohle: die „Geheimwaffe“ in Heimwasserfiltern Aktivkohle, auch Aktivkohle oder Aktivkohlekohle genannt, ist eine poröse Substanz aus Kohlenstoffmaterial. Es wird normalerweise durch Karbonisieren kohlenstoffreicher Materialien wie Holz, Kohle, Kokosnussschalen usw. bei hohen Temperaturen und unter sauerstofffreien Bedingungen hergestellt. Während des Karbonisierungsprozesses werden Nicht-Kohlenstoffelemente aus den Rohstoffen entfernt und im Inneren eine große Anzahl von Mikroporen gebildet, wodurch die Aktivkohle eine große spezifische Oberfläche und hervorragende Adsorptionseigenschaften erhält. Die poröse Oberfläche von Aktivkohle (Bildquelle: Wikipedia) Eine der häufigsten Anwendungen von Aktivkohle sind Wasserfilter für den Haushalt. Es kann verschiedene Schadstoffe wie Chlor, organische Stoffe, Schwermetallionen usw. effektiv aus dem Wasser entfernen und sorgt so für sauberes und gesundes Trinkwasser. Außer im Bereich der Wasseraufbereitung wird Aktivkohle auch in vielen anderen Branchen eingesetzt, beispielsweise in der Luftreinigung, der Lebensmittelverarbeitung und der chemischen Produktion. Seine starke Adsorptionskapazität verdankt es seiner einzigartigen porösen Struktur: Die Oberfläche jedes Gramms Aktivkohle kann 500–1500 Quadratmeter erreichen, was der Fläche von zwei Tennisplätzen entspricht. Diese hochentwickelte Porenstruktur ermöglicht es, eine große Anzahl von Gas-, Flüssigkeits- oder Feststoffmolekülen zu adsorbieren und festzuhalten. Schematische Darstellung der Farbstoffadsorption durch Aktivkohle (der Becher rechts zeigt den Zustand vor der Adsorption) (Bildquelle: Wikipedia) Es waren die hervorragenden Adsorptionseigenschaften der Aktivkohle, die das Forschungsteam der Universität Cambridge inspirierten. Sie gehen davon aus, dass eine effiziente und wirtschaftliche Technologie zur Kohlenstoffabscheidung entwickelt werden kann, wenn es gelingt, Aktivkohle so zu modifizieren, dass ihre selektive Adsorptionskapazität für Kohlendioxid verbessert wird. Sie versuchten daher, ähnlich wie beim Aufladen einer Batterie ein spezielles elektrisches Feld auf die Aktivkohle anzuwenden, um deren Oberfläche mit Ladungen anzureichern und dadurch die Anziehungskraft geladener Kohlendioxidmoleküle zu erhöhen. Dies ist das Kernprinzip der „geladenen Aktivkohleschwamm“-Technologie. Kohlendioxid „abfangen“: das „letzte Mittel“ im Kampf gegen den Klimawandel Um den Trend der globalen Erwärmung einzudämmen, wurde im Pariser Abkommen das Ziel vorgeschlagen, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur in diesem Jahrhundert auf 2 °C zu begrenzen und eine Begrenzung auf 1,5 °C anzustreben. Dies bedeutet, dass die Menschheit in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts einen Netto-Null-Kohlendioxidausstoß erreichen muss, d. h. durch Maßnahmen wie Emissionsreduzierung und Kohlenstoffabscheidung ein Gleichgewicht zwischen Kohlendioxidemissionen und -abbau herstellen muss. Allerdings reicht es bei weitem nicht aus, den Kohlendioxidausstoß allein durch die Reduzierung des Verbrauchs fossiler Brennstoffe, die Verbesserung der Energieeffizienz und andere Maßnahmen zur Emissionsreduzierung zu kontrollieren. Der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC) schätzt, dass wir, um das 1,5-Grad-Temperaturkontrollziel zu erreichen, neben erheblichen Emissionsreduzierungen auch jedes Jahr 5 bis 11 Milliarden Tonnen Kohlendioxid aus der Atmosphäre entfernen müssen, bis 2050. Derzeit ist die Aufforstung die am häufigsten verwendete Methode zur Kohlenstoffentfernung, ihr Potenzial ist jedoch begrenzt und es ist schwierig, einen derart großen Bedarf zu decken. Daher kommt der Entwicklung effizienter und skalierbarer Technologien zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung höchste Priorität zu. Dr. Alexander Fowles, der die Forschung zum „geladenen Aktivkohleschwamm“ leitete, räumte ein, dass die Abscheidung von Kohlendioxid aus der Atmosphäre das „letzte Mittel“ zur Bekämpfung des Klimawandels sein sollte. Schließlich ist dieser Sanierungsansatz nach dem Ereignis teurer und weniger effizient als die Reduzierung der Emissionen an der Quelle. „Aber angesichts der Schwere der Klimakrise ist dies etwas, das wir untersuchen müssen“, betonte Dr. Fowles. „Realistisch gesehen müssen wir alles tun, was wir können.“ Tatsächlich ist die Technologie zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (CCS) für die internationale Gemeinschaft zu einer der wichtigsten Optionen im Kampf gegen den Klimawandel geworden. Regierungen und Unternehmen weltweit steigern ihre Investitionen in CCS und setzen diese verstärkt ein. Die Internationale Energieagentur geht davon aus, dass CCS bis 2050 rund 13 Prozent zur weltweiten Emissionsreduzierung beitragen muss. Allerdings zielen die derzeitigen CCS-Technologien meist auf große Punktquellen wie Kraftwerke und Stahlwerke ab, während es an wirtschaftlichen und effizienten Mitteln mangelt, um verstreute mobile Quellen und Kohlendioxid in der bestehenden Atmosphäre abzuscheiden. Genau dies ist die Motivation für die Forschung zum „geladenen Aktivkohleschwamm“. Methode zur Nutzung von Gelände und Umwelt zur Absorption und Fixierung von Kohlendioxid, das von Wärmekraftwerken ausgestoßen wird (Bildquelle: Wikipedia) Aktivkohle „aufladen“: einfacher und effizienter Herkömmliche CO2-Abscheidungsmaterialien wie aminofunktionalisiertes poröses Kieselgel, metallorganische Gerüste usw. müssen normalerweise bei Temperaturen von bis zu 900 °C regeneriert werden, um das adsorbierte CO2 zur Speicherung freizugeben. Dies verbraucht nicht nur enorme Mengen Energie, sondern kann auch zu einer schnellen Verschlechterung der Materialeigenschaften führen. Der vom Team der Universität Cambridge entwickelte „geladene“ Aktivkohleschwamm zeigte dagegen klare Vorteile. Die Studie ergab, dass die „aufgeladene“ Aktivkohle, nachdem sie Kohlendioxid adsorbiert hat, lediglich auf 90–100 °C erhitzt werden muss, um das aufgenommene Kohlendioxid wirksam freizusetzen. Diese Temperatur ist viel niedriger als bei herkömmlichen Materialien und kann durch industrielle Abwärme oder erneuerbare Energien (wie Solarenergie, Geothermie usw.) erreicht werden, was sie umweltfreundlicher und energiesparender macht. Darüber hinaus beginnt dieser Erwärmungsprozess im Inneren des Materials, wodurch eine lokale Überhitzung an der Oberfläche vermieden und die Energieeffizienz weiter verbessert wird. Wie also verbessert das „Aufladen“ die Fähigkeit von Aktivkohle, Kohlendioxid zu absorbieren? Die Forscher erklären, dass durch das Anlegen eines elektrischen Felds zusätzliche Ladungen auf die Oberfläche der Aktivkohle gelangen, wodurch diese eine stärkere elektrostatische Anziehungskraft auf die polaren Kohlendioxidmoleküle ausübt. Gleichzeitig kann das elektrische Feld auch die Porenstruktur der Aktivkohle verändern und so mehr Aufenthaltspunkte für die Adsorption von Kohlendioxidmolekülen schaffen. Die kombinierte Wirkung dieser Mechanismen verbessert die Adsorptionskapazität und Selektivität geladener Aktivkohle für CO2 erheblich. Erwähnenswert ist, dass der Ladevorgang selbst nicht kompliziert ist. Das Forschungsteam verwendete ein Gerät ähnlich einer Lithium-Ionen-Batterie, mit Aktivkohle als positiver Elektrode, metallischem Lithium als negativer Elektrode und einem dazwischen eingefüllten Elektrolyt. Durch Anlegen einer äußeren Spannung werden Lithiumionen in die Oberfläche der Aktivkohle eingelagert und bilden Oberflächenladungen. Das Gerät ist einfach im Design und leicht zu bedienen und dürfte eine kostengünstige Produktion in großem Maßstab ermöglichen. Schematische Darstellung des Prozesses der „Aufladung“ des Aktivkohlenetzes (Bildquelle: Referenz 1) Herausforderungen und Perspektiven Obwohl „geladener Aktivkohleschwamm“ bei der Kohlendioxidabscheidung gute Ergebnisse erzielt, müssen noch einige Herausforderungen bewältigt werden, um eine wirkliche industrielle Anwendung zu erreichen. Der erste ist die weitere Verbesserung der Adsorptionskapazität. Derzeit kann jedes Gramm geladene Aktivkohle bis zu 3–4 mmol Kohlendioxid adsorbieren, was noch ein Stück vom theoretischen Maximalwert entfernt ist. Das Forschungsteam verbessert die Adsorptionsleistung von Aktivkohle durch Optimierung ihrer Porenstruktur, der chemischen Oberflächeneigenschaften und anderer Methoden. Das zweite Problem ist die Langzeitstabilität des Materials. Wiederholte Adsorptions-Regenerationszyklen können zu Leistungseinbußen wie beispielsweise einem Kollaps der Aktivkohleporen und einem Verlust der Oberflächenladung führen. Wie sichergestellt werden kann, dass das Material auch nach mehrmaligem Gebrauch noch eine effiziente Adsorption aufweist, ist ein schwieriges Problem, das überwunden werden muss. Die Forscher planen, die Struktur und chemische Stabilität der Aktivkohle durch Oberflächenbeschichtung, Dotierung und andere Maßnahmen zu verbessern. Darüber hinaus ist die Skalierung der Technologie mit zahlreichen Herausforderungen verbunden, beispielsweise im Hinblick auf Reaktordesign, Systemintegration und Kostenkontrolle. Die Ausweitung der Probenvorbereitung im Labor auf die industrielle Produktion erfordert Optimierung und Innovation bei Materialien, Prozessen, Geräten und anderen Aspekten, was konzertierte Anstrengungen und kontinuierliche Investitionen seitens der Industrie, der Hochschulen und der Forschung erfordert. Trotz der Herausforderungen ist die Technologie des „geladenen Aktivkohleschwamms“ weiterhin vielversprechend. Es weist eine neue Richtung für die Entwicklung effizienterer und umweltfreundlicherer Materialien zur Kohlenstoffabscheidung. Dr. Fowles sagte, dass diese Strategie nicht auf Aktivkohle beschränkt sei, sondern auch auf andere poröse Materialsysteme zur Gastrennung und -reinigung in verschiedenen Bereichen ausgeweitet werden könne. CCS erfährt als einer der wichtigsten Wege zur Erreichung des Ziels der CO2-Neutralität große Aufmerksamkeit seitens Regierungen, Industrie und Wissenschaft. Das Aufkommen des „geladenen Aktivkohleschwamms“ hat diesem Bereich zweifellos neue Vitalität verliehen. Ihre Einfachheit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit dürften die Entwicklung und Verbreitung der CCS-Technologie fördern und einen Beitrag zur Reaktion der Gesellschaft auf die Herausforderungen des Klimawandels leisten. Quellen: 1. Kohlendioxid mit geladenen Sorbentien aus der Luft abscheiden. Huaiguang Li, Mary E. Zick, Teedhat Trisukhon, Matteo Signorile, Xinyu Liu, Helen Eastmond, Shivani Sharma, Tristan L. Spreng, Jack Taylor, Jamie W. Gittins, Cavan Farrow, S. Alexandra Lim, Valentina Crocellà, Phillip J. Milner und Alexander C. Forse 2. Wissenschaftler laden „Kohleschwamm“ auf, um CO2 aufzusaugen. BBC-Nachrichten 3. Forscher aus Cambridge stellen „elektrischen Schwamm“ zur CO2-Bindung vor. Dominic Ellis 4. Science and Technology Daily: Gibt es eine Möglichkeit, Kohlendioxid direkt aus der Luft zu „fangen“? |
>>: @Lehrer, Schüler und Eltern: 42 Sicherheitstipps für den Sommer, unbedingt lesen!
Artikel empfehlen
Im Zeitalter des mobilen Lesens wird Online-Literatur das Verkaufsmodell per Wort durchbrechen
Im Zeitalter des mobilen Internets können nur qua...
Kommen uns Sexroboter näher? Die Realität ist viel komplizierter als gedacht
Der Einsatz von Robotern in sexuellen Beziehungen...
Kann Yoga wirklich beim Abnehmen helfen?
In der heutigen Gesellschaft gibt es tatsächlich ...
Bei welchem Test hat die Grafikkarte den höchsten Stromverbrauch? Diese 20 Punkte können Ihnen die Antwort geben
In letzter Zeit haben viele Internetnutzer unseren...
Warum kreisen Motten gerne um Lichter?
Vielleicht können wir uns eine solche Szene vorst...
Was sind die grundlegenden Yoga-Bewegungen zur Reduzierung von Bauchfett?
Unser Leben wird heute immer komfortabler, wir es...
Stimmt es, dass Seilspringen beim Abnehmen helfen kann?
Heutzutage achten wir mehr auf unsere körperliche...
Eine gute Show. Warum kommt es immer wieder zu einer Trennung und Wiederaufnahme der Weltraumkooperation zwischen Russland, den USA und Europa?
Vor einiger Zeit haben die USA und Europa zahlrei...
Echte Szene oder KI-generiert? Die Adleraugen zum Erkennen von „Vincent-Videos“ sind da! Die Genauigkeitsrate liegt bei 93,7 %
Heutzutage verändern KI-Tools zur Videoerstellung...
Reise zum Jupiter, um Wasser zu finden
Einleitende Worte Wie leben Astronauten im Weltra...
Der Verzehr von Vollkornprodukten hat viele Vorteile! Die Top 10 der besten Getreidesorten haben wir für Sie zusammengefasst!
Getreide ist ein allgemeiner Begriff für Nahrungs...
Wie kann ich meine Taille und meinen Bauch effektiv verschlanken?
Um abzunehmen, essen viele Mädchen nicht pünktlic...
Wie Internetanbieter den Markt für intelligente Terminals verändern
Vor Kurzem gab Damai Technology seinen offizielle...
Wie kann man durch Training größer werden?
Es gibt verschiedene Arten, im Leben Sport zu tre...
Wie viele Kalorien verbrennt man, wenn man zwei Stunden lang geht?
Heutzutage sind die materiellen Bedingungen der M...