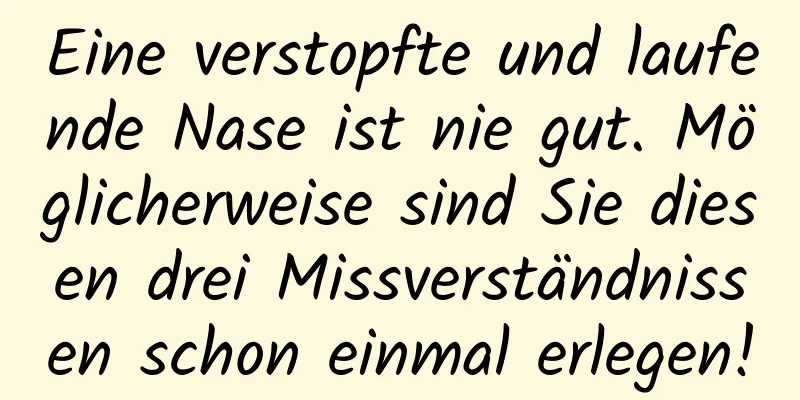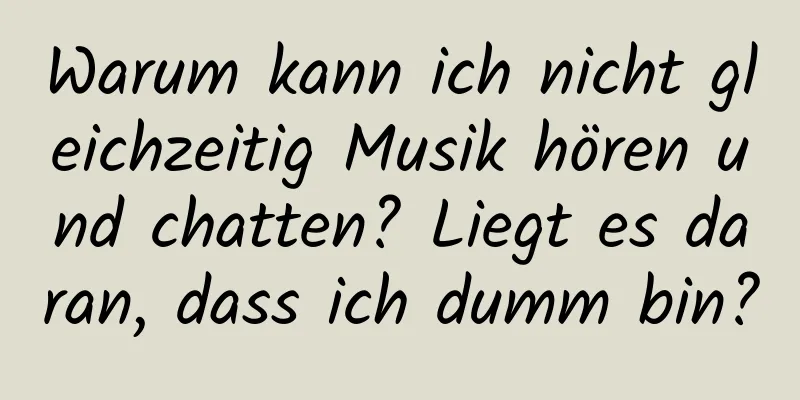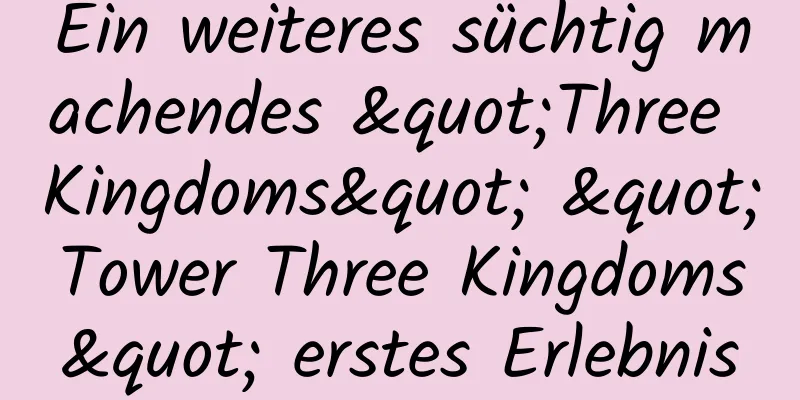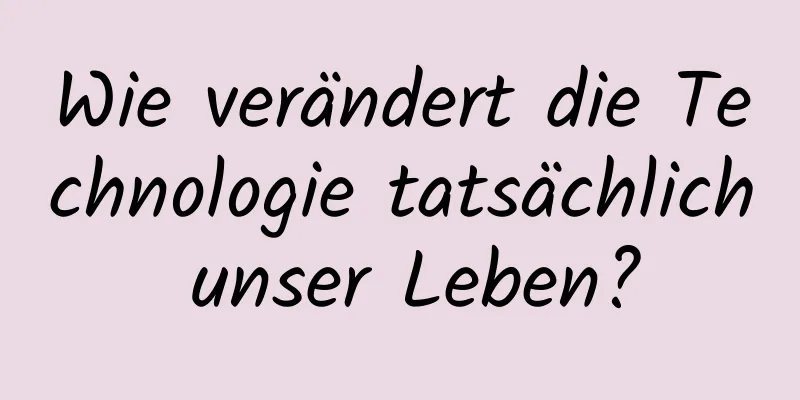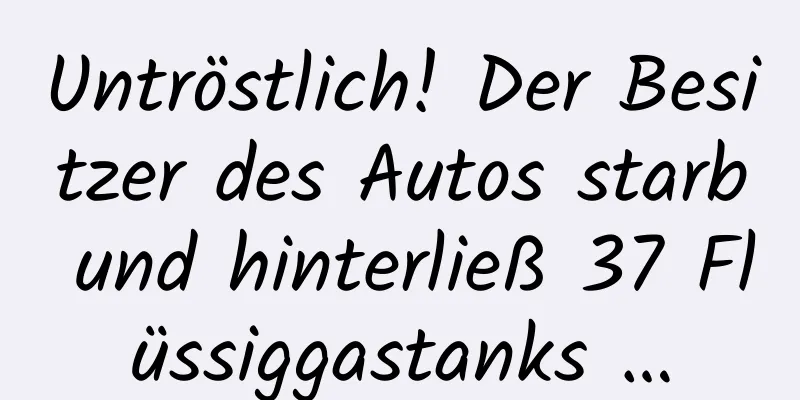„Vermüllung“ im Weltraum? Bußgeld! Bußgeld!
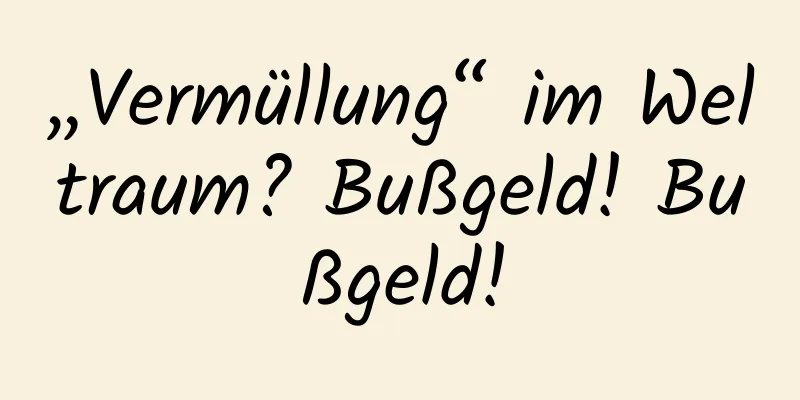
|
Im Oktober 2023 verhängte die Federal Communications Commission erstmals eine Geldstrafe in einem Fall von Weltraummüll: Ein amerikanisches Unternehmen wurde zur Zahlung von 150.000 Dollar aufgefordert, nur weil es einen toten Satelliten nicht in eine Friedhofsumlaufbahn gebracht hatte. Mit der rasanten Entwicklung der menschlichen Weltraumaktivitäten ist das Sicherheitsproblem des Weltraummülls immer dringlicher geworden und die internationale Überwachung wurde immer strenger, doch sind dadurch auch neue Anforderungen auf dem Weltraummarkt entstanden. Zu diesem Zweck erforschen die Weltraumstreitkräfte verschiedener Länder unterschiedliche Methoden zur Beseitigung und Eindämmung von Weltraummüll. Darstellung dicht verteilter Raumfahrzeuge und Weltraumschrotts um die Erde Die Bedrohung durch Weltraummüll kann nicht ignoriert werden Mit dem in diesem Artikel erwähnten Weltraummüll ist insbesondere der sogenannte „Weltraumschrott“ gemeint, der hauptsächlich aus nutzlosen, von Menschenhand geschaffenen Objekten und deren Überresten besteht, die bei menschlichen Weltraumaktivitäten übrig geblieben sind. Dazu gehören ausrangierte Raketenoberstufen, Satelliten und deren verschiedene Komponenten. Dieser Weltraummüll kann aus zahlreichen von Menschen und anderen Menschen verursachten Weltraumaktivitäten stammen, beispielsweise aus der Außerdienststellung von Raumfahrzeugen, Unfällen und Tests kinetischer Abfangwaffen. Seit dem erfolgreichen Start des ersten künstlichen Satelliten im Oktober 1957 haben sich unvollständigen Statistiken zufolge fast 10.000 Tonnen künstlicher Weltraumobjekte in der Erdumlaufbahn angesammelt, von denen nur etwa 5 % normal funktionierende Raumfahrzeuge sind und der Rest im Allgemeinen aus verschiedenen Arten von Weltraummüll besteht. Überwachungen zeigen, dass die Zahl der Weltraumtrümmer, die größer als 1 cm sind, in die Millionen geht, und die Zahl kleinerer Trümmer könnte in die Milliarden gehen. In den letzten Jahren hat die Menge an Weltraummüll rapide zugenommen. Gründe hierfür sind neben den häufigeren menschlichen Weltraumaktivitäten auch die vermehrten Kollisionen zwischen Weltraummüll und Raumfahrzeugen. Da die Zahl der durch Weltraumstarts erzeugten Objekte und Trümmer jährlich zunimmt, steigt auch die Wahrscheinlichkeit von Kollisionen mit Trümmern, die wiederum noch mehr Trümmer erzeugen und so einen Teufelskreis auslösen. Schockierende Darstellungen der Bedrohung durch Weltraummüll In den 1970er Jahren schlug der NASA-Wissenschaftler Donald Kessler sogar das Konzept des „Kessler-Effekts“ vor. Er argumentierte, dass, wenn die Menge des Weltraummülls einen bestimmten kritischen Punkt erreicht, dies eine Kette von Kollisionen im Orbit auslösen würde, was es Raumfahrzeugen unmöglich machen würde, sicher im Weltraum zu operieren. Im Allgemeinen treten Weltraumobjekte mit Umlaufhöhen unter 300 Kilometern innerhalb relativ kurzer Zeit wieder in die Atmosphäre ein und verglühen dort. Weltraumschrott mit Umlaufhöhen über 600 Kilometern kann jedoch theoretisch Jahrzehnte oder sogar Hunderte von Jahren existieren. Sie sind nicht gleichmäßig verteilt, sondern konzentrieren sich hauptsächlich auf Gebiete mit hoher Satellitendichte, nämlich auf niedrige Umlaufbahnen in einer Höhe von unter 2.000 Kilometern, geosynchrone Umlaufbahnen und Umlaufbahnen in der mittleren Erdnähe. Im Jahr 1993 initiierten mehrere Weltraumagenturen, darunter die Vereinigten Staaten, Russland und Japan, gemeinsam die Einrichtung des Inter-Agency Space Debris Coordination Committee, dessen Ziel es ist, die Aktionen der Weltraumstreitkräfte verschiedener Länder zu koordinieren und gemeinsam das Problem des Weltraummülls zu lösen. Ende 2012 stellte das Komitee in seinem Bericht „Zukünftige Stabilität der Umgebung niedriger Umlaufbahnen“ fest, dass in einigen Gebieten niedriger Umlaufbahnen die Menge an Weltraummüll zu groß und nicht mehr stabil sei und die Zahl der durch Kollisionen erzeugten Trümmer die Zahl der Fragmente übersteigen werde, die auf natürliche Weise verschwinden. Mit der beschleunigten Einführung groß angelegter kommerzieller Konstellationen in niedrigen Umlaufbahnen wird erwartet, dass in naher Zukunft Zehntausende von Satelliten in die Umlaufbahn gebracht werden. Sie werden im Allgemeinen in einer niedrigen Erdumlaufbahn eingesetzt, was die Steuerung erheblich erschwert und das Risiko einer Kollision mit Raumfahrzeugen erhöht. Eine Studie der Swiss Re zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Satellit mit einer Querschnittsfläche von 10 Quadratmetern jedes Jahr mit Weltraumschrott mit einem Durchmesser von mehr als einem Zentimeter kollidiert, bei mehr als eins zu zehntausend liegt. Das Joint Space Operations Center des US-Militärs gibt im Durchschnitt täglich Dutzende von Kollisionswarnungen im Orbit heraus, und Raumfahrzeuge müssen jedes Jahr mehr als 100 Versuche zur Kollisionsvermeidung durchführen. Weltraummüll kann Geschwindigkeiten von über 7 km/s erreichen und seine kinetische Energie reicht aus, um eine enorme Bedrohung für Raumfahrzeuge im Orbit darzustellen. Gemäß dem gängigen Schutzniveau aktueller Raumfahrzeuge kann eine Kollision mit Weltraummüll mit einem Durchmesser von mehr als 1 cm zu Schäden am Raumfahrzeug führen. Ende 1991 kollidierten zwei außer Betrieb befindliche russische Satelliten, wobei einer in zwei Teile zerbrach und der andere in eine große Menge nicht mehr verfolgbarer Trümmer zerfiel. Am 24. Juli 1996 schlugen Trümmer einer Ariane-Rakete der ESA mit einer Relativgeschwindigkeit von 14,8 km/s in den Gravitationsgradientenstabilisator des französischen elektronischen Aufklärungssatelliten Cherry ein, wodurch dieser die Kontrolle über seine Lage verlor. Am 10. Februar 2009 kollidierte der russische Satellit Cosmos-2251 mit dem US-Satelliten Iridium 33 bei einer Relativgeschwindigkeit von 11,64 km/s. Dabei entstanden über 2.200 Weltraumschrottteile, die überwacht und katalogisiert werden konnten und eine enorme Bedrohung für die anderen 66 Iridium-Satelliten in der Region darstellten. Berichten zufolge müssen die optischen Bildgebungssatelliten der europäischen SPOT-Serie mindestens viermal im Jahr ihre Umlaufbahn wechseln, um „Angriffe“ durch Weltraummüll zu vermeiden. Große Raumfahrzeuge wie die Internationale Raumstation müssen jedes Jahr mehrere Orbitalmanöver durchführen, um größerem Weltraumschrott auszuweichen. Die internationale Gemeinschaft widmet der Beseitigung und Eindämmung von Weltraummüll zunehmende Aufmerksamkeit. Im Juni 2021 schlug das Inter-Agency Space Debris Coordination Committee in der überarbeiteten Fassung der Space Debris Mitigation Guidelines vier Maßnahmen zur Eindämmung von Weltraummüll vor: Erstens: Begrenzen Sie die Entstehung von Weltraummüll durch Raumfahrzeuge im Orbit. Wenn dies nicht möglich ist, sollten Anzahl, Volumen und Verweildauer der erzeugten Trümmer im Orbit minimiert werden. Grundsätzlich sollten Länder keine Pläne für Weltraumaktivitäten durchführen, bei denen Weltraummüll entstehen könnte, es sei denn, eine Bewertung zeigt, dass ihre langfristigen Auswirkungen auf die Umlaufbahn und andere Raumfahrzeuge auf einem akzeptabel geringen Niveau bleiben. Zweitens: Minimieren Sie die Möglichkeit einer Zerstörung des Raumfahrzeugs im Orbit, sowohl während des normalen Betriebs des Raumfahrzeugs als auch nach der Mission, und vermeiden Sie vorsätzliche Sabotage und andere schädliche Aktivitäten. Drittens sollte das Raumfahrzeug am Ende seiner Lebensdauer aus der Umlaufbahn genommen werden. Beispielsweise sollten Raumfahrzeuge in der geostationären Umlaufbahn in die Friedhofsumlaufbahn gebracht werden. Das Raumschiff in der erdnahen Umlaufbahn sollte in die Atmosphäre stürzen. Viertens: Versuchen Sie, Kollisionen von Raumfahrzeugen im Orbit zu vermeiden. Fünftens hat der Ausschuss der Vereinten Nationen für die friedliche Nutzung des Weltraums auf Grundlage der Leitlinien zur Eindämmung von Weltraummüll sieben Leitlinien zur Eindämmung von Weltraummüll formuliert, die im Großen und Ganzen mit den oben genannten Empfehlungen übereinstimmen. Maßnahmen zur Eindämmung von Raketenabfällen Im Allgemeinen verbleibt nur die Oberstufe einer Trägerrakete in der Erdumlaufbahn und wird zu Weltraumschrott. Um die Entstehung von Weltraummüll in diesem Bereich zu verlangsamen, müssen Luft- und Raumfahrtunternehmen eine Reihe von Maßnahmen ergreifen: Erstens sollte beim Abtrennen der Nutzlast von der Oberstufe der Rakete die Freisetzung von Weltraummüll so weit wie möglich reduziert werden. Anschließend sollte die Oberstufe der Rakete nach der Abtrennung der Nutzlast passiviert werden, um das Risiko einer Zersplitterung im Orbit und der Entstehung von Trümmern auszuschließen. Schließlich sollte die Oberstufe der Rakete die Betriebsumlaufbahn so weit wie möglich verlassen, um ihre Verweildauer im Orbit zu kontrollieren. Nachdem die letzte Stufe der Rakete ihre Mission, die Freisetzung ihrer Nutzlast, erfüllt hat, ist eine Passivierungsbehandlung erforderlich. Bei der sogenannten „Passivierung“ handelt es sich um die Freigabe des restlichen Treibstoffs und die Abgabe von Hochdruckgas, nachdem die letzte Stufe der Rakete ihre Mission erfüllt hat. Um den Erfolg der Mission sicherzustellen, verbleiben nach Abschluss der Weltraumstartmission üblicherweise Hunderte Kilogramm Resttreibstoff in der letzten Stufe der Rakete. Um die Entstehung von Weltraummüll zu verringern, muss die Funktion der Oberstufe der Rakete so eingerichtet werden, dass der verbleibende Treibstoff im Tank und das verbleibende Gas im Hochdruckgasbehälter rechtzeitig nach der Trennung von Satellit und Rakete entladen werden, um die potenzielle Gefahr einer Demontage im Orbit auszuschließen. Nachdem die letzte Stufe der Rakete ihre Mission erfüllt hat, besteht der Passivierungsprozess hauptsächlich darin, den verbleibenden Treibstoff durch eine spezielle Abgasleitung freizusetzen. In seinem internen Druck- und Abgabesystem muss ein Satz elektrischer Explosionsventile und Auslassrohre für Treibstoff und Oxidationsmittel hinzugefügt werden, durch die der im Tank verbleibende Treibstoff aus dem Raketenkörper abgelassen werden kann. Gleichzeitig muss sichergestellt werden, dass der Ablassplan keine negativen Auswirkungen auf die Startnutzlast der Rakete in die Umlaufbahn hat. Darüber hinaus muss bei der Passivierung der letzten Raketenstufe das durch die Treibstoffentladung erzeugte Abgasfeld analysiert werden, um den Entladungsplan zu optimieren und die Beeinträchtigung der Fluglage der Rakete zu minimieren. Gleichzeitig müssen Störungen und „Verschmutzungen“ von Satelliten und anderen Nutzlasten durch den Passivierungsprozess vermieden werden. Um sicherzustellen, dass der im Raketentank verbleibende Treibstoff nach der Trennung von Satellit (Schiff) und Rakete so schnell wie möglich entladen wird, müssen Treibstoffmanagementmaßnahmen ergriffen werden, damit der Treibstoff während des Entladevorgangs auf den Boden sinken kann. Konkret werden bei der Treibstoffsteuerung im Allgemeinen Lageregelungstriebwerke verwendet, um ein Trägheitskraftfeld zu bilden, das ein zuverlässiges Absinken des Treibstoffs auf den Boden ermöglicht. Durch Ausnutzung der beim Ablassen des restlichen Treibstoffs entstehenden Kraft kann zudem der Deorbiteffekt der Raketenendstufe deutlich verbessert werden. Unter dem sogenannten „Deorbiting“ versteht man die Methode, die Nutzlast durch die letzte Stufe der Rakete nach Abschluss der festgelegten Flugmission künstlich aus der Umlaufbahn zu räumen. Dazu führt es einen Manöverflug durch. Dabei handelt es sich um eine Methode zur Steuerung der Zeit, die die letzte Stufe der Rakete in der Umlaufbahn bleibt. Es gibt hauptsächlich zwei Arten der Deorbitierung: aktives Deorbiting und passives Deorbiting. Aktiver Deorbit bedeutet, dass die Oberstufe der Rakete nach Abschluss der Mission mithilfe des Antriebsgeräts Orbitalmanöver durchführt, allmählich langsamer wird und die Perigäumshöhe der Umlaufbahn senkt, die Nutzlastumlaufbahn verlässt oder direkt wieder in die Atmosphäre eintritt. Zu den Antriebselementen der letzten Raketenstufe zählen hier Flüssigtreibstofftriebwerke, Lageregelungstriebwerke oder Feststoffraketen. Beim passiven Deorbit handelt es sich um den Vorgang, die Umlaufbahn der letzten Stufe einer Rakete nach Abschluss der Mission mit Hilfe externer Kräfte abzusenken. Zu den wichtigsten technischen Mitteln zählen derzeit Vorrichtungen zur Erhöhung des Luftwiderstands, Sonnensegel und Orbitalkabel. Die Rakete kann mit einem Triebwerk mit Mehrfachzündungsmöglichkeiten und entsprechenden Unterstützungssystemen ausgestattet werden. Nach der Trennung von Satellit und Rakete (Raumschiff) wird der Motor erneut gezündet, um den aktiven Deorbit der letzten Raketenstufe durchzuführen. Den neuesten internationalen Trends zufolge lauten die Grundanforderungen für die Deorbitierung der letzten Raketenstufe: Die Deorbitierungsmaßnahmen für die letzte Raketenstufe dürfen die Zuverlässigkeit und Sicherheit der festgelegten Flugmission der Rakete nicht beeinträchtigen oder die damit verbundenen Risiken werden nach einer Bewertung als akzeptabel erachtet. Der deorbitierende Effekt der letzten Stufe der Rakete sollte so weit wie möglich mit den „Richtlinien zur Eindämmung von Weltraummüll“ übereinstimmen, die von der Weltraummüll-Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen zusammengestellt wurden. Diese besagt, dass „ein Raumfahrzeug nach Abschluss seiner Betriebsmission nicht länger als 25 Jahre in der Umlaufbahn bleiben darf“. Neue Luft- und Raumfahrtvorschriften einiger Länder und Organisationen haben kürzere Indikatoren für die Verweildauer im Orbit vorgeschlagen. und beim Deorbiting der letzten Raketenstufe soll sichergestellt werden, dass kein neuer Weltraumschrott entsteht. Maßnahmen zur Eindämmung von Satelliten-Weltraummüll Nachdem Satelliten und andere Nutzlasten die Erdumlaufbahn erreicht haben, entsteht Weltraummüll hauptsächlich auf vier Arten: Einer davon ist der Weltraummüll, der beim Eintritt in die Umlaufbahn entsteht. Einige Satelliten verwenden Apogäumstriebwerke mit Feststoffen, führen am Apogäum Bahnänderungsmanöver durch und gelangen schließlich in eine quasisynchrone Umlaufbahn. Anschließend löst sich der Motor vom Satelliten und wird zu einer wichtigen Quelle für Weltraummüll. Der zweite Grund ist der Weltraummüll, der während des Einsatzes entsteht. Satelliten verlieren während ihres Betriebs Abfall, wie etwa Befestigungen für elektrische Leitungen, Klemmmechanismen zum Ausfahren von Antennen, Hitzeschilde für die Triebwerke der Apogäumsraketen, Düsenabdeckungen für Feststofftriebwerke, Schutzabdeckungen für Nutzlasten, Sprengbolzen, Federn, Gurte usw. Der dritte Bereich ist der Weltraummüll, der durch das Ende seiner Lebensdauer entsteht, also Satelliten, die nicht rechtzeitig aus der Umlaufbahn genommen werden können, um wieder in die Erdatmosphäre einzutreten, oder die nach Ablauf ihrer Lebensdauer in eine Friedhofsumlaufbahn gelangen. Viertens gibt es Weltraummüll, der unter dem Einfluss der Weltraumumgebung entsteht. Im Weltraum sind verschiedene Umweltdämpfungsfaktoren komplex und wirken sich zwangsläufig negativ auf Raumfahrzeuge aus. Wenn sich beispielsweise die Farbschicht auf der Oberfläche ablöst, kann es zu Weltraumschrott werden. Man geht allgemein davon aus, dass Weltraummüll in niedrigen Erdumlaufbahnen aufgrund der Sonnenaktivität und des Luftwiderstands mit der Zeit wieder in die Atmosphäre eintritt und verglüht. Für Weltraummüll in hohen Erdumlaufbahnen ist dies jedoch möglicherweise nicht der Fall. Wenn wir also die Entstehung von Weltraummüll durch Satelliten und andere Nutzlasten verlangsamen wollen, sollten wir an der Quelle ansetzen. Zu den wichtigsten Maßnahmen zählen Passivierung, aktives Deorbiting und aktive Entfernung. Bei der Passivierung geht es darum, rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen, beispielsweise den Treibstoff und die Batterieleistung zu reduzieren, um künftige Explosionen ausgemusterter Satelliten und anderer Nutzlasten zu verhindern. Unvollständigen Statistiken zufolge entstand der größte Teil des Weltraummülls unter den etwa 550 bekannten Zerfallsunfällen von Satelliten und anderen Raumfahrzeugen im Orbit durch eine mangelhafte Passivierung der Raumfahrzeuge. Unter aktivem Deorbit versteht man das Verlassen der Arbeitsumlaufbahn von Satelliten und anderen Raumfahrzeugen mithilfe von Triebwerken, Ballons, Lichtsegeln und anderen Mitteln. Anschließend werden Satelliten in erdnahen Umlaufbahnen in die Atmosphäre abgesenkt und verglühen, während Satelliten in geosynchronen Umlaufbahnen in Friedhofsumlaufbahnen gehoben werden, um Raumfahrzeuge im Orbit vor dem Einschlag von Weltraummüll zu schützen oder zumindest das Risiko eines Aufpralls erheblich zu verringern. Traditionell erfordern sowohl Passivierungs- als auch aktive Deorbitierungsmaßnahmen, dass Satelliten und andere Raumfahrzeuge mit entsprechenden Hardwaremaßnahmen ausgestattet werden oder mehr Treibstoff mitgeführt wird, um sicherzustellen, dass die entsprechenden Operationen am Ende ihrer Lebensdauer durchgeführt werden können. Aufgrund verschiedener Faktoren stellt die Anzahl der Satelliten, die diese Maßnahmen ergreifen und internationale Standards erfüllen, jedoch nicht die absolute Mehrheit dar. Tatsächlich müssen bei der aktuellen Satellitenkonstruktion die Anforderungen zur Eindämmung von Weltraummüll berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass der Satellit nach Abschluss seiner Mission über die erforderlichen Entsorgungsmöglichkeiten verfügt und die Freisetzung von betriebsbedingtem Weltraummüll reduziert wird. Die konkreten Anforderungen gliedern sich im Wesentlichen in drei Aspekte. Während der Machbarkeitsstudienphase des Satellitenprogramms sollten potenzielle Risiken durch Weltraummüll in den frühen Phasen der Entwicklung von Satelliten in geostationärer Umlaufbahn bestätigt werden. Außerdem sollte ein operatives Konzept zur Eindämmung von Weltraummüll entwickelt werden, um die Anforderungen hinsichtlich der Resttreibstoffabgabe, der Batteriepassivierung, der Gasentladung in Hochdruckgasflaschen und der Entsorgung von Weltraummüll am Ende und nach Abschluss der Mission zu erfüllen. Während der Entwurfsphase sollte der Satellit Anforderungen an die Passivierungskonstruktion für das Energiespeichersystem oder die einzelne Maschine haben, die den Batteriesatz des Stromversorgungssystems, das Schwungradsystem des Steuerungssystems und das Antriebssystem betreffen; Es sollten Anforderungen zur Eindämmung der Entstehung von Weltraummüll während des Betriebs vorhanden sein, wie etwa der Austausch der abnehmbaren strahlungsgekühlten Abdeckung gegen eine ausfahrbare Abdeckung. Es sollte über eine Möglichkeit verfügen, die verbleibende Menge an Treibmittel und Druckgas zu messen. Dabei sollte die für die Deorbitkontrolle erforderliche Treibstoffreserve berücksichtigt werden, beispielsweise die Anhebung des Orbitperigäums des Satelliten um 200 Kilometer, was eine Geschwindigkeitssteigerung von 11 Metern pro Sekunde erfordert. Auch bei der Werkstoffauswahl für die Satellitenkonstruktion müssen die Forscher ihre Auswahl optimieren und Materialien und Verfahren auswählen, bei denen die Wahrscheinlichkeit einer Entstehung von Weltraummüll geringer ist. Beispielsweise werden Verbundwerkstoffe zur Herstellung von Hochdruckgasflaschen und Lagertanks verwendet und durch Strahlungs-, Aufprall-, Temperaturwechsel- und andere Tests werden Materialien und Verfahren ausgewählt, die die Entstehung von Weltraummüll im großen Maßstab verhindern können. Die Maßnahmen zur aktiven Entfernung variieren Studien haben gezeigt, dass fast ein Drittel des katalogisierten Weltraummülls in der Erdumlaufbahn durch die zehn größten Desintegrationsereignisse im Weltraum verursacht wird. Um die Entstehung von Weltraummüll aktiv zu verhindern, ist es daher notwendig, den Weltraummüll in der Umlaufbahn zu kontrollieren. Wenn größere Weltraumtrümmer entfernt werden können, wird sich die Weltraumumgebung deutlich verbessern und das Auftreten von „Kettenkollisionen“ wird wirksam eingedämmt. Unvollständigen Statistiken zufolge befinden sich mehr als 10 % der ausgemusterten Satelliten in der geostationären Umlaufbahn entweder noch an ihrem Platz oder ihre Umlaufbahnen werden nicht hoch genug angehoben. In niedrigen Erdumlaufbahnen verfügen viele Satelliten nicht über die Möglichkeit, nach Außerdienststellung die Umlaufbahn zu ändern und können die Umlaufbahn nicht aktiv verlassen. Ausländische Luft- und Raumfahrtunternehmen und Forschungseinrichtungen haben eine Reihe von Methoden und Strategien zur aktiven Entfernung von Weltraummüll unterschiedlicher Größe vorgeschlagen, in der Hoffnung, damit nicht nur die Sicherheit des Raumfahrzeugbetriebs zu verbessern, sondern auch neue Märkte für die kommerzielle Luft- und Raumfahrt zu erschließen. Der US-amerikanische Orbitaldienstleister Vivisat hat das Konzept eines Mission Extension Vehicle (MEV) vorgeschlagen, in der Hoffnung, Weltraumroboter zu starten, um ausgemusterte und „gestrandete“ Satelliten in andere Umlaufbahnen zu bringen. Das amerikanische Unternehmen Tether Unlimited hat ein Programm mit dem Namen „Capture and Respin of Small Satellites and Space Debris“ (kurz: WRANGLER) gestartet. Dabei hofft man, mithilfe einer komplexeren Kombination von Raumfahrzeugen im Orbit eine große Zahl ausgemusterter kleiner Raumfahrzeuge einzufangen und sie so schnell wie möglich wieder in die Atmosphäre eintreten zu lassen. Der im Ausland entwickelte MEV-Weltraumroboter soll ausgemusterte Satelliten schleppen und so ihre Umlaufbahn ändern. Konzeptbild des WRANGLER-Schemas von Tether Unlimited Weitere amerikanische kommerzielle Luft- und Raumfahrtunternehmen haben verschiedene Pläne zur Beseitigung von Weltraummüll vorgeschlagen. Zur wichtigsten technischen Ausrüstung gehören Orbitalschleppflugzeuge, hochmanövrierbare Raumfahrzeuge, sonnensynchrone, weltraumgestützte Ultraviolett-Lasersender usw., mit denen man große Mengen verlassener Satelliten in Friedhofsumlaufbahnen schicken oder sie einschmelzen will. Bereits 2012 hatte sich die ESA das Ziel gesetzt, den außer Kontrolle geratenen europäischen Umweltsatelliten zu entfernen und beauftragte zahlreiche Luft- und Raumfahrtunternehmen aus der EU mit der Durchführung von Missionsdemonstrationen und Technologieentwicklungen. Zu den technischen Mitteln zur vorläufigen aktiven Entfernung zählen Roboterarme, „Tentakel“, fliegende Netze, Ionenstrahlen usw. Konzept zur Bergung von Weltraummüll mithilfe eines fliegenden Netzes Im Jahr 2016 führte Airbus Defence and Space gemeinsam mit zehn europäischen Partnern das Projekt „Spacecraft Self-Clearing Technology“ durch, um erste Forschungsarbeiten zu kostengünstigen und äußerst zuverlässigen Prototypen von Entfernungsmodulen durchzuführen. Ziel war es, sicherzustellen, dass das Raumfahrzeug die Umlaufbahn automatisch verlässt, wenn es ausfällt, die Kontrolle verliert oder seine Lebensdauer endet. Im Juni 2018 wurde ein von der Airbus-Tochter Surrey Satellite Technologies entwickelter Testsatellit zur Beseitigung von Weltraummüll von der Internationalen Raumstation aus eingesetzt. Von September desselben Jahres bis März 2019 schloss der Satellit erfolgreich die In-Orbit-Verifizierung von Technologien ab, wie beispielsweise der Verwendung von Flugnetzen und „Harpunen“ zum Einfangen kubischer Satelliten, der Verfolgung der Bewegung von Weltraumzielen und dem Schleppen kubischer Satelliten mit Off-Orbit-Segeln. Nachdem ein Satellit außer Dienst gestellt wurde, kann er mithilfe eines Deorbitsegels aktiv aus der Umlaufbahn gebracht werden. Am 1. Dezember 2020 unterzeichnete die ESA mit einem Schweizer Industrieteam einen Vertrag im Wert von 86 Millionen Euro (rund 680 Millionen Yuan) über den Erwerb der einzigartigen Missionsdienstleistung „Clean Space-1“: Ein Weltraumroboter soll die obere Hälfte des Nutzlastadapters der zweiten Stufe erreichen, den die Vega-Rakete 2013 im Weltraum zurückgelassen hatte. Anschließend soll er eingesammelt und in die Erdatmosphäre gezogen werden, wo er verglüht. Dann wird der Weltraumroboter mithilfe künstlicher Intelligenz das Ziel autonom auswerten und den Bewegungszustand anpassen. Der konkrete Erfassungsvorgang wird unter Aufsicht der ESA durch einen Roboterarm durchgeführt. Derzeit werden für die Mission Antriebssubsysteme hergestellt, der Satellit zusammengebaut, integriert und getestet; der Start ist für 2025 geplant. Konzeptbild eines Weltraumroboterarms, der Weltraumschrott einfängt Auch die japanischen Luft- und Raumfahrtstreitkräfte sind auf diesem Gebiet aktiv. Die Japan Aerospace Exploration Agency und die Nitto Networks Corporation arbeiten gemeinsam an der Entwicklung eines sogenannten „elektromagnetischen Weltraumnetzes“, das auf dem Kleinstsatelliten der Kagawa-Universität transportiert werden soll, um technische Tests zur Beseitigung von Weltraummüll durchzuführen. Darüber hinaus hat das RIKEN-Institut für physikalische und chemische Forschung in Tokio, Japan, einen Plan vorgeschlagen, einen Faserlaser auf der Internationalen Raumstation zu installieren und das Superfeldteleskop des japanischen Weltraumobservatoriums im japanischen Experimentalmodul zu nutzen, um Weltraumschrott mit einem Durchmesser von 1 cm zu beseitigen. |
Artikel empfehlen
Offiziell „den Himmel vermessen“! Kann uns „Mozi“ auf einem 4.200 Meter hohen Berg helfen, das Universum klar zu sehen?
Heute hat das WFST am Lenghu-Astronomischen Obser...
1,5-PS-Wechselrichter 4399 Yuan. Steigt Xiaomi in die Klimaanlagenbranche ein, um Geld zu verdienen?
Kann der boomende Klimaanlagenmarkt tatsächlich i...
Wie kann man den Po anheben?
Ich glaube, dass viele Menschen einen knackigen H...
Die Heimat der tibetischen Antilopen
Die tibetische Antilope ist in China und Indien h...
Yoga zum Abnehmen der Oberschenkel
Egal, an welchem Körperteil sich Fett ansammelt...
Die erste chinesische Gewinnerin des American Mathematics Award! Sie sagte: Ich bin nur ein gewöhnlicher Mensch
Das einzige chinesische Mädchen, das am Wettbewer...
Wie werden Gene von Eltern an Kinder weitergegeben?
Wenn ein Kind geboren wird, diskutieren viele Men...
Kann Schwimmen die Bauchmuskulatur trainieren?
Heutzutage schwimmen viele Menschen gerne. Manche...
Es gibt eine Methode, ein Springseil auszuwählen
Viele Menschen mögen Seilspringen, weil es eine k...
Lassen Sie mich Ihnen etwas Farbe zeigen! Die Quelle der Farbe in der Lebensmittelwelt
Lebensmittelpigmente sind Lebensmittelzusatzstoff...
Dealroom: Globaler KI-Venture-Capital-Bericht 2025
Globales KI-Risikokapital Im Jahr 2024 erreichten...
Fünfjahresausblick für Smart Home: Big Data und mehr Sicherheit
Smart Home ist die nächste Stufe der Smart-Techno...
Neuigkeiten zur Elektrofahrzeugtechnologie: Werden unabhängige Marken Joint Ventures besiegen? Borui vs. Mondeo, welches sollte ich für 200.000 Yuan kaufen
Wenn von Mittelklasselimousinen die Rede ist, den...
JD Power: Untersuchungen zeigen, dass die Ausfallrate von Fahrzeugen mit neuer Energie die von Kraftstofffahrzeugen bei weitem übersteigt
Der kürzlich von JD Power veröffentlichte Bericht...
Von Sojasauce und Schnaps bis zu Musks Gehirn-Computer-Schnittstelle: Wie weit sind wir von der Industrie-Universitätsforschung im amerikanischen Stil entfernt?
Nur ein Jahr später gelang Musks Unternehmen Neur...