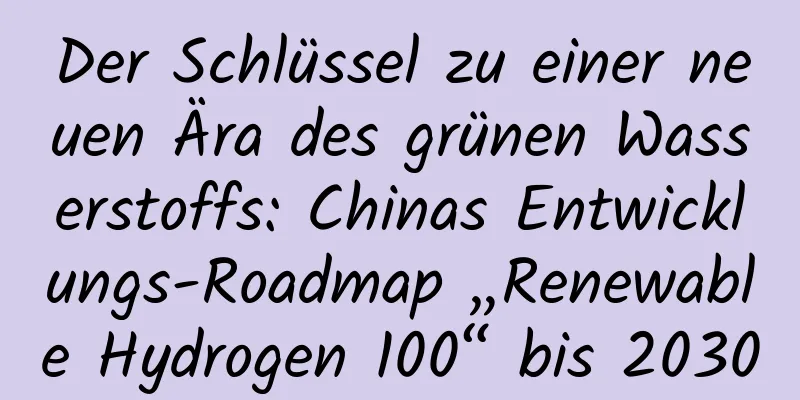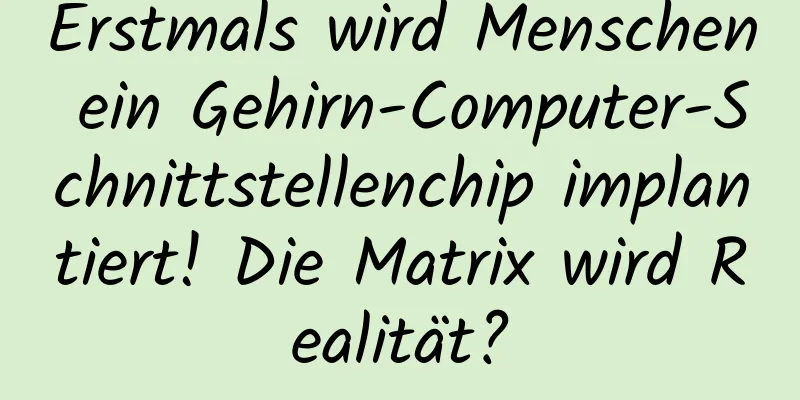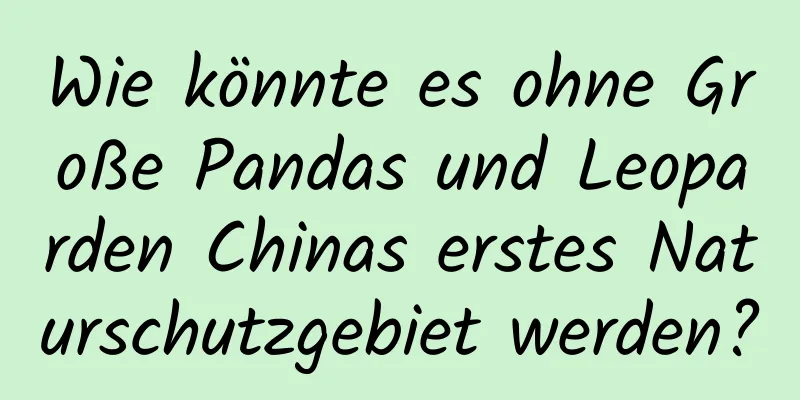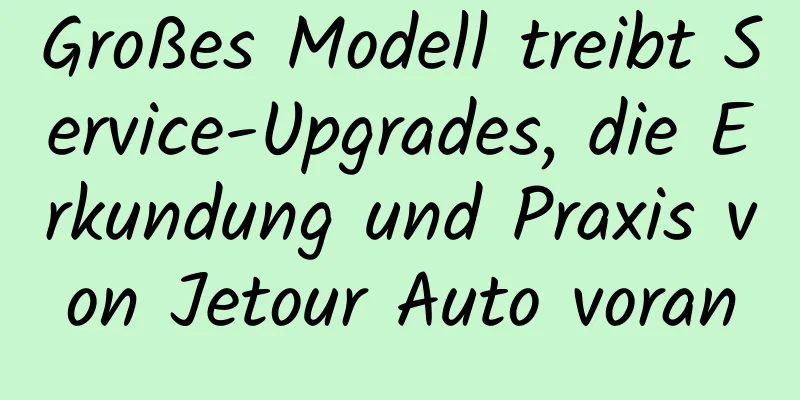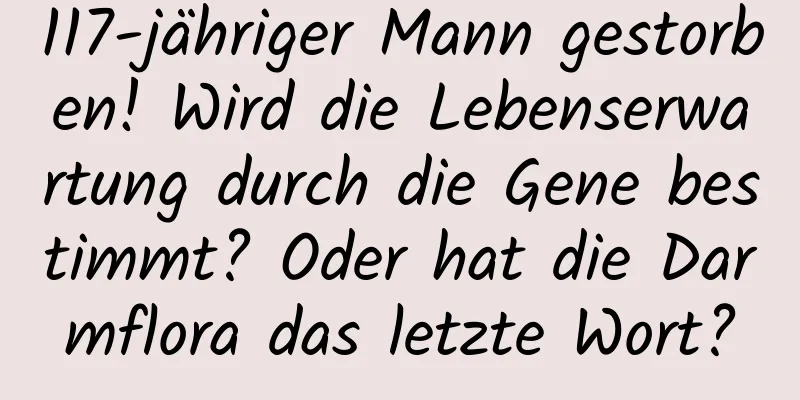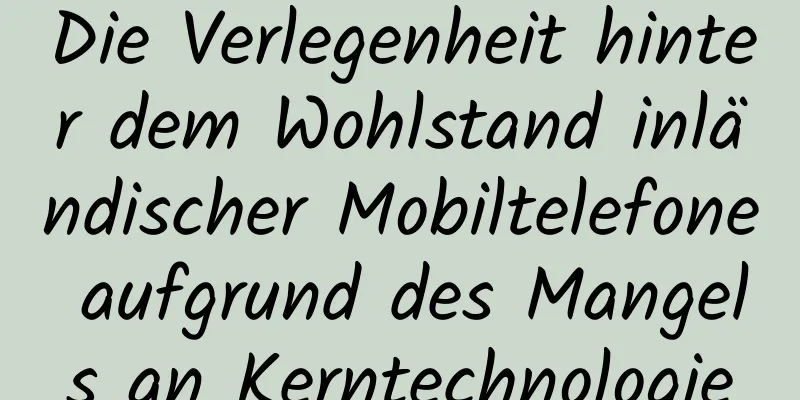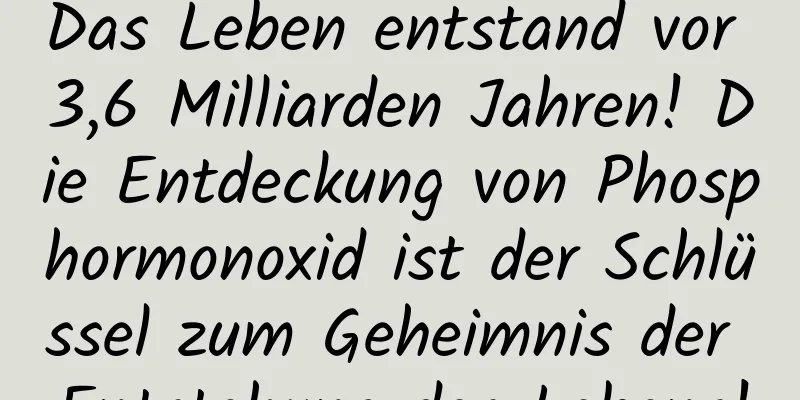Ich leide unter Misophonie. Darf ich das sagen?
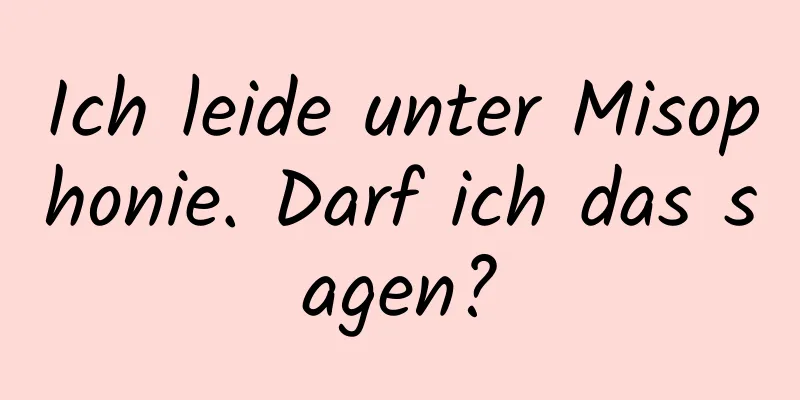
|
Es gibt im Leben immer scharfe und harsche Geräusche, wie etwa das Kratzen von Kreide auf einer Tafel, eine Notbremsung eines Autos, das Kratzen von Messer und Gabel auf einem Teller ... allein der Gedanke daran löst bei mir Unbehagen aus. Doch es gibt Menschen, die in der Welt des Jüngsten Gerichts leben und jeden Tag von Geräuschen umgeben sind. Die Geräusche anderer, die kauen, husten oder sogar atmen, können ihre emotionalen Minenfelder auslösen und eine innere Explosion verursachen. Wenn es Ihnen genauso geht, leiden Sie möglicherweise auch an Misophonie. „Misophobie“, auch bekannt als „Selektives Geräuschsensitivitätssyndrom“, bedeutet wörtlich „Hass auf Geräusche“. Die Patienten reagieren stark und unwillkürlich auf bestimmte Geräusche (Triggergeräusche), darunter auch negative Emotionen wie Ekel, Reizbarkeit, Übelkeit oder Angst, manchmal aber auch mit Herzrasen, übermäßigem Schwitzen und Muskelkrämpfen. So beschreiben Patienten ihre Gefühle, wenn sie an Misophonie leiden (aufgezeichnet von der BBC): „Diese Art von Geräusch machte mich sofort nervös und ängstlich. Es war, als ob mein Körper mir sagen wollte, dass Gefahr drohte und ich weggehen oder mich schützen musste.“ „Ich habe es in meinen inneren Organen gespürt, wie eine extreme Angst, oder ich wurde plötzlich verschluckt und überwältigt. Ich war ratlos und konnte nichts tun.“ „Wenn mir jemand eine Waffe an den Kopf halten würde, würde es sich genauso anfühlen.“ Hochempfindliche Verbindung Ursprünglich dachte man, Misophonie sei eine Störung der Tonverarbeitung. Doch im vergangenen Jahr entdeckten Forscher am Institute of Biosciences der Newcastle University erstmals, dass im Gehirn von Menschen mit Misophonie die Konnektivität zwischen dem auditorischen Kortex und den motorischen Kontrollbereichen, die mit Gesicht, Mund und Rachen in Verbindung stehen, erhöht ist, wodurch eine „supersensible Verbindung“ entsteht. Der zugehörige Artikel mit dem Titel „Die motorische Basis der Misophonie“ wurde im Journal of Neuroscience veröffentlicht. Gehirnscans von Menschen mit Misophonie zeigen, dass der auditorische Kortex (Hörzentrum) in ihrem Gehirn ähnlich reagiert wie bei Menschen ohne diese Erkrankung, es besteht jedoch eine verstärkte Kommunikation zwischen dem auditorischen Kortex und den motorischen Kontrollbereichen, die mit Gesicht, Mund und Rachen verbunden sind. Diese motorischen Kontrollbereiche wurden durch die Triggergeräusche von Menschen mit Misophonie stark aktiviert und nur als Reaktion darauf. Daher gehen Forscher davon aus, dass die Auslöser für Misophonie in der Regel die Geräusche beim Kauen, Atmen oder Sprechen sind, die mit Mund-, Rachen- oder Gesichtsbewegungen zusammenhängen. Dies ist das erste Mal, dass eine derartige Verbindung im Gehirn entdeckt wurde, und sie könnte Auswirkungen auf die Behandlung von Misophonie haben. Darüber hinaus stellte die Studie ein ähnliches Kommunikationsmuster zwischen visuellen und motorischen Bereichen fest, wobei Misophonie auch dann auftritt, wenn das Sehen ausgelöst wird. Durch diese Kommunikation wird das „Spiegelsystem“ im Gehirn aktiviert, das in der Lage ist, das Gehirn des Patienten so zu aktivieren, dass es die Handlung der anderen Person auf ähnliche Weise verarbeitet – als würde er diese Handlung selbst ausführen. Diese unwillkürliche Überaktivierung des Spiegelsystems kann bei Patienten das Gefühl hervorrufen, dass die Geräusche anderer Menschen in ihren Körper eindringen und außerhalb ihrer Kontrolle liegen. Auf dieser Grundlage vermuten die Forscher, dass „manche Menschen mit Misophonie ihre Symptome möglicherweise lindern können, indem sie die Bewegungen nachahmen, die die auslösenden Geräusche erzeugen. Dadurch haben sie das Gefühl, mehr Kontrolle über ihre Situation zu haben. Dieses Wissen könnte genutzt werden, um neue Behandlungsmethoden für Patienten zu entwickeln.“ Mehr als nur Kauen Aktuelle Forschungsergebnisse der Ohio State University deuten jedoch darauf hin, dass bisherige Erklärungen für Misophonie möglicherweise ungenau sind und dass auch Bereiche außerhalb des orofazialen Motorkortex Misophonie auslösen können. Die Studie mit dem Titel „Neural evidence for non-orofacial triggers in mild misophonia“ wurde in Frontiers in Neuroscience veröffentlicht. Die neue Studie untersucht erstmals, was im Gehirn passiert, wenn Menschen wiederholt mit den Fingern klopfen. Dabei stellte sich heraus , dass Fingerklopfen auch ein Auslöser für Misophonie sein kann und dass es ein anderes Verbindungsmuster zum Kaubereich und Gehirn gibt. Neunzehn Erwachsene mit unterschiedlich starker Misophonie nahmen an diesem Experiment teil, das hauptsächlich aus zwei Aufgaben bestand. Eine bestand darin, verschiedene Silben auszusprechen; Die Ergebnisse der fMRT zeigten, welche Bereiche des Gehirns durch Sprache aktiviert wurden, welche sich deutlich mit orofazialen Bewegungen überschnitten und mit Geräuschen wie Kauen in Zusammenhang standen. Bei einer anderen Aktion wurde wiederholt mit den Fingern auf die Beine geklopft, eine weitere Aktion, die mit Misophonie in Verbindung gebracht wird. Darüber hinaus wurden MRT-Scans auch durchgeführt, wenn die Teilnehmer nichts taten. Die Ergebnisse zeigten, dass Teilnehmer mit einem höheren Grad an Misophonie im Ruhezustand tatsächlich stärkere Verbindungen zwischen dem auditorischen Kortex und den motorischen Kontrollbereichen aufwiesen, was mit früheren Untersuchungen übereinstimmt. Allerdings war ein anderer Bereich des Gehirns aktiv, wenn die Teilnehmer mit dem Mund Geräusche machten, und bei denjenigen mit schwerer Misophonie zeigten sich in diesem Bereich keine stärkeren Verbindungen als bei denjenigen mit weniger schwerer Misophonie. Diese Ergebnisse legen nahe, dass die in früheren Studien festgestellten „supersensiblen Verbindungen“ Misophonie nicht vollständig erklären können. ** Bei Teilnehmern mit einem höheren Grad an Misophonie bestand eine stärkere Verbindung zwischen den Gehirnregionen, die mit Fingerbewegungen und -empfindungen in Verbindung stehen, und der Inselregion, die mit starken Emotionen, einschließlich Ekel, in Verbindung steht. **Dies deutet darauf hin, dass Misophonie mehr ist als nur Kauen und andere orale Geräusche und dass die Forschung zu den Ursachen von Misophonie über den orofazialen motorischen Bereich hinausgehen muss. „Dies trägt zu unserem Verständnis der vielen Möglichkeiten bei, wie Misophonie entstehen kann, und identifiziert Menschen, bei denen durch Kauen keine Misophonie auftritt, bei denen jedoch Symptome auftreten, die durch andere sich wiederholende Geräusche ausgelöst werden“, sagten die Forscher. Einsamer Patient Die Dokumentation „Quiet, Please“ befasst sich eingehend mit Misophonie. Direktor Jeffery Scott Gould, der seit 50 Jahren an Misophonie leidet, lädt Experten aus den Bereichen Neurowissenschaften, Psychologie, Audiologie und andere Kliniker ein, um die Erfahrungen der Patienten, mögliche Bewältigungsmechanismen und den aktuellen Stand der Misophonieforschung zu diskutieren. Für den Film wurden viele Menschen mit Misophonie interviewt und das Gefühl, das sie immer wieder erwähnten, war „Einsamkeit“. Großraumbüros werden zu Minenfeldern voller auslösender Geräusche. Sie können sich bei der Arbeit nicht konzentrieren und neigen sehr zu Konflikten mit anderen. Auch ihr Familienleben kann beeinträchtigt sein und es wird für sie schwieriger, mit ihrem Partner auszukommen, weil die Atem- und Kaugeräusche der anderen Person sie wütend machen können. Gestörte zwischenmenschliche Beziehungen können dazu führen, dass sie in den Käfig des Selbstautismus geraten. „ Misophonie betrifft nicht nur die Betroffenen, sondern auch die Menschen, die ihnen am nächsten stehen“, sagte der Regisseur in der Einleitung. „Aber gute zwischenmenschliche und familiäre Beziehungen sind immer noch möglich, was Anstrengung, Kompromissbereitschaft, Verständnis und Mitgefühl von allen erfordert.“ Zu den derzeit bekannten Behandlungsmethoden für Misophonie gehören: Ablenkung der Aufmerksamkeit und Assoziation störender Geräusche mit angenehmen Erlebnissen. Wenn der Patient beispielsweise das Geräusch beim Kekseessen hasst, lassen Sie ihn dem Geräusch zuhören, während er den Duft frisch gebackener Kekse riecht. Darüber hinaus kann die Einnahme von Antidepressiva auch eine gewisse unterstützende Wirkung haben. Ebenso wichtig ist das soziale Umfeld. Da immer mehr Menschen über Misophonie Bescheid wissen und sie verstehen, werden die Patienten auch das tun, was sie erwarten: „Ich kann direkt mit den Leuten sprechen, und sie werden mich nicht für ein Monster halten.“ Referenzlinks: https://www.bbc.com/ukchina/simp/48676842 https://www.sciencedaily.com/releases/2021/05/210524110143.htm https://www.jneurosci.org/content/41/26/5762 https://www.sciencedaily.com/releases/2022/08/220817103949.htm https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2022.880759/full Misophonie-Dokumentation: Quiet Please – Erkundung der Misophonie (quietpleasefilm.com) |
<<: Iss mich? Willst du mich immer noch essen? Nochmal essen...
>>: Sandzwiebeln, ein Gemüse-Blindfleck für Südländer
Artikel empfehlen
Um ihre Schönheit zu bewahren, können Flamingos sich tatsächlich selbst schminken!
Es gibt nicht viele Tiere, die allein aufgrund ih...
Samsung-Krise, BlackBerry-Outsourcing: Beginnt ein Wandel in der Smartphone-Branche?
Während der Vorfall im Zusammenhang mit der Rückr...
Ausländische Medien: Größe und Funktion sind wichtig, damit sich das iPhone gut verkauft
Ausländische Medienanalysen zufolge war die Markt...
Die Zukunft der Beratung: Erweiterung der menschlichen Intelligenz
Das größte Hindernis für kluges Handeln und die g...
Welche Art von Bewegung kann fit halten?
Der Fitnesswahn erfreut sich in letzter Zeit zune...
Welche Vorsichtsmaßnahmen sind beim beidhändigen Kurzhantelrudern zu beachten?
Das vorgebeugte Kurzhantelrudern weist einen rela...
Warum ist es so schwierig, mit dem Rauchen aufzuhören?
China ist das Land mit der höchsten Zahl an Lunge...
Ist Schwimmen eine athletische Sportart?
Bei den sogenannten Leichtathletiksportarten hand...
8-jähriger Junge durch Glasflaschenexplosion verletzt! Trockeneis ist ungiftig, aber spielen Sie nicht damit!
Autoren: Duan Yuechu, Huang Xianghong, Huang Yanh...
Was ist einfacher zum Abnehmen: Laufen oder Seilspringen?
Wenn wir nicht auf unsere tägliche Ernährung und ...
Heute enthüllt! Nationaler Botanischer Garten, was ist der Unterschied?
18. April Nationaler Botanischer Garten Offiziell...
Kennen Sie alle Veranstaltungen der Olympischen Winterspiele in Peking? Die umfassendste Populärwissenschaft gibt es hier →
Bis zur Eröffnung der Olympischen Winterspiele in...
So übt man Weitsprung
Manche Leute haben immer das Gefühl, dass ihr Wei...
Yoga-Rückenübungen
Viele Menschen haben zu viel Fett am Rücken, desh...