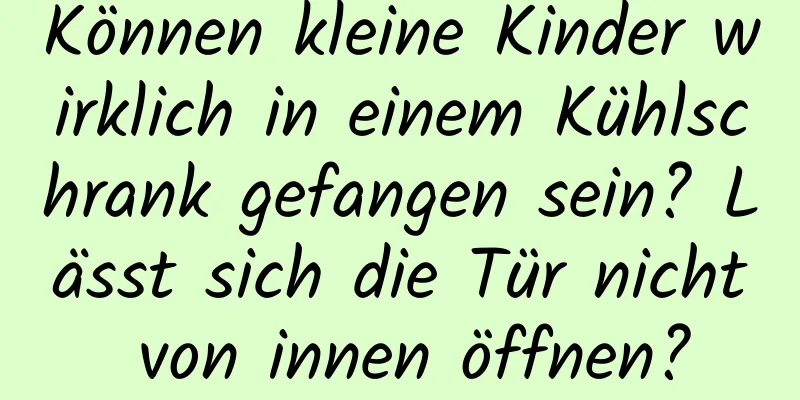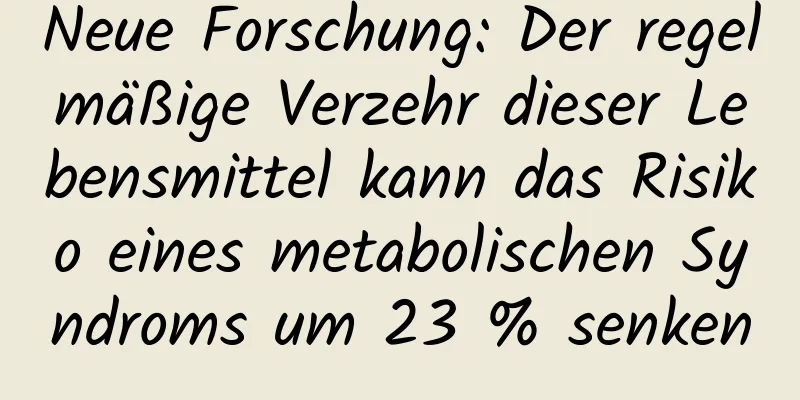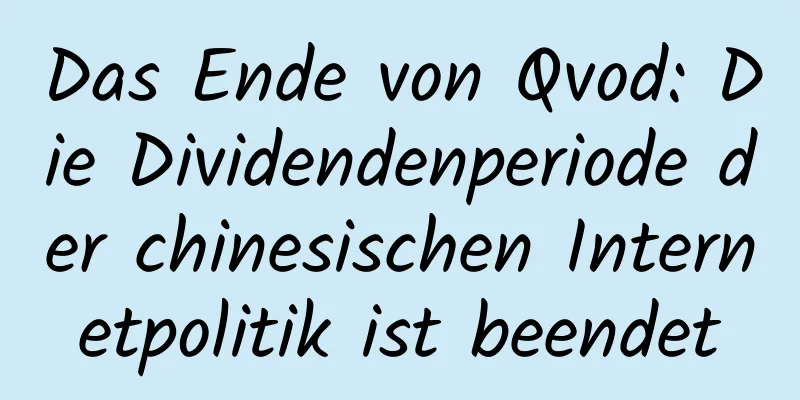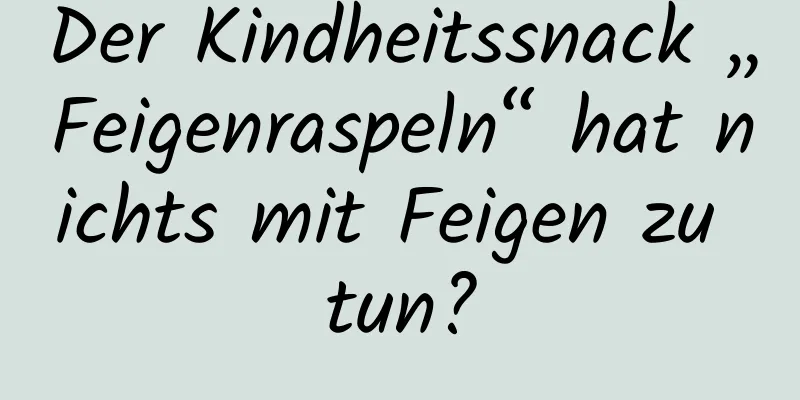Neben der Ausrichtung der Weltmeisterschaft ermöglichte Katars „Geldmacht“ auch die Wiedergeburt dieses Papageis
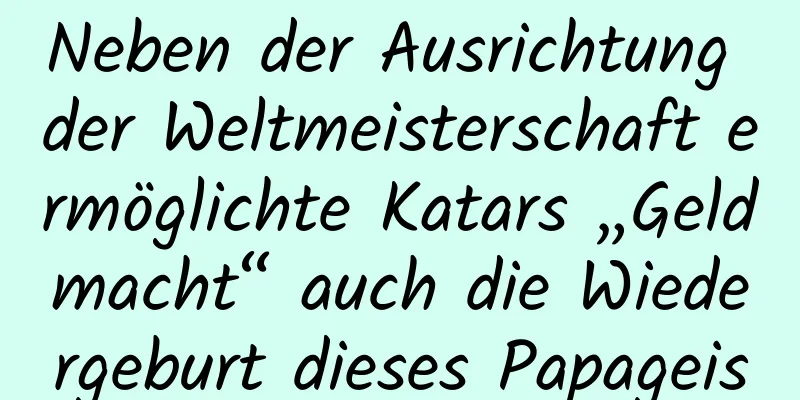
|
Erst vorgestern wurde die von Fußballfans so heiß ersehnte Fußball-Weltmeisterschaft in Katar endlich eröffnet! Es gibt viele Besonderheiten dieser Weltmeisterschaft. Neben der Änderung der Spielzeit vom traditionellen Sommer auf den Winter endete damit auch die Tradition, bei drei aufeinanderfolgenden Weltmeisterschaften Tiermaskottchen zu verwenden – das Maskottchen der Weltmeisterschaft 2018 in Russland war ein sibirischer Wolf, das Maskottchen der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien ein Dreibinden-Gürteltier und das Maskottchen der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika ein Leopard; und der diesjährigen Fußballweltmeisterschaft in Katar. Das Maskottchen wurde von der traditionellen arabischen Tracht „Laib“ inspiriert, die von den Fans „Knödelhaut“ genannt wird . Warum hat Katar dieses Jahr kein Tier als Maskottchen verwendet? Katar ist eine kleine Halbinsel im Persischen Golf. Der größte Teil der Oberfläche ist von Wüste bedeckt. Die extrem hohen Temperaturen und der Mangel an Niederschlägen machen es den meisten Tieren schwer, hier zu überleben. Es gibt jedoch ein Tier, das in der Wildnis für ausgestorben gehalten wurde, auf dieser rauen Halbinsel jedoch „wiedergeboren“ wurde : der blaue Ara (Cyanopsitta spixii). Ausgestopfter Blauara|Daderot / Wikimedia Commons Die beliebten Papageien verschwinden aus ihren Häusern Im letzten Jahrhundert war das Sammeln seltener Antiquitäten aus aller Welt ein beliebter Zeitvertreib der Prinzen und Adligen Katars. Mit den Dollars aus dem Öl- und Erdgasgeschäft kauften sie für erstaunlich hohe Summen Gemälde, Schmuck, Antiquitäten und sogar Dinosaurierfossilien aus aller Welt. Neben Kunstwerken gehören auch seltene und wunderschöne Tiere zu ihrer Sammlung. Auf der mitten in der Wüste errichteten Farm züchteten katarische Adlige viele seltene Tiere, darunter verschiedene Paradiesvögel aus Neuguinea, Großohrantilopen aus Ostafrika, Wüstenkatzen aus dem Nahen Osten ... Die bekannteste und am stärksten gefährdete Art unter ihnen ist der blaue Ara. Der Blaugraue Ara ist in den lichten Wäldern des trockenen Nordostens Brasiliens heimisch. Während der kurzen Regenzeit gedeiht die Vegetation hier, doch während der Trockenzeit erscheinen alle Pflanzen grau und verdorrt. Die Goldeiche (Tabebuia aurea), die entlang der Ufer des Quellflusses wächst, ist eine wichtige Nahrungsquelle für die blauen Aras und die Baumhöhlen in den alten, abgestorbenen Bäumen sind gleichzeitig ihre Nester. Die einzige Heimat des Zwergaras ist das einzigartige Caatinga-Biom, eine Kombination aus Laubsträuchern und saisonal trockenen Wäldern unter lokalen halbtrockenen Bedingungen.|NiaziGamer / Wikimedia Commons Vielleicht liegt es daran, dass ihr natürliches Verbreitungsgebiet sehr begrenzt ist, oder vielleicht an den langfristigen Schäden, die der Mensch an der lokalen Umwelt verursacht hat: Als die blauen Aras vor 200 Jahren von europäischen Wissenschaftlern entdeckt wurden, waren sie bereits sehr selten . Schon bald wurde dieser seltene und schöne Papagei zu einem begehrten Sammlerstück. Da ihre Zahl stark zurückgeht, sind manche Menschen eher bereit, ein Vermögen für den Kauf eines kleinen blauen Aras auszugeben, der sogar für 2.000 Dollar verkauft werden kann . Obwohl die brasilianische Regierung in den 1960er Jahren den Export von Wildtieren verbot, war sie nicht in der Lage, den illegalen Handel zu stoppen, der zur Ausrottung des blauen Aras führte. Im Jahr 1987 fanden Ermittler lediglich drei blaue Aras – zwei davon verschwanden kurz darauf in den Taschen von Tierhändlern. Der letzte männliche Blauflügelara findet keine Artgenossen mehr und kann nur noch mit einem weiblichen Blauflügelara (Primolius maracana) zusammenleben. Nach Oktober 2000 wurde dieser kleine blaue Ara nicht mehr in freier Wildbahn gesehen. Um die Jahrhundertwende verschwand der Blauara vollständig aus seiner natürlichen Heimat und ließ nur eine sehr kleine Zahl von Exemplaren zurück, die über die ganze Welt verstreut lebten. Blauflügelaras. Merken Sie sich diese, sie werden später wieder auftauchen. | TJ Lin / Wikimedia Commons Vom Sammeln von Kuriositäten bis zur Unterstützung der Zucht Doch die blauen Aras sind noch nicht völlig ausgestorben und ihre letzte Hoffnung sind einzelne Exemplare in privaten Zoos . Um dem blauen Ara die Rückkehr in die Wildnis zu ermöglichen, begannen die brasilianische Regierung und mehrere Naturschutzorganisationen in den 1980er und 1990er Jahren damit, die vorhandenen Papageien zusammenzuführen, um eine künstliche Zuchtpopulation aufzubauen. Die brasilianische Regierung hat außerdem private Sammler von der Teilnahme an dem Programm befreit, in der Hoffnung, dass mehr Besitzer ihre Papageien in das Zuchtprogramm eintragen werden. Die ständigen Eigentumsstreitigkeiten und die hohen Transferpreise ließen das künstliche Zuchtprogramm jedoch beinahe scheitern . Auch in „Rio“ gibt es blaue Aras, doch in Wirklichkeit ist es nicht einfach, sie wieder zum Leben zu erwecken | "Rio" Gerade als der blaue Ara in freier Wildbahn vom Aussterben bedroht war, beschloss Katars Al Wabra Wildlife Preservation Prince ( AWWP ), ursprünglich ein privater Zoo für Prinzen und Adlige, sich im Artenschutz zu engagieren. Obwohl viele Verkäufer zögern, ihre Papageien einfach so zu verkaufen, nutzen sie ihre finanziellen Möglichkeiten, um die wenigen verbliebenen wertvollen Exemplare von Sammlern auf der ganzen Welt zu kaufen. Bald wurde das AWWP zur Institution mit der größten Population blauer Aras weltweit . AWWP stellte außerdem Fachkräfte ein, um ein Zuchtprogramm in Gefangenschaft zu starten. Um das Inzuchtproblem zu lösen, versuchte man, Papageien durch künstliche Befruchtung zu züchten. Im Jahr 2013 wurde der erste durch künstliche Befruchtung gezüchtete blaue Ara geboren . AWWP züchtete 1 Tag alte, 25 Tage alte und 7-8 Wochen alte Blauara-Küken sowie Blauara-Küken|AWWP Der Ansatz von AWWP ist eine wichtige Innovation für Wildtierfarmen im gesamten arabischen Raum. In der Anfangszeit waren viele der gesammelten Tiere in keinem guten Zustand. Dank der Beteiligung professioneller Tierärzte und Naturschützer ist die künstliche Zucht der blauen Aras allmählich auf den richtigen Weg gekommen und auch die Krankheitsprobleme, die die in Gefangenschaft gehaltenen Populationen lange Zeit plagten, konnten gelöst werden . Viele Aras, die von Brasilien nach Europa und in die USA gelangen, leiden an einer Krankheit namens „Papageienvormagenerweiterung“, die durch verminderten Appetit, Erbrechen, kontinuierlichen Gewichtsverlust und schließlich den Tod gekennzeichnet ist. Dasselbe gilt für die blauen Aras. Im Jahr 2008 entdeckten Forscher schließlich, dass die Krankheit hauptsächlich durch ein Virus verursacht wurde, und AWWP richtete umgehend ein Isolationsprogramm für Papageien ein. Wenn mit dem Virus infizierte Personen entdeckt und isoliert werden, können gesunde Populationen letztlich weiterbestehen. Darüber hinaus hat AWWP zur Vorbereitung der Freilassung des Blauen Aras eine 2.380 Hektar große Farm im ursprünglichen Lebensraum des Aras erworben . Der niederländische Tiermaler Joseph Smit stellte 1878 den blauen Ara dar | Joseph Smit Nach 20 Jahren des Verschwindens kehrten sie in ihre Heimatstadt zurück Nach Jahren der Planung, Zucht und Vorbereitung wurden im März 2020 52 blaue Aras in die Einrichtung zur Anpassung an die Wildnis an ihrem Herkunftsort in Brasilien zurückgebracht. Erst im Juni dieses Jahres wurde die erste Gruppe blauer Aras erfolgreich in die Freiheit entlassen und kehrte in ihre Heimat zurück, aus der die Art 20 Jahre lang verschwunden war. Um eine reibungslose Umsetzung des Freilassungsplans zu gewährleisten, statteten die Mitarbeiter die Papageien nicht nur mit Ortungsgeräten aus, sondern stellten ihnen auch Artgenossen zur Seite – eine Gruppe Blauflügelaras mit ähnlichem Lebensraum, die mit der örtlichen Umgebung vertraut sind. Es bleibt zu hoffen, dass sich die kleinen blauen Aras unter ihrer Führung schnell an das Leben in der Wildnis gewöhnen können. Neben der Freilassung der Papageien werden derzeit auch Wiederherstellungsarbeiten an der besonderen ökologischen Umgebung vor Ort durchgeführt: Die einheimische Vegetation wurde über viele Jahre hinweg durch Brandrodung und Viehfraß zerstört. Jetzt versuchen Naturschutzökologen, auf dieser einheimischen Vegetation ein Ökosystem mit einer Vielzahl von Tieren wie dem blauen Ara wieder aufzubauen. Ein blauer Ara, fotografiert in Deutschland in den 1980er Jahren | Rüdiger Stehn / Wikimedia Commons Für viele Arten, denen ein ähnliches Schicksal wie dem Blauen Ara bevorsteht, sind ihre Populationen in Zoos und künstlichen Umgebungen wichtige Genbanken und zugleich die entscheidende, letzte Absicherung für Wiedereinführungsprojekte. Obwohl die ersten blauen Aras in die Wildnis zurückgekehrt sind, ist es noch ein langer Weg, bis sich eine sich selbst erhaltende Population in der freien Natur etabliert hat . Wenn die Sterblichkeitsrate der ersten Gruppe von in die Freiheit entlassenen Individuen zu hoch ist, wird der Auswilderungsplan vorübergehend ausgesetzt. Ihr Schicksal liegt noch immer in den Händen der Menschen. Zucht- und Forschungszentrum für gefährdete Tiere in der Wüste|AWWP Mittlerweile wurde ein großer Teil der Blauaras im Besitz des AWWP an Artenschutzeinrichtungen in Europa und Brasilien übergeben. Diese private Farm hat sich nach und nach von einem Tiersammelzentrum, das die Neugier der Reichen befriedigt, in eine Institution für die künstliche Zucht gefährdeter Arten verwandelt . Dieses Naturschutzzentrum im Zentrum Katars erstreckt sich über eine Fläche von 2,5 Quadratkilometern und ist nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Es ist die Heimat von mehr als 2.500 Tieren aus über 100 Arten , darunter Katars einzige einheimische Gazelle, die Arabische Sandgazelle, das erste in freier Wildbahn vor dem Aussterben gerettete Tier, die Arabische Oryx, sowie der Flamingo und der Paradiesvogel. Arabische Sandgazelle|AWWP Auf der offiziellen Website des AWWP heißt es, dass das Unternehmen bestrebt sei, „das fortschrittlichste Zucht- und Forschungszentrum für gefährdete Wildtiere“ zu werden – ein Zuchtzentrum in der Wüste, das zweifellos einen wichtigen Beitrag Katars zum Erhalt der Artenvielfalt darstellen würde . Autor: Shi Xu Herausgeber: Mai Mai Dieser Artikel stammt aus dem Artenkalender, gerne weiterleiten Wenn Sie einen Nachdruck benötigen, wenden Sie sich bitte an [email protected] |
<<: Wird dieser im Internet berühmte Asteroid wirklich die Erde zerstören?
>>: Der einzige Unterschied zwischen "sozialer Phobie" und "sozialem Bullen" ist eine Begrüßung
Artikel empfehlen
Der erste Schritt zur Lösung des Problems der Smart-Home-Industrialisierung: Tragen Sie Ihren Teil dazu bei
Auf der WWDC-Konferenz 2014 sorgte Haier, eine ch...
Erhöht das Tragen schwarzer Unterwäsche das Krebsrisiko? Die Wahrheit über "Kauf keine schwarze Unterwäsche" ist hier
Schwarz ist eine der häufigsten Farben bei Textil...
Welche Yogaball-Übungen beim Abnehmen helfen können
Yogabälle sind beim Yoga absolut unverzichtbar. D...
China Passenger Car Association & CAM: Der Produktwettbewerbsfähigkeitsindex für den Pkw-Markt liegt im August 2022 bei 91,3
Die Automobile Market Research Branch der China A...
Ist Seilspringen zum Abnehmen effektiv?
Wir werden feststellen, dass manche Menschen im L...
Auf der Baidu World Conference 2017 wird KI-Hardware veröffentlicht. Wird Raven Technology eine führende Rolle spielen?
China News Service, 31. Oktober: Die Baidu-Weltko...
Vivo Z6 ist ein Leistungspionier und bringt 5G-Mobiltelefone mit einer Quasi-Flaggschiff-Einstellung in den 2.000-Yuan-Bereich
Seit 2018 treiben viele Handyhersteller den Bau v...
Könnte der Einstieg von Windows 10 in den Mobilbereich eine Bedrohung für Android darstellen?
Microsoft hat in letzter Zeit mehrere große Ankün...
Warum willst du schlafen, wenn es regnet? Die Antwort ist nicht so einfach
Hat es bei Ihnen nach einer langen Hitzeperiode e...
Wie lindert man Muskelkater nach dem Training?
Im vorherigen Artikel wurde darüber gesprochen, w...
Preissenkung für Bong-Armbänder spiegelt die „Alchemie“ tragbarer Geräte wider
Da der Preis des Xiaomi-Armbands mit 79 Yuan ange...
Der Frühling ist da und es erklingen Liebeslieder! Aber ... paaren sich Tiere zum Zweck der Fortpflanzung?
„Ein Tag im Leben ist wie das Leben einer Eintags...
Apple vs. Google: Wer wird führend in Sachen KI?
Wenn Sie wie ich den Technologiemarkt als einen W...
Welche Veränderungen werden Sie in einem Jahr feststellen, wenn Sie täglich eine Stunde länger schlafen?
Im schnelllebigen Leben ist Schlaflosigkeit für v...
Handelsministerium: Bericht zur Entwicklung des chinesischen Online-Einzelhandelsmarktes für das erste Quartal 2023
Im ersten Quartal 2023 erreichten die nationalen ...