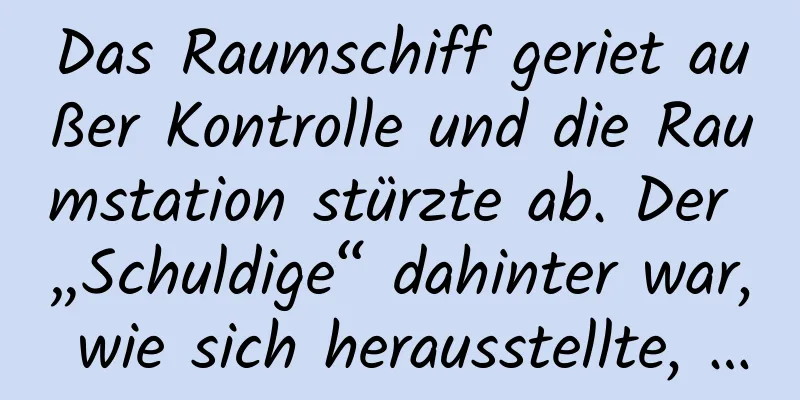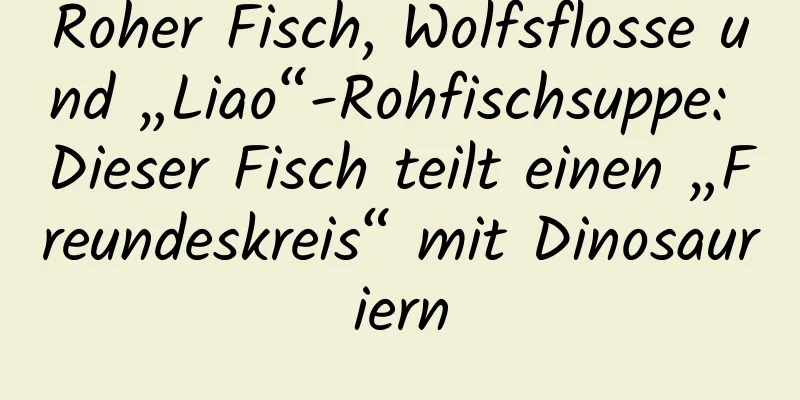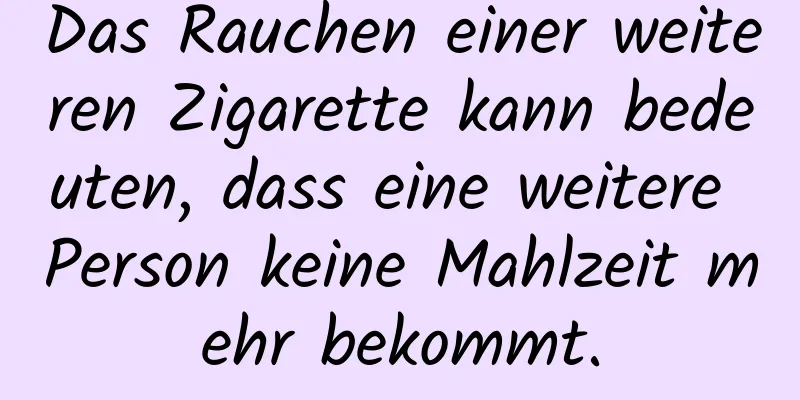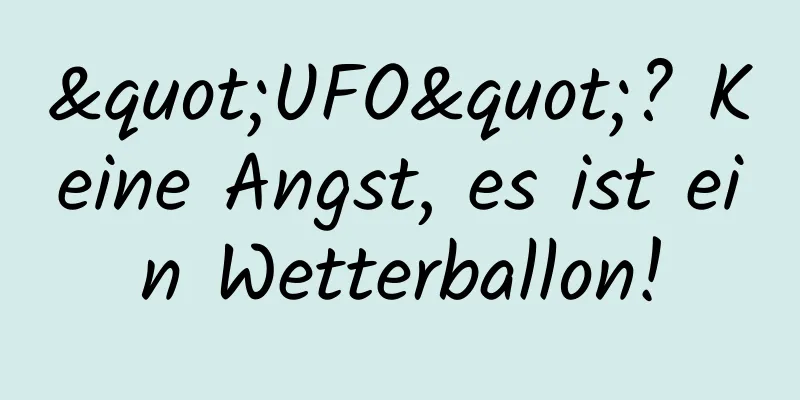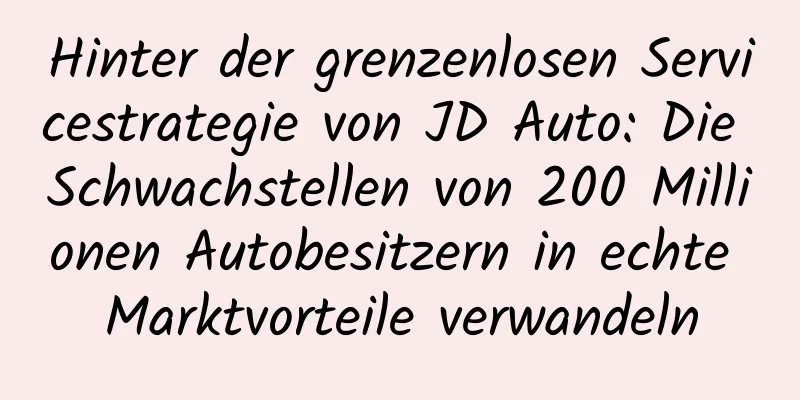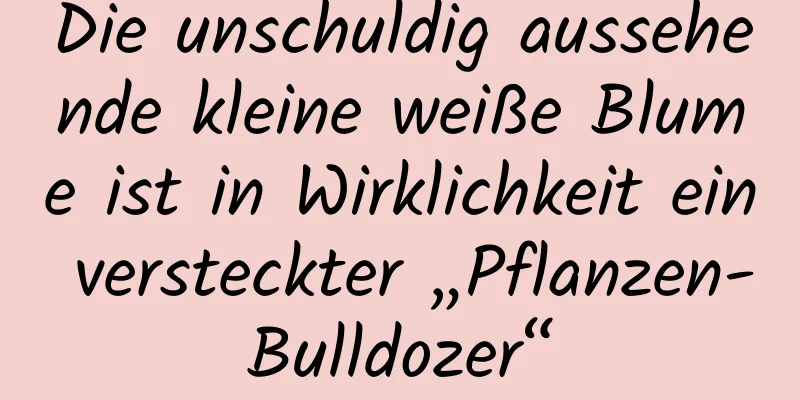Die Seele des Manhattan-Projekts, der mächtigste Problemlöser des 20. Jahrhunderts [Teil 1]
![Die Seele des Manhattan-Projekts, der mächtigste Problemlöser des 20. Jahrhunderts [Teil 1]](/upload/images/67f20dfa755b4.webp)
|
Bethe war ein Meister auf den Gebieten der Physik und Astrophysik. Er leistete herausragende Beiträge auf vielen Gebieten, darunter Quantenmechanik, Festkörperphysik, Kernphysik, Astrophysik, Quantenelektrodynamik und Teilchenphysik. Aus diesem Grund erhielt er 1967 den Nobelpreis für Physik und viele andere bedeutende Auszeichnungen. Während des Manhattan-Projekts leitete Bethe als Leiter der theoretischen Abteilung eine Gruppe herausragender Physiker, die viele Schlüsselprobleme bei der Herstellung der Atombombe löste. Aufgrund seiner Supercomputer-Fähigkeiten, seiner zahlreichen Beiträge und seines breiten Interessenspektrums bezeichnete Dyson Bethe als „den mächtigsten Problemlöser des 20. Jahrhunderts“. Geschrieben von | Wang Shanqin Wenn die Leute über das Manhattan-Projekt sprechen, denken sie wahrscheinlich zuerst an J. Robert Oppenheimer (1904-1967), bekannt als der „Vater der Atombombe“. Tatsächlich war Oppenheimer nicht an der Erforschung der Prinzipien der Atombombenexplosion und den spezifischen komplexen Berechnungen beteiligt. Diese Aufgabe wurde von der theoretischen Abteilung des Manhattan-Projekts übernommen, der wichtigsten Abteilung des Los Alamos-Labors. An der Spitze dieser intellektuellen Pyramide steht Hans Albrecht Bethe (1906–2005), Leiter der theoretischen Abteilung. Unter seiner Leitung überwand die Theoretische Abteilung verschiedene Schwierigkeiten, löste viele wichtige theoretische Probleme bei der Entwicklung der Atombombe und stellte den Erfolg des Projekts sicher. Beth. Bildnachweis: Los Alamos National Laboratory Bethe war auch ein herausragender Meister der Physik und Astrophysik. Er wurde zum Direktor der theoretischen Abteilung des Manhattan-Projekts ernannt, da er bereits eine führende Persönlichkeit auf dem Gebiet der Kernphysik in den Vereinigten Staaten war. Seine wissenschaftliche Forschungskarriere dauerte mindestens 70 Jahre, davon waren mindestens 50 Jahre die Blütezeit. Während dieser Zeit wechselte er in verschiedene Bereiche und erzielte bedeutende, ja sogar bahnbrechende Ergebnisse, wobei er außergewöhnliches Talent, Fleiß und Kreativität bewies. Für seine systematischen und eingehenden Untersuchungen der Kernfusionsprozesse in Hauptreihensternen (einschließlich der Sonne) erhielt er 1967 den Nobelpreis für Physik für „seine Beiträge zur Theorie der Kernreaktionen, insbesondere seine Entdeckungen zur Energieerzeugung in Sternen“. Dieser Artikel stellt Bethes Leben und wissenschaftliche Beiträge vor. Der Stolz einer Akademikerfamilie Bethe wurde am 2. Juli 1906 in Straßburg geboren, das damals zu Deutschland gehörte (heute zu Frankreich). Bethes Vater, Albrecht Julius Theodor Bethe (1872–1954), war ein Physiologe, der das Nervensystem von Wirbellosen erforschte. Albrecht promovierte 1895 an der Universität München in Philosophie und arbeitete von 1896 bis 1911 am Physiologischen Institut in Straßburg, wo er 1898 in Medizin promovierte.[1] Bethes Großvater mütterlicherseits, Abraham Kuhn (1838–1900), war Professor an der Universität Straßburg. Seine Tochter Anna Kuhn (1876–1966) änderte nach ihrer Heirat mit Albrecht ihren Namen in Anna Bethe-Kuhn. Als Bet geboren wurde, war sein Großvater bereits verstorben. 1911 wurde Albrecht Professor und Direktor des Physiologischen Instituts an der Universität Kiel. 1915 wurde Albrecht Direktor des Physiologischen Instituts der Universität Frankfurt.[2] Diese beiden Termine führten dazu, dass Beths Familie zweimal umziehen musste und Beth mehrere Schulen besuchen musste. Ein Foto von Beth mit ihren Eltern, als sie 12 Jahre alt war. Bildquelle: Public Domain Im Jahr 1924 machte Bethe sein Abitur und begann sein Chemiestudium an der Universität Frankfurt. Es stellte sich heraus, dass Bethe für dieses Hauptfach nicht geeignet war, da seine experimentellen Fähigkeiten mangelhaft waren und er wiederholt Fehler machte; Im schlimmsten Fall verschüttete er Schwefelsäure auf seinen Laborkittel. In dieser Hinsicht teilte er das gleiche Leid wie sein späterer guter Freund Oppenheimer. Im April 1926 wechselte Bethe auf Vorschlag seines Lehrers an die Universität München, um bei dem berühmten theoretischen Physiker Arnold Sommerfeld (1868–1951) zu studieren. Bethe, die gut in theoretischer Forschung ist, fühlt sich seitdem wie ein Fisch im Wasser. Sommerfeld schlug Bethe vor, die Elektronenbeugung in Kristallen als Forschungsthema zu wählen, und so betrat er das Gebiet der Festkörperphysik. 1928 promovierte der damals 22-jährige Bethe und wechselte im darauffolgenden Jahr an die Technische Universität Stuttgart. Jung und vielversprechend Im Jahr 1929 veröffentlichte Bethe mehrere Arbeiten zu Themen wie der Symmetrie der Elektronenenergie des Wasserstoffatoms, der Elektronenverteilung von Heliumgas und der Kristalltrennung, die Quantenmechanik und Festkörperphysik beinhalteten. Auf Sommerfelds Empfehlung hin erhielt Bethe ein Reisestipendium der Rockefeller Foundation in Höhe von 150 US-Dollar pro Monat (entspricht etwa 2.765 US-Dollar im Jahr 2023). Im Jahr 1930 veröffentlichte Bethe eine 76-seitige Abhandlung mit dem Titel „Die Theorie der Übertragung von Hochgeschwindigkeits-Teilchenstrahlen durch Materie“[3]. Dieses Dokument geht von der Schrödingergleichung aus und verwendet die Fourier-Transformation, um die berühmte „Bethe-Formel“ zu erhalten. Diese Formel beschreibt den durchschnittlichen Energieverlust eines Teilchens beim Durchgang durch ein Medium. Bate hielt dies später für die beste Abhandlung, die er jemals geschrieben hatte (nein, „niemand“), und das, obwohl er erst 24 Jahre alt war. Dieses Papier wurde bisher mehr als 6.000 Mal zitiert. Im selben Jahr nutzte Bethe ein Reisestipendium, um als Postdoktorand bei Ralph Fowler (1889–1944) das Cavendish Laboratory der Universität Cambridge zu besuchen. Patrick Blackett (1897–1974) hoffte, dass er die „Bethe-Formel“ auf den relativistischen Fall erweitern könnte, um extrem schnelle Teilchen zu beschreiben. Bethe erfüllte Blacketts Wunsch und schrieb die verallgemeinerte Formel in die Abhandlung „The Relativistic Electron Deceleration Formula“[4], die 1932 veröffentlicht wurde. Während seines Studiums an der Universität Cambridge arbeitete Bethe mit jungen Leuten im selben Labor zusammen, um einen Scherzartikel für die Redaktion zu erstellen[5]. In diesem „Artikel“ wurde die Feinstrukturkonstante am absoluten Nullpunkt in Grad Celsius berechnet, um die Art und Weise zu verspotten, wie einige Physiker damals physikalische Konstanten zusammensetzten. Der große Astrophysiker Arthur Eddington (1882–1944) verwendete einst einige Zahlen, um den Wert der Feinstrukturkonstante zu ermitteln. (Anmerkung des Herausgebers: Siehe „Ist er ein Meister der Astrophysik oder auch ein Stolperstein für die Entwicklung der Disziplin?“) Bethe und andere entschuldigten sich später. [6] Die verbleibende Hälfte des Stipendiums nutzte Bethe wie geplant für einen Besuch des Physiklabors von Enrico Fermi (1901–1954) an der Universität Rom. Fermis außergewöhnliche Intelligenz beeindruckte Bethe und gab ihm das Gefühl, dass er ihm zu spät begegnet war. Andererseits galt Bethe auch als einer der herausragendsten Besucher des Fermilab. Bethe erbte den strengen Stil von Sommerfeld und den prägnanten Stil von Fermi. "Bates Hypothese" Im März 1931 veröffentlichte Bethe sein frühes repräsentatives Werk „Zur Theorie der Metalle. I. Eigenwerte und Eigenfunktionen linearer Atomketten“[7]. In diesem Artikel wird der berühmte „Bethe-Ansatz“ vorgeschlagen, um das Problem eindimensionaler Quanten-Vielteilchenmodelle genau zu berechnen und die genauen Eigenwerte und Eigenfunktionen der Wellenfunktion bestimmter Quanten-Vielteilchenmodelle zu finden. Bis heute wurde dieser Artikel mehr als 4.700 Mal zitiert. Eines der Lernthemen, das der Physikmeister Richard Feynman (1918–1988) vor seinem Tod an die Tafel schrieb, war „Bethe-Ansatzprobleme“. Als Bethe diese Arbeit veröffentlichte, war er noch keine 25 Jahre alt. Während seines Gastwissenschaftleraufenthalts in Rom arbeitete Bethe auch mit Fermi zusammen, um die Quantenelektrodynamik (QED) zu studieren. QED ist ein Zweig der Physik, der die Wechselwirkung zwischen Elektronen/Positronen (Materie) und Photonen (Strahlung) beschreibt. Bethe arbeitete mit Fermi an einer Arbeit im Bereich der Quantenelektronentheorie mit dem Titel „The Interaction of Two Electrons“[8], die 1932 veröffentlicht wurde. Bethe verfasste 1932 außerdem zwei Rezensionen. Der erste Artikel behandelt die Quantenmechanik von Wasserstoff und Helium, der zweite Artikel die Elektronen in Metallen. Im Jahr 1959 lasen Robert Bacher (1905–2004) und Victor Weisskopf (1908–2002) Bethes Rezension der Quantenmechanik sorgfältig durch, um sie erneut zu veröffentlichen. Sie kamen zu dem Schluss, dass sie tiefgründig war und für den Neudruck nur minimale Aktualisierungen erforderlich waren. Bethe-Heitler-Formel Nach Abschluss seiner Studienreise kehrte Bethe nach Deutschland zurück und wurde 1932 Assistenzprofessor an der Universität Tübingen. Nazi-Deutschland begann jedoch bald, Juden zu diskriminieren. Da Beths Mutter Halbjüdin war, wurde er in den Vorfall verwickelt und von der Universität verwiesen. Mit Hilfe des britischen Physikers William Lawrence Bragg (1890–1971) wurde Bethe 1933 eine einjährige Dozentenstelle an der Universität Manchester angeboten und er ging schnell nach Großbritannien. Während seines Aufenthalts in England freundete sich Bethe mit Rudolf Peierls (1907–1995) an, einem Deutschen, der ebenfalls aufgrund seiner jüdischen Abstammung aus Deutschland geflohen war. Unter seinem Einfluss begann Bethe, Kernphysik zu studieren. Peierce wurde später Leiter des britischen Atombombenprojekts („Alloy Tube Project“) und traf Bethe in der Spätphase des Zweiten Weltkriegs erneut, um bei der Herstellung der Atombombe zusammenzuarbeiten. Aufgrund seiner herausragenden akademischen Fähigkeiten wurde Bethe bald von der University of Bristol und der Cornell University eingestellt. Die Cornell University erlaubte Bate, sich der Universität anzuschließen, nachdem er seinen Vertrag in Bristol erfüllt hatte. Im Jahr 1934 veröffentlichten Bethe und Walter Heinrich Heitler (1904–1981) gemeinsam eine Arbeit mit dem Titel „Über das Stoppen schneller Teilchen und die Erzeugung von Positronen“[9], in der sie die Streuung von Photonen an Atomen und Molekülen sowie den Prozess der Photonenvernichtung in Elektron-Positron-Paare untersuchten. In diesem Artikel wurde die berühmte „Bethe-Heitler-Formel“ vorgeschlagen. Dieser klassische Artikel wurde über 2.500 Mal zitiert. "Wettbibel" Im Februar 1935 kam Bethe an die Cornell University. Hier machte er große Fortschritte in seiner Forschung und freundete sich mit Edward Teller (1908–2003) und anderen an. Zwischen 1936 und 1937 veröffentlichte Bethe drei wichtige Arbeiten auf dem Gebiet der Kernphysik. Die erste Arbeit wurde gemeinsam mit Bacher (dem zweiten Autor) verfasst und behandelte die Stabilität des Atomkerns[10]. Die zweite Arbeit wurde von Bethe allein verfasst und behandelte die Theorie der Kerndynamik[11]. Die dritte Arbeit wurde gemeinsam mit Livingston verfasst (Milton Livingston, 1905-1986, der Erstautor) und diskutierte das Experiment der Kerndynamik[12]. Diese drei Arbeiten genießen auf dem Gebiet der Kernphysik einen hohen Stellenwert und wurden von einigen Wissenschaftlern damals als „Bethes Bibel“ bezeichnet. In einem Brief an seine Mutter schrieb ein überschwänglicher Bethe: „Ich bin einer der führenden Theoretiker in den Vereinigten Staaten. Das heißt nicht, dass ich der Beste bin. Wigner [Eugene Wigner, 1902-1995] ist sicherlich besser, und Oppenheimer und Taylor sind wahrscheinlich genauso gut wie er. Aber ich habe mehr getan und mehr gesagt, und das ist auch wichtig.“[6] Im Jahr 1937 lernte Bethe Rose Ewald (1917–2019) während einer Vorlesung an der Duke University kennen. Aufgrund der Verfolgung im nationalsozialistischen Deutschland floh sie ebenfalls in die Vereinigten Staaten. Ross' Vater, Paul Ewald (1888–1985), war ein berühmter Kristallograph und Physiker und ein Pionier der Röntgenbeugung. sein Doktorvater war ebenfalls Sommerfeld, er war also ein Kommilitone von Bethe. Aufgrund dieser Beziehung lernte Ross Bethe als Teenager in Deutschland kennen. Nachdem sie sich an der Duke University kennengelernt hatten, wurden die beiden ein Liebespaar und heirateten im September 1939. Bette und Frau Ewald (1967). Bildquelle: Public Domain Prometheus stahl das Feuer: Das Geheimnis der Sternenenergie lüften Bereits 1920 wies Eddington in seiner Arbeit darauf hin, dass die Energie von Sternen während des größten Teils ihrer Lebensdauer nicht aus der Kontraktion der Sterne, sondern aus der Fusion von Wasserstoffkernen (Protonen) stammt. Den genauen Vorgang der Wasserstofffusion zu Helium nannte Eddington jedoch nicht. Im Jahr 1937 schlugen George Gamow (1904–1968) und Carl von Weizsäcker (1912–2007) vor, dass Protonen im Kern der Sonne durch eine „Proton-Proton-Kettenreaktion“ (pp-Kettenreaktion) zu Helium verschmelzen und dabei Energie freisetzen. Darüber hinaus schlug Weizsäcker 1937 und 1938 den Kohlenstoff-Stickstoff-Sauerstoff-Kreisprozess (CNO) vor. In diesen Arbeiten blieben jedoch einige wichtige spezifische Prozesse noch unbekannt. Grundlage der pp-Kette ist die Reaktion der Protonenfusion zu Deuterium (D), die sogenannte pp-Reaktion: Dabei verschmelzen zwei Protonen zu Deuterium und setzen dabei ein Positron und ein Neutrino frei. Weizsäcker schlug Bethe vor, die pp-Reaktion zu untersuchen. Fast gleichzeitig bat Gamow auch seinen Schüler Charles Critchfield (1910-1994), die pp-Reaktion zu berechnen. Letzterer schloss die Berechnung Anfang 1938 ab, und Gamow schlug vor, das Papier zur Überprüfung an Bethe zu senden, da Bethe viele Berechnungen zu zweikernigen Reaktionen durchgeführt hatte.[13] Bate bestätigte, dass Critchfields Berechnungen korrekt waren. Die beiden arbeiteten daher gemeinsam an der Arbeit „Proton Combination to Form Deuterium“. [14] Der von Bethe und Critchfield berechnete Prozess läuft wie folgt ab: Zwei Protonen verbinden sich zu Deuterium, Deuterium verbindet sich mit einem Proton zu Helium-3, Helium-3 und Helium-4 verbinden sich zu Beryllium-7, Beryllium-7 zerfällt zu Lithium-7 und Lithium-7 verbindet sich mit einem Proton zu zwei Helium-4. Spätere Studien zeigten, dass es vier Arten von PP-Ketten gibt. Bethe und Critchfield berechneten, was heute als pp-Ketten vom Typ II bezeichnet wird. Die Kerntemperatur der Sonne beträgt 15,7 Millionen K. Der Hauptmodus der Wasserstofffusion in ihrem Kern ist die pp-Kette vom Typ I, die 81,6 % der Sonnenenergie beiträgt. Die pp-Kette vom Typ II trägt 16 % zur Sonnenenergie bei. Obwohl sie andere Arten von pp-Ketten nicht berücksichtigten, waren ihre Berechnungen für pp-Ketten des Typs II wichtig und bemerkenswert genug. Was die beiden beunruhigte, war die Tatsache, dass, wenn die Temperatur des Sonnenkerns 40 Millionen K betrug, wie Eddington zuvor geschätzt hatte, die erhaltene Helligkeit nach Einsetzen dieses Wertes in die Berechnung die beobachtete Helligkeit der Sonne bei weitem übersteigen würde. Am 17. März 1938 wurde Bethe eingeladen, an der vierten Jahreskonferenz für Theoretische Physik in Washington teilzunehmen, die von Gamow und Taylor veranstaltet wurde. Das Thema dieser Jahrestagung lautet „Die Erzeugung von Sternenenergie“. Bethe wollte die Einladung zunächst nicht annehmen, da sein Interesse zu diesem Zeitpunkt noch der QED galt. Auf Taylors Drängen hin nahm er jedoch trotzdem an dem Treffen teil. [13] Auf dieser Konferenz gab Bengt Strömgren (1908-1987) bekannt, dass die Temperatur des Sonnenkerns auf der Grundlage seiner Analysen und Berechnungen der chemischen Zusammensetzung der Sonne etwa 15 Millionen K und nicht 40 Millionen K betrage. Als 15 Millionen K in die Berechnungen von Bethe und Critchfield eingesetzt wurden, stimmte die resultierende Sonnenhelligkeit gut mit der beobachteten Helligkeit überein. Dies ist eine Ermutigung für Bate und andere. Nach der Konferenz dachte Bethe über Kernreaktionen im Inneren massereicherer Sterne nach. Je massereicher ein Stern ist, desto höher ist seine Kerntemperatur und desto höher ist seine interne Energieproduktionsrate. Bethe wusste, dass Lithium, Beryllium und Bor unter den Elementen, die schwerer als Helium-4 sind, zu selten sind, daher hielt er Kohlenstoff für einen möglichen Ausgangspunkt der Reaktion. [13] Nach zwei Wochen des Nachdenkens und Rechnens[13] entdeckte Bethe die CNO-Zyklusreaktion wieder. Der von Bethe entdeckte Zyklus lautet: Kohlenstoff-12→Stickstoff-13→Kohlenstoff-13→Stickstoff-14→Sauerstoff-15→Stickstoff-15→Kohlenstoff-12. Während des gesamten Prozesses wirken Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff als Katalysatoren und werden selbst nicht verbraucht. CNO-Zyklusprozess Typ I. In der Abbildung stehen H, He, C, N, O, ν und γ jeweils für Wasserstoff, Helium, Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Neutrino und Gammaphoton. Bildquelle: Borb Anschließend bombardierten Experimentalphysiker Kohlenstoff-12-Ziele mit Hochgeschwindigkeitsprotonen und fanden bald Hinweise auf den Zerfall von Stickstoff-13. Dies beweist, dass Bethes Berechnungen richtig waren. Spätere Studien zeigten, dass es im Inneren von Sternen mehrere Kanäle gibt, über die Wasserstoff im CNO-Zyklus zu Helium verschmelzen kann. Sowohl Weizsäcker als auch Bethe entdeckten den CNO-Zyklus Typ I, der daher auch „Bethe-Weizsäcker-Zyklus“ genannt wird. Bethe schrieb seine Forschungsergebnisse in einem Artikel mit dem Titel „The Generation of Stellar Energy“[15]. In dieser Arbeit berechnete Bethe außerdem sorgfältig die Reaktionsrate der pp-Kette und wies darauf hin, dass bei kleineren Sternen wie der Sonne die innere Energie hauptsächlich aus der pp-Kettenreaktion stammt; Die innere Energie massereicher Sterne stammt hauptsächlich aus dem CNO-Zyklus. Diese Schlussfolgerung ist auch heute noch richtig. In Bethes Arbeit wird die Beziehung zwischen der Produktionsrate und der Temperatur (in Einheiten von 1 Million K) der beiden Produktionsmethoden dargestellt. Die gepunktete Linie ist die pp-Kette, die gestrichelte Linie ist der CNO-Zyklus und die durchgezogene Linie stellt die Summe der beiden dar. Wenn die Kerntemperatur eines Sterns unter 15 Millionen K liegt, trägt die pp-Kette den größten Teil der Energie bei; Andernfalls trägt der CNO-Zyklus den größten Teil der Energie bei. Bildquelle: Referenz [15] Bethe reichte „The Generation of Stellar Energy“ bei Physical Review ein. Bald darauf bemerkte Bethes Doktorand Robert Marshak (1916–1992), dass die New York Academy of Sciences eine Belohnung von 500 US-Dollar (entspricht 10.915 US-Dollar im Jahr 2023) für die beste Arbeit über Sonnen- und Sternenenergie auslobte, vorausgesetzt, die Arbeit war noch nicht veröffentlicht. [13] Mashak erzählte Beth sofort die Neuigkeiten. Bate zog die Arbeit schnell zurück und schickte sie an die New York Academy of Sciences, wo er einen Preis von 500 Dollar gewann. Er gab Mashak 50 Dollar als Gebühr für die Informationen. Anschließend schickte er 250 Dollar an die deutsche Regierung, um sicherzustellen, dass ihr gesamter Besitz in Sicherheit wäre, als ihre Mutter, die sich auf ihre Flucht aus dem Land vorbereitete, umzog. [13] Schließlich wurde diese bahnbrechende Arbeit von Bethe erneut bei Physical Review eingereicht und im März 1939 veröffentlicht. Die Ergebnisse dieser Arbeit gelten nicht nur für die Sonne, sondern für alle Sterne in der Hauptreihenphase (Sterne im Zustand der Kernfusion von Wasserstoff). Ein Stern verbringt den größten Teil seines Lebens in der Hauptreihenphase. Der Mann hinter dem Manhattan-Projekt Nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in Europa begannen sich zahlreiche Wissenschaftler mit Themen im Zusammenhang mit der Waffenkonstruktion zu beschäftigen. Bethe bildete da keine Ausnahme und arbeitete mit Taylor zusammen, um die Theorie der Stoßwellen zu untersuchen, die entstehen, wenn eine Kugel durch ein Gas fliegt. Er forschte auch an der Theorie der Panzerdurchdringung, doch diese Theorie wurde vom Militär sofort als geheim eingestuft, und Bethe, der noch keine US-Staatsbürgerschaft besaß, konnte sich nicht weiter damit befassen. Im März 1941 erhielt Bethe die amerikanische Staatsbürgerschaft, was das größte Hindernis für seine militärwissenschaftliche Forschung beseitigte. Im Dezember 1941 erhielt Bethe schließlich die Sicherheitsfreigabe und trat dem Strahlungslabor des MIT bei. Dort erfand er den „Bethe-Loch-Richtkoppler“, der in Radaranlagen eingesetzt werden konnte. Nach dem offiziellen Start des Manhattan-Projekts wurde Oppenheimer zum wissenschaftlichen Direktor ernannt und war für die Koordinierung aller Abteilungen verantwortlich. Unter diesen Abteilungen ist die theoretische Abteilung für die Durchführung theoretischer Berechnungen und die Bestimmung der Durchführbarkeit verschiedener Pläne verantwortlich und ist daher die kritischste Abteilung. Oppenheimer wollte auch als Leiter der theoretischen Abteilung fungieren. Als Oppenheimer jedoch den Rat seines guten Freundes Isidor Rabi (1898-1988) zum Manhattan-Projekt einholte, machte Rabi zwei Vorschläge: Tragen Sie keine Militäruniformen; und bitten Sie Bethe, die Leitung der theoretischen Abteilung zu übernehmen. Obwohl Oppenheimer widerspenstig war, behandelte er den Rabbi respektvoll und gehorchte seinen Anweisungen. Darüber hinaus wusste er, dass Bethe, obwohl er zu diesem Zeitpunkt noch sehr jung (35 Jahre alt) war, bereits eine führende Persönlichkeit auf dem Gebiet der Kernphysik war. Bethe wurde daher eingeladen, die Leitung der theoretischen Abteilung zu übernehmen. Ein Foto von Bethes Ausweis während des Manhattan-Projekts mit der Ausweisnummer K3. Bildnachweis: Los Alamos National Laboratory Nach seinem Amtsantritt leitete Bethe die Mitglieder der theoretischen Abteilung bei der Berechnung wichtiger Fragen wie der kritischen Masse von Uran 235 (der Mindestmasse, bei der eine Kettenreaktion abläuft), der Effizienz, der Spaltungsproliferation, der Fluiddynamik der Explosion, der Neutroneninitiatoren und der Strahlungsausbreitung der Explosion. Außerdem entwickelte er gemeinsam mit Feynman, einem Mitglied der theoretischen Gruppe, eine Formel zur Berechnung der Sprengkraft einer Atombombe. [16] Im kritischen Moment angespannter Forschung und Entwicklung spielte Bethe eine Rolle bei der Stabilisierung der Moral der Truppen: Taylor berechnete, dass eine nukleare Explosion dazu führen würde, dass Stickstoff in der Erdatmosphäre zu Magnesium verschmelzen und Heliumionen freisetzen würde, wodurch enorme Energie freigesetzt würde und die Atmosphäre verbrennen würde; Bethe stellte sofort fest, dass diese Berechnung falsch war. Anschließend untermauerte er sein Urteil durch strenge Berechnungen und wies darauf hin, dass Taylors Berechnungen auf einer falschen Annahme beruhten. Bethes Berechnungen gaben Oppenheimer genügend Vertrauen. (Dies ist auch die Handlung in Nolans Film „Oppenheimer“.) Aufgrund der Arbeit am Manhattan-Projekt wurde Bethes Forschung im Bereich der Naturwissenschaften stark eingeschränkt. Im Jahr 1944 schien er mehr Zeit gefunden zu haben und veröffentlichte eine Arbeit über die Beugung elektromagnetischer Wellen an einer kreisförmigen Blende[17], die neue Erkenntnisse zum alten Beugungsproblem lieferte. Dieser Artikel wurde bisher mehr als 3.700 Mal zitiert. Am 16. Juli 1945 führten Teilnehmer des Manhattan-Projekts den ersten Atomtest der Menschheitsgeschichte durch – den Trinity-Test, und die erste Atombombe der Welt wurde erfolgreich gezündet. Die von Bethe geleitete Theoriegruppe trug maßgeblich zum Erfolg bei. Verschiedene nach der Explosion gemessene Daten bestätigten die Richtigkeit der theoretischen Berechnungsergebnisse. Während der Umsetzung des Manhattan-Projekts war die theoretische Abteilung die kostengünstigste und renommierteste aller Abteilungen. Als Leiter der theoretischen Abteilung kam Bethe keine geringere Rolle zu als Oppenheimer, der die Gesamtsituation koordinierte. Auch die Fakten haben Rabis Vision bestätigt: Bethe hat nicht nur ein herausragendes Talent in Physik, sondern verfügt auch über hervorragende Fähigkeiten zur Teamführung. Man kann sagen, dass Bethe die Seele des Manhattan-Projekts war. Dieser Artikel wird vom Science Popularization China Starry Sky Project unterstützt Produziert von: Chinesische Vereinigung für Wissenschaft und Technologie, Abteilung für Wissenschaftspopularisierung Hersteller: China Science and Technology Press Co., Ltd., Beijing Zhongke Xinghe Culture Media Co., Ltd. |
>>: Liebe Familienmitglieder, bitte stellen Sie keine Milch in das Gitter der Kühlschranktür! ! !
Artikel empfehlen
Kann regelmäßiges Seilspringen beim Abnehmen im Gesicht helfen?
Der Herausgeber ist der Meinung, dass Seilspringe...
Warum sind Konjak-Späne weiß und Konjak-Würfel schwarz?
Im Sommer wissen alle Dicken: „Wer zu viel isst, ...
Warum möchte ich beim Schlafen immer meine Füße aus der Decke strecken?
Es heißt, dass die Aussage „den Bauchnabel bedeck...
Li Bin gab bekannt, dass NIO bald sein viertes Produkt, eine Limousine, herausbringen wird
Am 18. November veröffentlichte NIO seinen Finanz...
Sind Fitnessbikes gut zum Abnehmen?
Heutzutage fahren die Menschen sehr gerne Fahrrad...
Was ist die richtige Haltung beim Seilspringen?
Seilspringen ist eine Aerobic-Übung, die von Männ...
Das antike Grab liegt seit Tausenden von Jahren unter der Erde. Können die Mechanismen im Inneren rosten? Daran hatten schon die Alten gedacht.
Früher erfreuten sich Filme, Fernsehsendungen und...
Seit drei Monaten befindet sich die „Weltraum-Geschäftsreise“ im Orbit. Was sind die Erwartungen für die zweite Hälfte?
Originaltitel: Der Zeitplan für die „Weltraum-Ges...
GTCI: Global Talent Competitiveness Index Report 2020
GTCI hat den „2020 Global Talent Competitiveness ...
AMDs neues Flaggschiff A12-9800 im Test: Endlich DDR4-Speicher im Einsatz
Intel hat mit dem Vorverkauf des Core KabyLake de...
Analyse der Beziehung zwischen Alibaba Cloud OS und mehr als 30 Partnerherstellern
Am 21. Oktober, nach der Meizu-Ali-Strategiekonfe...
So führen Sie Rückenmuskelübungen am effektivsten durch
Im heißen Sommer tragen wir im Alltag weniger Kle...
Werden sich die parallelen Linien der Traurigkeit eines Tages kreuzen?
Wenn es um parallele Linien geht, kennt sie jeder...