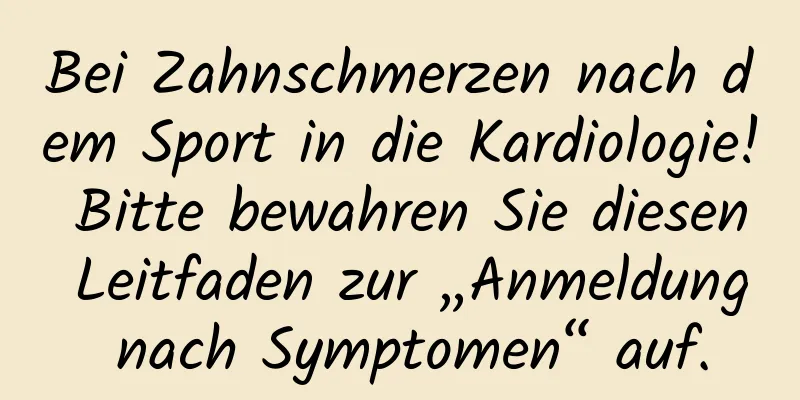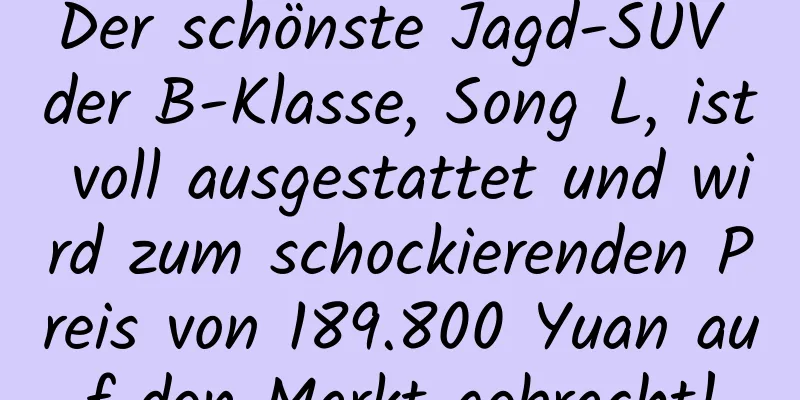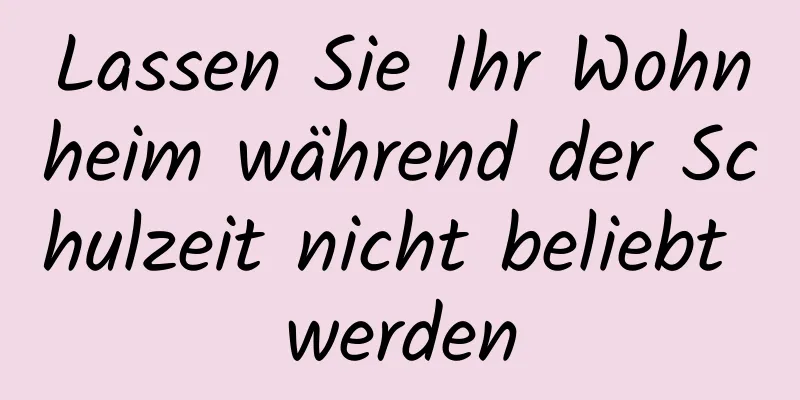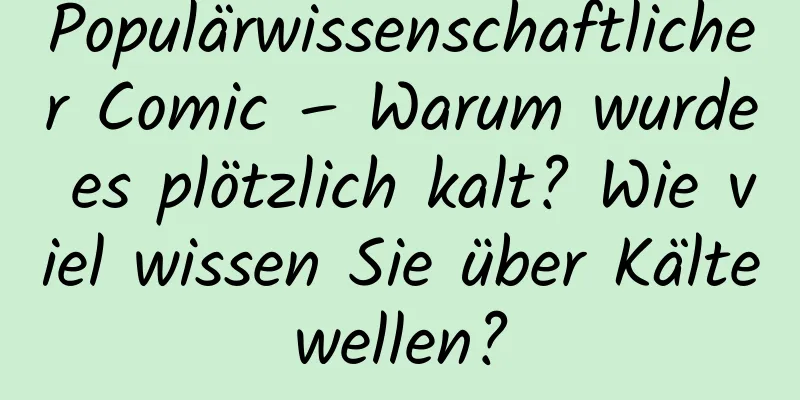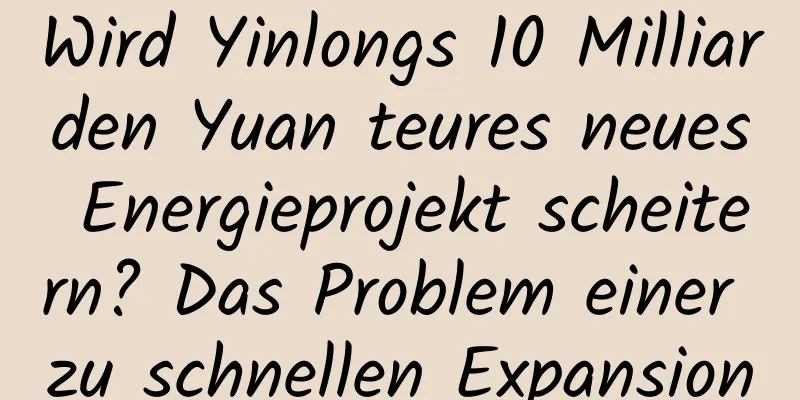Obwohl die „Seeungeheuer“ der vorwissenschaftlichen Ära übertrieben dargestellt wurden, waren sie für die Sicherheit auf See sehr nützlich! Hat es auch eine „Verzerrungswissenschaft“ geschaffen?
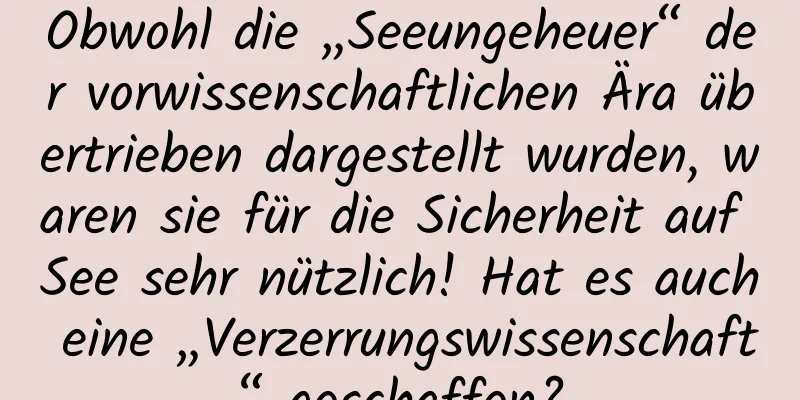
|
© Kongressbibliothek Leviathan Press: Wer „Octopath Traveler“ gespielt hat, hat vielleicht die seltsamen Meeresungeheuer auf der Spielkarte bemerkt. Diese Meereslebewesen scheinen einen Ursprung zu haben. Die Designerin dieser Karte, Francesca Baerald, hat an der Erstellung der Karten für „Der Herr der Ringe“ und „Das Lied von Eis und Feuer“ mitgewirkt und hat eine besondere Vorliebe für Konzeptkarten. Octopath Traveler-Spielkarte, gezeichnet von Barrard. © Francesca Baerald Tatsächlich haben diese Bilder von Seeungeheuern ihre eigenen Traditionen. Sie können die Schatten von Plinius dem Älterens „Naturgeschichte“, Magnus‘ „Atlas“, Ortelius‘ „Kap des Theaters Orbis“ und Conrad Gessners „Geschichte der Tiere“ sehen. Ich war schon immer von diesen vorwissenschaftlichen Seeungeheuern fasziniert, auch weil in dieser Art von Fiktion – oder, wie ich es lieber nenne, Verzerrung – so viele lustige Dinge verwickelt sind. Eine riesige Schlange mit Drachenkopf wickelte sich vor der Küste Norwegens um ein hilfloses Schiff und ein riesiges Monster schnappte sich in der Nähe der Färöer-Inseln eine Robbe. Und vor der Küste Schottlands packte ein riesiger Hummer einen sterbenden Mann mit seinen Scheren. Polypus (was „vielbeinig“ bedeutet) ist ein Begriff, der zur Beschreibung vieler Lebewesen verwendet wird, vom Hummer über den Tausendfüßler bis zum Kraken. Magnus zeichnete in seine Karte einen riesigen Hummer, sein Text beschrieb jedoch einen Oktopus, was auch die Verwirrung zeigt, die die Menschen damals in Bezug auf das Leben im Meer hatten. © Kongressbibliothek Die Bilder erschienen in der Carta Marina, einer Karte aus den späten 1530er Jahren, die zum maßgeblichen Leitfaden für Kartografen, Schriftsteller und Gelehrte wurde, die die europäischen Meere erforschten. Die Karte dominierte die nächsten 50 Jahre, doch erst ein Jahrhundert später gaben Experten zu, dass einige der Darstellungen nicht realistisch waren, und erst im frühen 18. Jahrhundert begann man, bestimmte Monster von neuen Karten auszuschließen. „Viele der Bilder wirken geradezu phantasievoll. Man kann sich gut vorstellen, dass die Kartografen sie spontan erfunden haben“, sagte Chet Van Duzer, Kartenhistoriker und Autor des Buches „Sea Monsters on Medieval and Renaissance Maps“. Seekarte. © Kongressbibliothek Der „Atlas“ wurde vom schwedischen Erzbischof Olaus Magnus erstellt. Er schuf tatsächlich das Aussehen einiger Seeungeheuer – die meisten davon sind das, was wir heute als Wale kennen. Van Duzel sagte jedoch, dass viele von Magnus‘ Monstern aus der Illustrated Encyclopedia entlehnt seien. Einige dieser Bilder lassen sich auf Beschreibungen in Plinius dem Älteren in seiner Naturalis Historia aus dem ersten Jahrhundert n. Chr. zurückführen. Magnus‘ „Atlas“ ist eines der frühesten geographischen Meisterwerke Europas. Es entstand in einer Zeit, in der die Menschen neugierig auf Wissenschaft und Entdeckungen waren, aber dennoch verschiedene Fantasien über die Natur hatten. Die Menschen glaubten damals an Lebewesen, die sie nie gesehen hatten, wie Drachen und Seeschlangen. Magnus‘ Autorität, gepaart mit seinem Respekt vor dem gedruckten Wort, ließ selbst die wildesten Darstellungen von Walen realistisch erscheinen, sagte Düzel. Erstellung von Seekarten Die Karten von Magnus sind groß. Die Originalkarte umfasste eine Fläche von 23 Quadratfuß (etwa 2,1 Quadratmetern) und stellte ein flaches, aber detailliertes Nordeuropa dar. Dazu gehörten das heutige Dänemark, Estland, Finnland, Island, Lettland, Litauen, Norwegen, Schweden und der nördlichste Teil der Britischen Inseln. Magnus wurde 1490 in Schweden in eine angesehene Familie geboren und besuchte die Universität in Deutschland. Die Reformation zwang Magnus, nach Italien zu ziehen, wo der Atlas geboren wurde. Nach seiner Ernennung zum Erzbischof im Exil arbeitete Magnus zwölf Jahre lang an der Karte, die erst 1539 gedruckt wurde. Diese Karte steht in engem Zusammenhang mit seiner Karriere und Ausbildung. Einige der von Magnus dargestellten Monster stammen aus dem Alten Testament, wie beispielsweise die Seeschlange, damals bekannt als Leviathan, die in den Psalmen, im Buch Hiob und im Buch Jesaja erwähnt wird. In „The Underworld: Journeys to the Depths of the Oceans“ schreibt Susan Casey, dass er die Karte durch die Linse der Kirchenlehre gefiltert habe. Sie fügte hinzu, dass Magnus‘ Timing perfekt war. In Europa war damals das Zeitalter der Entdeckungen angebrochen und die Entwicklung der Drucktechnologie brachte einem nach mehr Informationen dürstenden Publikum fantastische Ideen. Seit der Erfindung des Buchdrucks war ein Jahrhundert vergangen, doch nur wenige Europäer konnten lesen. Magnus‘ Karte erforderte keine Lese- und Schreibkenntnisse und lieferte ein Bild der Monster, die die Menschen aus der Bibel oder aus mündlichen Überlieferungen kannten. Im Atlas dienen Seeungeheuer nicht nur einem dekorativen Zweck, wie dies auf anderen Karten der Renaissance der Fall ist. in manchen Fällen, sagt Van Duzel, dienen sie als Warnung vor furchterregenden Monstern, die in gefährlichen Gewässern lauern. Insgesamt spiegeln sie die großen Ängste der damaligen Zeit vor den Gefahren der Seereise wider. Das vom Seeungeheuer zerstörte Schiff symbolisiert die extreme Gefahr der Hochseeschifffahrt. © Olaus Magnus Ihre Sorgen sind nicht unbegründet. In „In Scurvy: Wie ein Chirurg, ein Seemann und ein Gentleman das größte medizinische Rätsel des Segelzeitalters löste“ schreibt Stephen R. Brown, dass im 16. Jahrhundert allein Skorbut für eine Sterblichkeitsrate von 50 Prozent auf langen Reisen verantwortlich war. Unfälle, Ertrinken und Infektionskrankheiten führten dazu, dass viele Menschen, die zur See fuhren, tot auf dem Meeresgrund landeten. Der Ozean ist ein unglaublich gefährlicher Ort und Magnus‘ Karte spiegelt die Angst der Menschen vor dem Unbekannten und ihren Wunsch wider, es zu zähmen. Seewürmer Vor der Küste Norwegens stellt Magnus eine leuchtend rote Seeschlange dar, die ein schiefes Schiff angreift, als ob es ins Wasser gezogen werden wollte. Seeschlangen basieren teilweise auf Legenden, darunter biblische Beschreibungen eines schlangenartigen Seeungeheuers. Es basierte auch auf Informationen, die Magnus von Seeleuten gesammelt hatte, die ein gigantisches Monster vor der Küste Norwegens beschrieben. Sie behaupten, die Seeschlange sei 200 Fuß lang (ungefähr die Länge von fünf Stadtbussen) und habe einen Durchmesser von 20 Fuß (ungefähr die Höhe eines U-Bahn-Tunnels) gehabt. Bei der Seeschlange könnte es sich um einen Riesenkalmar oder ein Flossenfüßer wie eine Robbe oder einen Seelöwen handeln. Andere wiederum haben vorgeschlagen, dass es sich bei Seeschlangen um Haie, Wale oder Riemenfische handeln könnte. © Olaus Magnus Im 19. Jahrhundert versuchten Wissenschaftler herauszufinden, was Seeschlangen im wirklichen Leben gewesen sein könnten. Laut Joseph Nigg, Autor von „Sea Monsters: The Lore and Legacy of Olaus Magnus‘s Marine Map“, ist es möglich, dass es sich bei den Kreaturen um Riesenkalmare oder Flossenfüßer wie Robben oder Seelöwen handelte. Andere wiederum haben vorgeschlagen, dass es sich bei Seeschlangen um Haie, Wale oder Riemenfische handeln könnte. Künstlerische Darstellung einer „Seeschlange“, die 1848 von der Fregatte HMS Daedalus entdeckt wurde. Es wird gesagt, dass die Seeschlange etwa 20 Minuten lang auf der Meeresoberfläche schwamm und dem Boot folgte. © Wikipedia Im Oktober 2013 wurde in der Toyon Bay auf Catalina Island vor der Küste Kaliforniens ein Riemenfisch gesichtet. © Mit freundlicher Genehmigung des Catalina Island Marine Institute Magnus schrieb 1555 in seiner „Geschichte der Völker des Nordens“, dass Seeschlangen ihre Köpfe über die Seite eines Schiffes strecken und ahnungslose Seeleute vom Deck ins Meer ziehen könnten. Er behauptete außerdem, dass Seeschlangen über Land kriechen und Vieh fressen oder ins Meer kriechen könnten, um Meereslebewesen zu jagen. Andere Historiker und Kartografen hätten bereits im 18. Jahrhundert Seeschlangen in ihren Werken abgebildet, sagte Nigg. Priester Die Seeungeheuer in The Charts sind im Allgemeinen bösartig und scheinen entschlossen, jedem Menschen, dem sie begegnen, Schaden zuzufügen. Seepriester sind besonders gefährlich und aggressiv. Magnus schrieb in seinem Buch von 1555, dass sie bis zu 200 Fuß lang waren, einen breiten, gegabelten Schwanz, Flossenfüße, ein an ein Warzenschwein erinnerndes Gesicht und zwei Blaslöcher auf der Oberseite ihres Kopfes hatten. Magnus schrieb in seinem Buch von 1555, dass der Meerespriester bis zu 200 Fuß lang war, einen breiten, gegabelten Schwanz und Flossenfüße hatte, ein Gesicht ähnlich dem eines Warzenschweins und zwei Blaslöcher auf der Oberseite seines Kopfes. © Olaus Magnus Van Duzel sagte, das Monster basiere, wie die meisten anderen Meerestiere im Atlas, auf Beschreibungen von Walen. Wale waren den Menschen damals zwar bekannt, doch sie sahen sie meist nur an der Oberfläche. Auf der Karte ist außerdem zu sehen, wie ein gestrandeter Wal ausgeweidet wird, um sein Fleisch und seine Knochen zu gewinnen (unten). © Olaus Magnus Magnus berichtet, dass Meerespriester ihre Schwänze in ein Schiff schlagen oder es versenken konnten, indem sie sich auf das Deck warfen. Dieses schwertfischähnliche Wesen wird von einem nashornähnlichen Wesen angegriffen. Es heißt, dass die Schwertfische unter Schiffen hindurchschwimmen, deren Rümpfe zerschneiden und sie so zum Sinken bringen. © Olaus Magnus Mit furchteinflößenden Horngeräuschen und leeren Fässern versuchten die Matrosen das angreifende Seeungeheuer zu verscheuchen. © Olaus Magnus Van Duzel vermutet, dass Magnus im Atlas Informationen darüber lieferte, wie man sich vor den Meerespriestern schützen kann. In den Gewässern vor Island stürmten zwei Meerespriester auf ein Schiff zu. „Hinter dem Schiff steht ein Mann. Man könnte meinen, er hält eine Waffe, aber es ist eine Trompete“, sagte er. „ Das Blasen der Trompete war eine der wenigen wirksamen Methoden, Seeungeheuer zu verscheuchen. “ Andere Kartografen stimmen dem zu, und Nigg sagt, dass sie Magnus‘ Meerespriester seit Jahrzehnten auf ihren Karten eingezeichnet haben. Inselwale Laut Seekarte ist das Meer zwischen Norwegen und Island sehr gefährlich. Vor der Küste Norwegens stellte Magnus den gefährlichen Moskstraumen dar, einen realen Ort, der noch heute existiert. Zwischen den Seeschlangen und den Seepriestern platzierte Magnus den Inselwal, ein sehr trügerisches Tier. Magnus beschrieb den gefährlichen „Moskern-Strudel“ in seiner „Seekarte“. © Wikipedia Illustration aus Edgar Allan Poes Roman „Ein Abstieg in den Mahlstrom“ von Harry Clarke (1889–1931), erschienen 1919. © Wikipedia Inselwale sind eine jahrtausendealte Legende, die auf einen Brief Alexanders des Großen an Aristoteles um das Jahr 300 n. Chr. zurückgeht, in dem die Geschichte von zwei Seeleuten erzählt wird, die sich auf einer Insel ausruhten, die sie für eine hielten. Sie gingen an Land, schlugen ihr Lager auf und machten ein Lagerfeuer. Von diesem Moment an begann der Albtraum. „**Es stellte sich heraus, dass es keine Insel war, sondern ein riesiger Wal.** Der Wal spürte das Feuer und sank in die Tiefsee, wobei er die Menschen mit sich riss“, sagte Van Duzel. Ahnungslose Seeleute kochten sich vor der Küste Islands auf einem Seeungeheuer. © Wikipedia Auf der „Karte“ ähnelt Insulaecetus einer Kreuzung aus Stegosaurus und Nashorn, war aber höchstwahrscheinlich nur der Wal, den wir heute kennen. Van Duzel sagte, dass die Menschen damals eher glaubten, was sie lasen – wenn sie überhaupt lesen konnten. „Der gedruckte Text und die dazugehörigen Abbildungen stießen auf großen Respekt.“ Manche Monster, wie etwa die Seeschlange, brauchten mehr als ein Jahrhundert, bis sie entlarvt wurden. Viele andere Monster verschwanden im Laufe des nächsten Jahrhunderts von den Karten, da es den Kartografen gelang, realistischere Darstellungen des Meereslebens zu integrieren. Seeschwein (Monsterschwein): Wenn Schweine schwimmen könnten, würden sie so aussehen. Das Tier wurde angeblich 1537 in der Nordsee entdeckt. Das Seeschwein wird mit einem Heiden verglichen, der die Wahrheit verdreht und wie ein Schwein lebt. © Wikipedia Bei dieser grünen Substanz handelt es sich nicht um ein Seeungeheuer, es wird spekuliert, dass es Ambra ist. © Wikipedia Eine riesige Seekrabbe greift eine Seeschlange an. © Kongressbibliothek Krake: Nach dem modernen allgemeinen Wissensstand glaubt die Öffentlichkeit im Allgemeinen, dass es sich bei dem Bild des Kraken um einen Riesenkalmar handelt. Dieses Seeungeheuer wird nicht nur in Skandinavien gemunkelt, sondern es gibt auch in der nordischen Mythologie entsprechende Legenden über dieses Seeungeheuer. © Kongressbibliothek Im Jahr 1861 versuchte die Alecton vor Teneriffa, einen Riesenkalmar zu fangen. © Seeungeheuer entlarvt 1981 wurde ein vollständiger Riesenkalmar gefangen. © Remeslo Anmerkung des Herausgebers: Derzeit glauben die meisten Wissenschaftler, dass Abraham Ortelius‘ Theatrum orbis terrarium der erste moderne Atlas ist. Zwischen 1570 und 1612 wurden 31 Ausgaben von L'Arc des Orbis gedruckt. Der Atlas enthält zahlreiche Abbildungen von Seeungeheuern. Es ist vielleicht nicht überraschend, dass der erste moderne Atlas Abbildungen von Seeungeheuern und anderen Fabelwesen enthielt. Auch das Seeungeheuer von Ortelius war von Magnus beeinflusst. Das Seeungeheuer in „Kap von Orbis“. © Wikipedia Vergleicht man „Cape of the Orbis“ mit Magnus‘ „Sea Chart“, fällt unschwer auf, dass die Seeungeheuer, die in „Sea Chart“ oft Menschen angreifen, in „Cape of the Orbis“ oft in Form harmloser Exemplare auftreten. Steipereidur ist eine sanfte Walart. Es wird Fischern helfen, wenn sie Kämpfe zwischen Fischern und anderen Walen beobachten. Daher besteht ein Verbot, diese Wale zu töten. Mindestens 100 Ellen (ungefähr 150 Fuß, 46 Meter) lang. © Wikipedia Skautuhvalur, bedeckt mit Borsten und Knochen. Es ähnelt ein wenig einem Rochen, ist aber viel größer. Wenn es erscheint, ähnelt es einer Insel und kann mit seinen Flossen Boote zum Kentern bringen. © Wikipedia Nach Angaben des isländischen Ministeriums für Landwirtschaft und Fischerei gibt es in den isländischen Gewässern nur zwei Rochenarten und keine von ihnen ist groß genug, um ein Boot zum Kentern zu bringen. Das Bild von Ortelius könnte in irgendeiner Weise von Magnus beeinflusst worden sein. Obwohl es einige Ähnlichkeiten in den Bildern gibt, sind die Beschreibungen völlig unterschiedlich. Die von Magnus beschriebenen Strahlen gelten als Musterbeispiele der Tugend. In „Sea Charts“ (oben) retten Rochen einen Fischer, der ins Meer gefallen ist und von hungrigen Fischen gefressen wird. © Wikipedia Das namenlose Seeungeheuer am Kap Orbis: Es wird als „die größte Walart beschrieben und erscheint nur selten über Wasser. Es ähnelt eher einer Insel als einem Fisch. Aufgrund seiner Größe und seines Gewichts ist es nicht in der Lage, kleinere Fische zu jagen, kann aber dank seiner Intelligenz viele davon erbeuten.“ © Wikipedia Hroshualur: „Das ist das Seepferdchen, dessen Mähne vom Hals herabhängt. Es fügt den Fischern oft großen Schaden zu und schreckt sie ab.“ Interessanterweise stammt das im „Kap von Orbis“ abgebildete Hroshualur nicht aus der „Seekarte“. Es hat einen noch älteren Ursprung, nämlich den Hippocampus aus der griechischen Mythologie. Künstler der Renaissance verwendeten in ihren Illustrationen häufig Seepferdchen. Das Seepferdchen wurde mit Poseidon, dem griechischen Gott des Meeres, und später mit seinem römischen Gegenstück Neptun in Verbindung gebracht. © Wikipedia Ein Seepferdchen, gezeichnet vom Schweizer Naturforscher und Bibliographen Conrad Gesner (1516–1565). © Wikipedia Englischer Wal: Der in „Cape Orbis“ beschriebene „Englische Wal“ ist zahnlos, hat aber dem Bild nach zu urteilen tatsächlich Zähne. Ortelius‘ Illustration basierte nicht auf einer Art, die als „Britischer Wal“ bekannt ist. Vielmehr handelt es sich hierbei um die Illustration eines Berichts über einen bestimmten Wal, der am 27. August 1532 in der Nähe der Themsemündung strandete (oben). Er beschrieb die Proportionen des Wals, einschließlich seines Mauls und Körpers, sehr detailliert. Er sagte, es habe lange „Flügel“, die halb so lang seien wie sein Körper. Dieser Fisch hat keine Zähne, aber lange Barteln am Oberkiefer und eine lange Zunge. Und hat einen riesigen Penis. Die meisten modernen Menschen würden anhand seiner Aussage erkennen, dass es sich um eine Art männlichen Bartenwal handelte. Ortelius‘ Illustration zeigt Arbeiter, die den stinkenden Walkadaver zerhacken und verarbeiten. Ortelius schien einige Schwierigkeiten damit zu haben, den Bericht in Bilder umzuwandeln. Aus den „Flügeln“ wurden die Füße des Drachen und die Barten wurden als eine Reihe von Dreiecken gezeichnet, die stark an Zähne erinnerten. © Wikipedia Nahval: Im Ozean nördlich von Island wird das Monster im „Horn des Orbis-Landes“ als „eine Art Fisch, allgemein Nahval genannt. Wer diesen Fisch isst, stirbt sofort. Im Kopf hat er einen hervorstehenden, 7 Ellen langen Zahn. Die Leute glauben, er sei ein gutes Gegenmittel und eine starke Medizin gegen Gift. Dieses Monster ist 40 Ellen lang.“ Die Menschen späterer Generationen glaubten im Allgemeinen, dass der Narwal der Prototyp dieser Spezies gewesen sei. © Wikipedia Staukul: Auf Niederländisch „Springual“ genannt. Es wurde beobachtet, dass er einen ganzen Tag lang aufrecht mit seinem Schwanz auf der Meeresoberfläche stand. Stockul erhielt seinen Namen aufgrund seiner Sprungkraft. Es ist ein sehr gefährlicher Feind der Seefahrer und Fischer und macht unersättliche Jagd auf Menschenfleisch. „Springender Wal“ ist eine andere Bezeichnung für den Killerwal. Das Vorkommen von zwei unterschiedlichen Namen für Orcas in der Literatur dieser Zeit lässt darauf schließen, dass Informationen aus unterschiedlichen Quellen möglicherweise zu Verwirrung geführt haben. Ortelius wusste sicherlich von Orcas, da er und viele andere Künstler sie dargestellt hatten, doch die Beschreibungen der „hüpfenden Wale“ waren so unterschiedlich, dass er sie nie für dasselbe Lebewesen hielt. © Wikipedia Rostunger: Es sieht aus wie ein Kalb, hat vier kurze Beine und kann auf dem Meeresboden laufen. Die Haut ist dick und kann von scharfen Klingen nicht durchstochen werden. Zum Schlafen nutzt es zwei über einen Meter lange Stoßzähne, um sich an Felsen festzuhalten. Es kann 12 Stunden am Stück schlafen. Es wird vermutet, dass es sich um ein Walross handelt. © Wikipedia Ziphius ist eine Verballhornung von Xiphias, was wiederum vom griechischen Wort für „Schwert“ abgeleitet ist. Ortelius hätte ziemlich sicher sein sollen, dass es sich um einen Schwertfisch handelte, aber er fügte hinzu, dass sein Gesicht einer Eule ähnelte. Tatsächlich hat er so gezeichnet (wie oben gezeigt). © Wikipedia Von Emilie Lucchesi Übersetzt von tamiya2 Korrekturlesen/tim Originalartikel/www.nationalgeographic.com/history/article/carta-marina-renaissance-sea-monsters Dieser Artikel basiert auf der Creative Commons License (BY-NC) und wird von tamiya2 auf Leviathan veröffentlicht Der Artikel spiegelt nur die Ansichten des Autors wider und stellt nicht unbedingt die Position von Leviathan dar |
Artikel empfehlen
Eltern, diese 6 Lebensmittel, die Sie für gesund halten, sind in Wirklichkeit nicht sehr nahrhaft …
„Mehr davon zu essen ist gut für Ihre Gesundheit!...
Selbst die Polizei kann nicht sagen, ob eine iPhone-förmige Anti-Explosionswaffe echt oder eine Fälschung ist
Die kanadische Polizei hat kürzlich zwei tödliche ...
Dong Mingzhu sollte nicht „über Billigkeit reden“: Es ist Zeit für Gree, sich zu verändern
Die Klimaanlagen von Gree sind sehr gut, aber Don...
Welche Übungen sind die schnellsten zum Abnehmen?
Heutzutage streben immer mehr Menschen nach einem...
Teslas schwache Verkäufe in China: Die Debatte um ein geschlossenes Ökosystem
Am 17. Juni gab Tesla bekannt, dass das Model S w...
Essen und trinken Sie immer noch nach Lust und Laune? Seien Sie vorsichtig beim „Auslesen“ von Dickdarmkrebs… Sind Sie von diesen Essgewohnheiten betroffen?
Unsere körperliche Gesundheit hängt eng mit unser...
Kann das Tragen einer Maske über einen längeren Zeitraum Lungenknötchen verursachen? Gerüchte auf der Science Rumors List vom September
1. „Die Schädlichkeit der Betelnüsse ist nicht so...
Wird man dicker, je mehr man abnimmt? Diese Übung müssen Sie gemacht haben.
Beachten Sie, dass einige Fitnessübungen zu einer...
Welche Veränderungen können die Natrium-Ionen-Batterien von CATL, die im Juli auf den Markt kommen, für Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnologie mit sich bringen?
Im Bereich der Fahrzeuge mit alternativer Antrieb...
GAC Aion und Huawei entwickeln gemeinsam intelligente Elektrofahrzeuge, wobei jede Partei mehr als 100 Mitarbeiter investiert
In einer Zeit, in der das Konzept von Fahrzeugen ...
Was sind Aerobic-Box-Fitness-Angebote?
Aerobic-Kampf-Aerobic ist eine sehr gute Möglichk...
SOCAP: Wie sollten Reisemarken Big Data nutzen, um das Kundenerlebnis zu verbessern?
Die Society of Consumer Affairs Professionals (SO...
Warum wird Samsung TouchWiz immer wieder kritisiert? Der Grund liegt nicht am Produkt
Kürzlich hat Reuters auf Grundlage von Enthüllunge...
Der ungelöste Fall des Jahrhunderts: Was passiert, wenn man eine Katze in eine Kiste steckt und eine Flasche Gift hineinlegt?
Sie haben vielleicht schon einmal vom Thema „Quan...