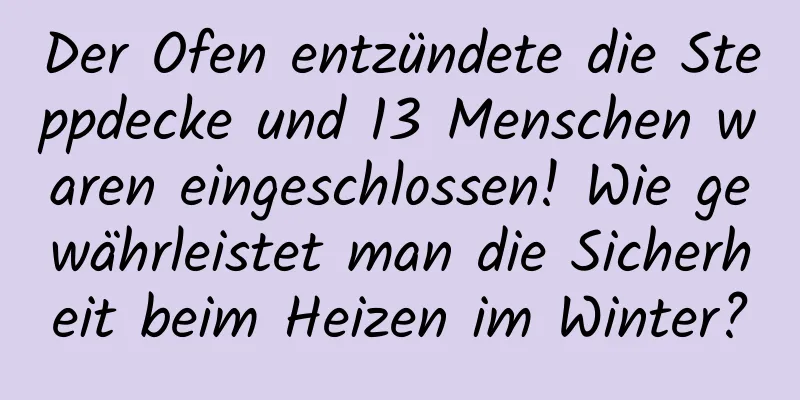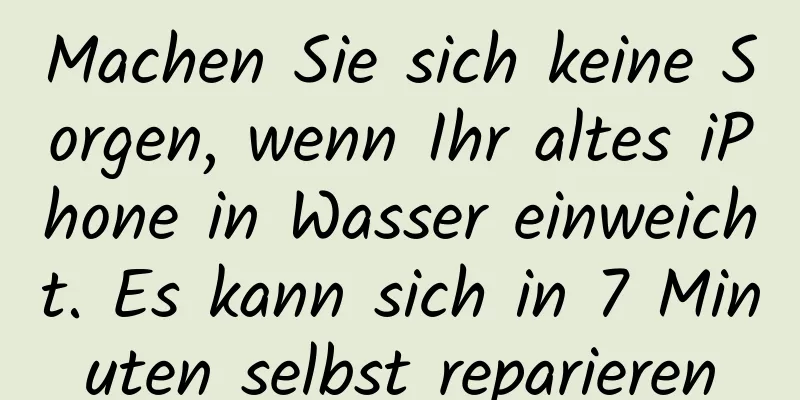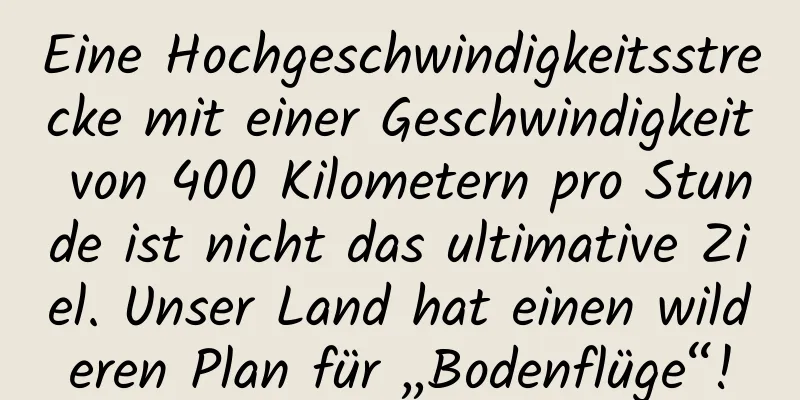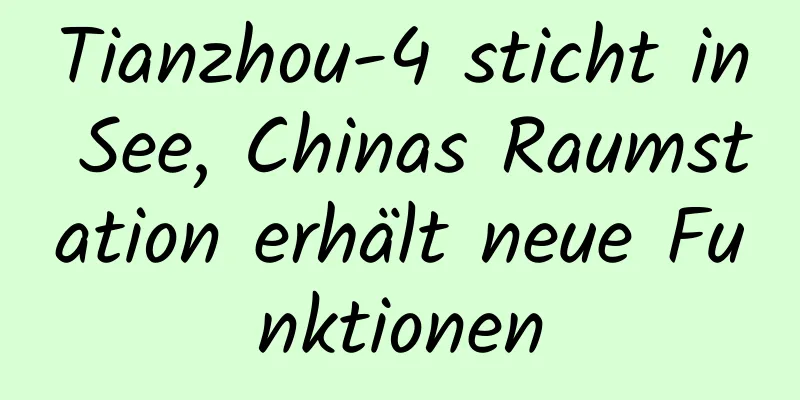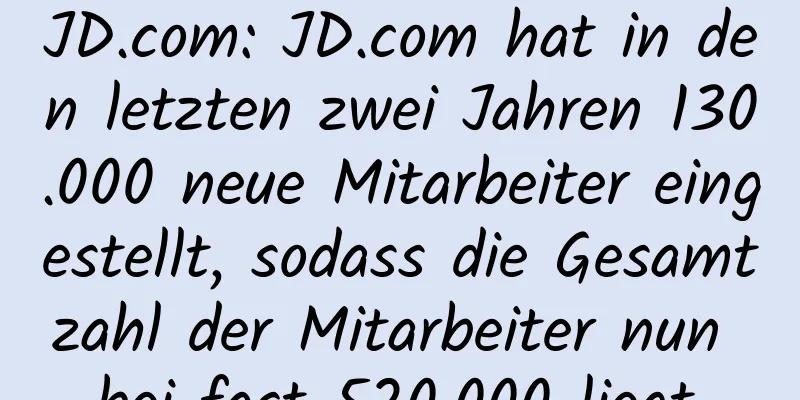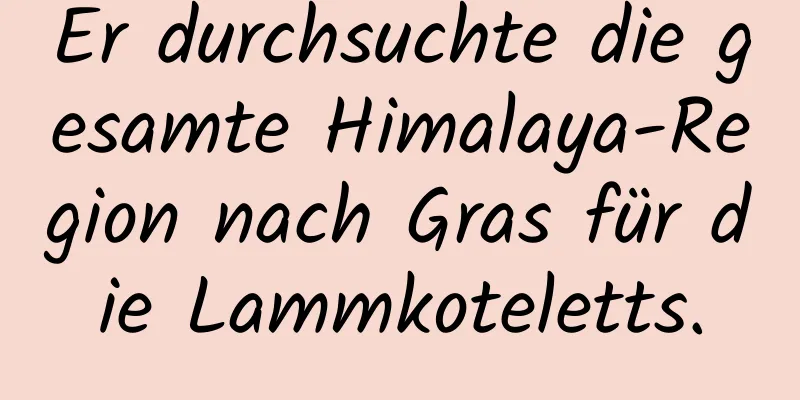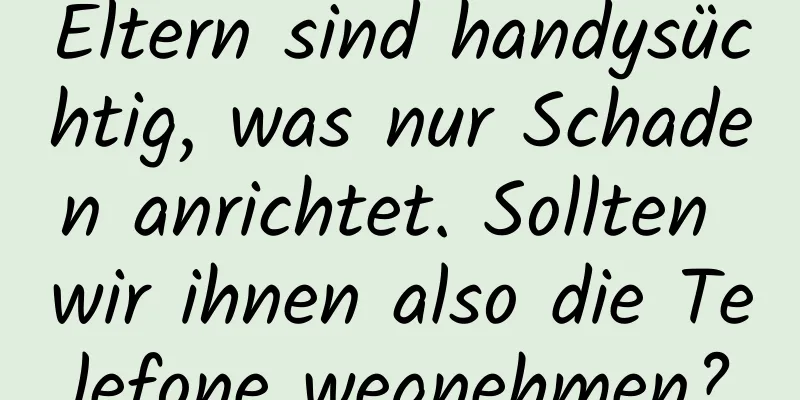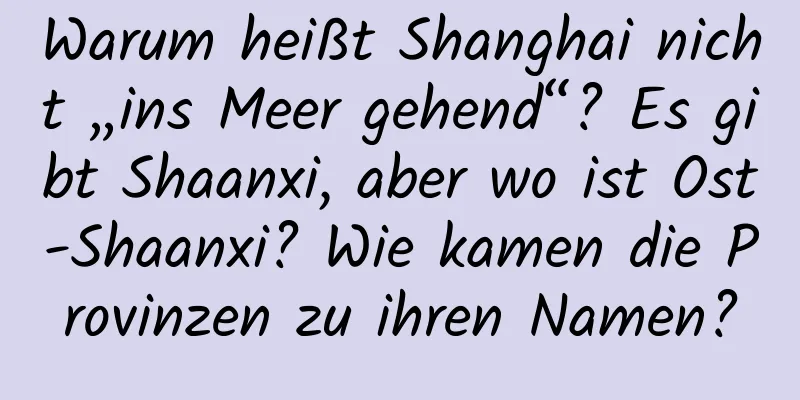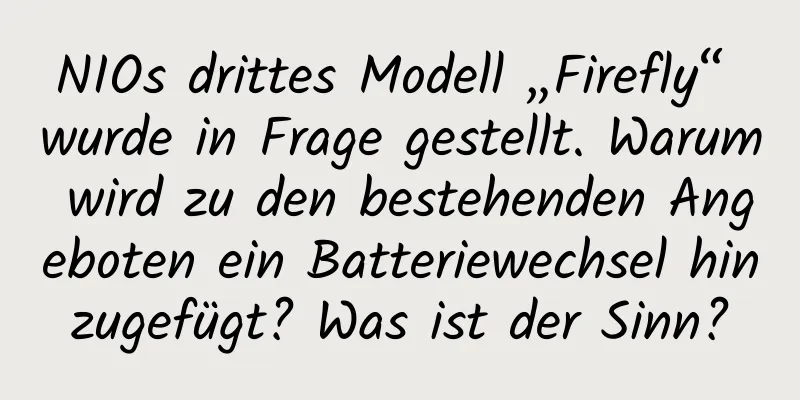Gerät das Gehirn aufgrund des globalen Klimawandels „außer Kontrolle“?
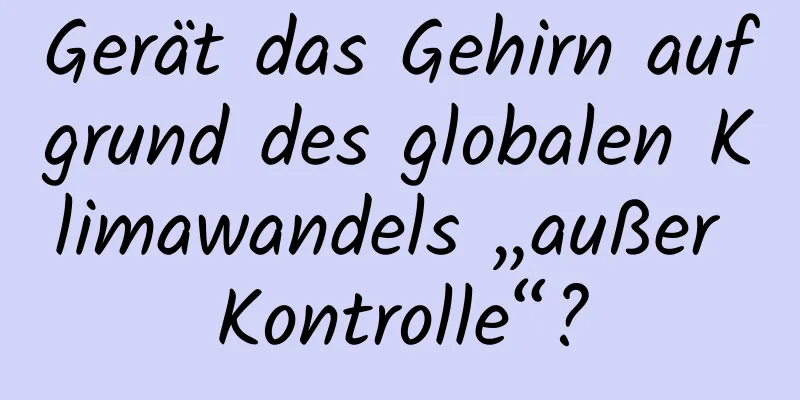
|
Leviathan Press: In einem früheren Artikel mit dem Titel „Die seltsamen Bisse der Zecken“ wiesen die Autoren darauf hin, dass mit dem globalen Klimawandel die von Zecken ausgehenden Risiken zunehmen, da sie die Möglichkeit haben, ihr geografisches Verbreitungsgebiet auszudehnen und in neue Wirte einzudringen. In Nordamerika arbeiten die Lone-Star-Zecke und die Schwarzbeinige Zecke zusammen, um nach Norden nach Kanada vorzudringen. Ich habe schon einmal einen erschreckenden Videobericht gesehen: Aufgrund des warmen Winters nahm die Zahl der überwinternden Zecken stark zu, und die Rentiere waren dicht mit Zecken bedeckt und starben schließlich, weil sie Blut gesaugt hatten. Dies ist nur eine sehr kleine ökologische Veränderung, die durch den Klimawandel verursacht wird. Vielleicht, so der Autor des heutigen Artikels, wird unser Gehirn angesichts der immer extremeren Klimaverhältnisse zu einem der Bereiche, die am anfälligsten für den Klimawandel sind – und das ist keineswegs übertrieben. Im Februar 1884 betrat der britische Kunstkritiker und Universalgelehrte John Ruskin die Bühne der London Institution, um zwei Vorträge zum Thema Wetter zu halten. „Die Sturmwolken des 19. Jahrhunderts“ ist sein wütender Angriff auf einen bestimmten „Wind der Dunkelheit“ und eine „Plagewolke“. Juli-Gewitterwolke im Aostatal, John Ruskin, 1858. © Wikipedia Seiner Ansicht nach hat dieses Phänomen erst in den letzten Jahren begonnen, viktorianische Städte zu erfassen. Er erzählte seinem skeptischen Publikum, dass er sorgfältige meteorologische Messungen durchgeführt habe. Er prangerte die „Bitterkeit und Bosheit“ dieses neuen Wetters an und – was vielleicht noch wichtiger ist – dass es einen gewissen „moralischen Nebel“ in der Gesellschaft widerspiegelte. Er meinte, dass die Menschen die menschliche Verfassung selbst verstehen könnten, indem sie das Wetter beobachten. In jenem Februar wäre es vielleicht ebenso wie heute leicht gewesen, den sogenannten „Wind der Dunkelheit“ als das Gerede eines Wahnsinnigen abzutun. Wolken sind einfach Wolken: Selbst wenn die von Ruskin beschriebenen Wolken tatsächlich existierten (was damals umstritten war), ist es schwer vorstellbar, dass sie irgendetwas mit der menschlichen Psyche zu tun haben. Wie Brian Dillon 2019 in einem Essay in der Paris Review betonte, kann es schwierig sein, die Grenze zwischen Ruskins „schlechtem Wetter“ und seinem eigenen gebrochenen, traurigen Geisteszustand zu ziehen. Im Jahr 1886 erlitt Ruskin während einer Vorlesung in Oxford einen Nervenzusammenbruch. Gegen Ende seines Lebens, um die Jahrhundertwende, galt er allgemein als verrückt. Seine Bemerkungen zur Meteorologie und zum menschlichen Geist haben nicht die gleiche Aufmerksamkeit erhalten wie seine Schriften über JMW Turner. Constantin Meunier, Das Bergbaugebiet (1852-1905). © Wikipedia Für Ruskin waren diese Wolken jedoch mehr als nur Wolken: Wie er in seinem Tagebuch festhielt, wurden sie von einem „dichten Nebel aus Fabriken“ gespeist. Die „Pestwolke“ symbolisiert das Miasma, das die industrielle Revolution mit sich brachte. Der moralische Nebel wurde durch die raschen sozialen und ökologischen Veränderungen verursacht, die damals stattfanden. Ruskin lebte in einer Ära, in der idyllische Landschaften rücksichtslos in Industriezentren umgewandelt wurden. Die Luft roch nach Schwefel und Schmerz. Die rußhaltige Luft, die Chemikalien und menschlichen Abfälle, der Lärm der Maschinen – das sind nicht nur physische Ablenkungen; Sie sind ein Angriff auf die Sinne und beeinflussen unsere Stimmungen und unser Verhalten auf eine Weise, die noch nicht vollständig verstanden ist. Ruskin war davon überzeugt, dass das unaufhaltsame Tempo der Industrialisierung mit ihren Werkzeugen, riesigen Fabriken und der Umweltzerstörung die geistige Gesundheit der Menschen geschädigt habe: Der Geist brauche, wie der Körper, ein gesundes soziales und physisches Umfeld, um sich entfalten zu können. Dabei handelt es sich tatsächlich um eine relativ neue Idee (Isaac Ray, der Gründer der American Psychiatric Association, definierte den Begriff der „psychischen Hygiene“, einen Vorläufer der psychischen Gesundheit, erst 1893). Für Ruskin führt Instabilität der Umgebung zu Instabilität des Geistes. Die beiden ergänzen sich. --- Mehr als ein Jahrhundert später, während wir mit einer Reihe neuer dramatischer Umweltveränderungen zu kämpfen haben, ist die „Pestwolke“ erneut über uns hereingebrochen. Die globalen durchschnittlichen Oberflächentemperaturen sind seit der vorindustriellen Zeit um etwa 1,1 °C (2 °F) gestiegen, wobei der größte Teil dieser Erwärmung in den letzten 40 Jahren stattfand. Gletscher schmelzen, der Meeresspiegel steigt stetig und Stürme toben. © Behance Doch die häufigsten Geschichten handeln nach wie vor von der Außenwelt: der Welt außerhalb unseres Körpers. Die Geschichte des Klimawandels dreht sich um extreme Wetterlagen, wirtschaftliche Umwälzungen und den Verlust der Artenvielfalt. Aber vielleicht sollten wir den möglicherweise verrückten Ruskin ernst nehmen: Was ist mit den Wolken in uns? Angesichts der Klimakrise, die mit erschreckender Regelmäßigkeit zu extremen Wetterbedingungen führt, die Ozeane versauert und Temperaturrekorde bricht, stellt sich die Frage: Verändern sich auch unsere Herzen und Gedanken? Hier sind einige beunruhigend positive Antworten. An heißen Tagen sind Einwanderungsrichter zurückhaltender, zugunsten von Asylbewerbern zu entscheiden. An wärmeren Tagen sanken die Lernergebnisse der Schüler im Vergleich zu milderen Tagen um ein Viertel, und Schuljahre mit höheren Temperaturen gingen häufig mit schlechteren Lernergebnissen einher. Auch die Temperatur kann Einfluss auf die Häufigkeit von Hassreden im Internet haben. Wenn es wärmer wird, steigt die Zahl der Fälle häuslicher Gewalt. Möglicherweise haben Sie jedoch bereits dieses Gefühl. © Giphy Bei heißem Wetter können Sie reizbarer sein. Sie fühlen sich etwas begriffsstutzig, haben Konzentrationsschwierigkeiten und neigen eher zu impulsivem Handeln. Zahlreiche Studien in der kognitiven Neurowissenschaft und Verhaltensökonomie liefern Belege, die Ihr Verhalten stützen. Bei wärmeren Temperaturen hupen die Autofahrer häufiger (und länger). Heißes Wetter bedeutet auch härtere Strafen bei Sportveranstaltungen. Beim Baseball ist es an heißen Tagen wahrscheinlicher, dass Pitcher die Batter treffen, und die Außentemperatur sagt besser aus, ob sie dazu neigen, mit gleicher Münze zurückzuschlagen, wenn sie beobachten, dass ein gegnerischer Pitcher dasselbe tut. Mit anderen Worten: Die „Pestwolke“ scheint auch in uns zu existieren. Dies verdeutlicht die Verbundenheit unserer inneren und äußeren Welten und offenbart eine gewisse Fragilität der menschlichen Autonomie: Viele unserer Entscheidungen sind anfälliger für Umwelteinflüsse, als wir intuitiv denken. Dies rückt auch die Klimakrise in ein ganz neues Licht: Ja, wenn sich das Klima ändert, ändern auch wir uns. --- Das Londoner Institut, an dem Ruskin seine Vorlesung hielt, wurde 1912 geschlossen. Wenn man heute gegen die negativen Auswirkungen der Umwelt auf die Psyche wettern will, veröffentlicht man einen Artikel im Lancet. Genau das taten 24 britische klinische Neurologen im Mai 2024 und argumentierten, dass „die Häufigkeit, Verbreitung und Schwere vieler neurologischer Erkrankungen“ durch die globale Erwärmung beeinflusst werden könnte. Für diese Forscher unter der Leitung von Sanjay Sisodiya, Professor für Neurologie am University College London, Großbritannien, sind globale Klimaereignisse in Wirklichkeit die Geschichte der Wolken in uns. © Adobe Stock In einer Untersuchung von 332 wissenschaftlichen Studien zeigten Sisodia und seine Kollegen, dass das Klima den Menschen weitaus stärker beeinflusst als erwartet und bis tief in die Spalten der Großhirnrinde reicht. Migräne, Schlaganfälle, epileptische Anfälle und Multiple Sklerose scheinen alle mit der Temperatur in Zusammenhang zu stehen. Außerhalb der Krankenhäuser vergrößert der Klimawandel den Verbreitungsraum von Krankheitsüberträgern wie Zecken, Mücken und Fledermäusen, und Wissenschaftler prognostizieren eine Zunahme von durch Vektoren übertragenen und zoonotischen Gehirnerkrankungen wie Gelbfieber, Zika-Virus und zerebraler Malaria. Es ist klar, dass eine sich verändernde Umgebung die Sinnessysteme und die Wahrnehmung beeinflussen und die Effektivität der sensorischen Informationsverarbeitung verringern kann. Die Erwärmung von Süßwasser kann zu einer Vermehrung von Cyanobakterien führen, die Neurotoxine freisetzen und das Risiko neurodegenerativer Erkrankungen wie der Amyotrophen Lateralsklerose (ALS) erhöhen. © The Japan Times Tatsächlich deuten neuere Studien darauf hin, dass der Klimawandel die bereits jetzt lähmende Belastung durch neurodegenerative Erkrankungen wie Parkinson und Alzheimer möglicherweise noch verschlimmert. In Ländern mit überdurchschnittlich hohen Temperaturen wurde eine stärkere Erwärmung mit einer Zunahme der Parkinson-Fälle in Verbindung gebracht, und wie Sisodia et al. Beachten Sie, dass die Länder, in denen die Demenzraten voraussichtlich am schnellsten steigen werden, auch am stärksten vom Klimawandel betroffen sein werden. Ebenso scheint eine kurzfristige Belastung mit hohen Temperaturen bei Alzheimer-Patienten zu häufigeren Besuchen in der Notaufnahme zu führen. Auch die Luft, die wir atmen, kann eine unterstützende Rolle spielen: In Mexiko-Stadt beispielsweise, wo die Menschen bereits in jungen Jahren hohen Konzentrationen an Feinstaub und Ozon ausgesetzt sind, ergaben Autopsien, dass 99 % der Menschen unter 30 Jahren an Alzheimer erkrankten. Die Risiken sind auch nicht auf lebende Menschen beschränkt. Eine epidemiologische Studie aus dem Jahr 2022 zeigte, dass die Belastung mit hohen Temperaturen in der Frühschwangerschaft das Risiko für Schizophrenie, Anorexie und andere neuropsychiatrische Störungen bei Kindern deutlich erhöht. Es ist seit langem bekannt, dass hohe Temperaturen während der Schwangerschaft die neurologische Entwicklung bei Ratten verzögern können. Andere wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass die Erfahrung von Naturkatastrophen im Mutterleib das Risiko für Angstzustände, Depressionen, Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen und Verhaltensstörungen im späteren Leben deutlich erhöht. Diese Auswirkungen stellen die generationsübergreifenden Verantwortlichkeiten im Anthropozän einer neuen und kritischen Prüfung unter – die Forschung hierzu ist größtenteils noch im Gange, und wir wissen nicht, welche Auswirkungen sich in Zukunft ergeben werden. Was wir jetzt wissen, ist, dass sich das Gehirn in einer Studie nach der anderen als einer der Bereiche erweist, die dem Klimawandel am stärksten ausgesetzt sind. Zurück zur Frage der hupenden Hörner und Baseball-Werfer. Die Konzentration auf das Gehirn könnte einige potenzielle mechanistische Erklärungen für diese Fallstudien liefern und es uns ermöglichen, Ausdrücke wie „Winde der Dunkelheit“ zu vermeiden. Hohe Temperaturen scheinen beispielsweise dazu zu führen, dass funktionelle Gehirnnetzwerke (die das Verhalten zwischen Regionen koordinieren) in Richtung zufälliger Aktivität verlagern. Bei extrem heißem Wetter haben Wissenschaftler eine Überlastung des dorsolateralen präfrontalen Kortex (dlPFC) festgestellt, eines Bereichs, den Robert M. Sapolsky, ein Neuroendokrinologe an der Stanford University in den USA, als „den ultimativen rationalen Entscheidungsträger im Frontalkortex“ bezeichnet. Der dorsolaterale präfrontale Kortex begrenzt das Ausmaß, in dem Menschen impulsive Entscheidungen treffen. und Störungen der Aktivität des dorsolateralen präfrontalen Kortex bedeuten oft eine Zunahme des relativen Einflusses des limbischen Systems (wie etwa der Amygdala, die für die Emotionsregulation verantwortlich ist) auf das Verhalten. Je höher die Temperatur, desto weniger rationale Entscheidungen werden getroffen. Die physikalischen Auswirkungen der Umwelt auf das Gehirn beschränken sich nicht auf den dorsolateralen präfrontalen Kortex. Beispielsweise führt Hitzestress bei Zebrafischen zu einer Herunterregulierung der Expression von Proteinen, die am Aufbau von Synapsen und der Freisetzung von Neurotransmittern beteiligt sind. Bei Mäusen löst Hitze eine Entzündung im Hippocampus aus, einer Gehirnregion, die für die Bildung und Speicherung von Erinnerungen wichtig ist. Während Neuroinflammation oft zunächst eine schützende Rolle spielt, kann eine chronische Aktivierung von Immunzellen wie Mikroglia und Astrozyten schädlich werden, da entzündungsfördernde Moleküle die Gehirnzellen langfristig schädigen können. Beim Menschen geht eine Überhitzung mit einer verminderten Durchblutung des betroffenen Bereichs einher. Die Beobachtungen der Psychologen, dass die kognitive Leistungsfähigkeit bei Hitze abnimmt und die Aggressivität zunimmt, sind im Kontext dieser Erkenntnisse durchaus verständlich. Das aufstrebende Gebiet der Umweltneurowissenschaften versucht, „die qualitativen und quantitativen Beziehungen zwischen der äußeren Umwelt, der Neurobiologie, der Psychologie und dem Verhalten zu verstehen“. Um einen spezifischeren Neologismus zu finden – da dieser spezielle Ausdruck auch Umwelteinflüsse wie Lärm, Stadtentwicklung, Beleuchtung und Kriminalität umfasst – könnten wir dieses neu entstehende umfassende Feld „Klima-Neuroepidemiologie“ nennen. Oder, ich weiß nicht, vielleicht brauchen wir einen Namen, der besser zu TikTok passt. Neuroklimatologie? Ökologische Neurodynamik? © PBS Ich nenne es lieber: das Gewicht der Natur. Diese Belastung zwingt uns zum Handeln, ebenso wie die oben genannten Verhaltenseinflüsse. Wenn extreme Hitze Sie bis ins Mark trifft und Sie eher zur Gewalt neigt, schränkt sie tatsächlich Ihre Möglichkeiten ein. Impulsive Entscheidungen bedeuten von Natur aus weniger Überlegung als bewusste Entscheidungen. Wenn der Klimawandel unsere Reaktionen und Entscheidungen beeinflusst, sollten wir ihn als Untergrabung unseres freien Willens verstehen. Die Last der Natur ist schwer. Es hat uns ein wenig überwältigt. Dies stellt auch eine schwere psychische Belastung dar. Möglicherweise kennen Sie den Begriff „Klimaangst“. Mit diesem Ausdruck wird normalerweise eine fast schon krankhafte Sorge und Angst vor einer drohenden Umweltzerstörung bezeichnet, aber er kam mir nie besonders treffend vor. Angst wird oft als „übermäßiges“ Sorgen beschrieben, wie es im Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) definiert wird. Ich glaube nicht, dass es „übertrieben“ ist, die deutlichen Zeichen des Klimawandels zu sehen und gleichzeitig ein Gefühl des bevorstehenden Untergangs zu verspüren. © Corporate Knights Vielleicht sollten wir annehmen, dass Menschen mit Klimaangst über ein besser entwickeltes Gehirn verfügen als andere – Kassandra (eine trojanische Prinzessin und Priesterin des Apollon in der griechischen und römischen Mythologie. Sie hatte die Fähigkeit zur Vorhersage, weil die heilige Schlange ihre Ohren mit ihrer Zunge wusch oder weil Apollon ihr die Fähigkeit zur Vorhersage verlieh, aber weil sie sich Apollon widersetzte, glaubte man ihren Vorhersagen nicht. Anmerkung des Herausgebers) ist möglicherweise die einzige nüchterne Person, die noch übrig ist. --- Ich mache keine Witze. Die Neurowissenschaft hat begonnen, das betreffende Gehirn zu untersuchen, und das nicht umsonst. So stellten Forscher der Northern Michigan University (NMU) in einer Studie aus dem Jahr 2024 fest, dass Menschen, die ein höheres Maß an Angst vor dem Klimawandel angaben, andere Muster in der Gehirnstruktur und -funktion aufwiesen als Menschen mit geringerer Angst vor dem Klimawandel. Dies betraf insbesondere den mittleren cingulären Kortex, einen zentralen Knotenpunkt im Gehirn, der für die Erkennung von Bedrohungen zuständig ist. Insbesondere schienen die Gehirne von Menschen mit Klimaangst einen kleineren mittleren cingulären Kortex (im Hinblick auf die graue Substanz) zu haben, der jedoch funktionell stärker mit anderen wichtigen Knotenpunkten im Salienznetzwerk des Gehirns verbunden war, einem System, das die Umgebung vermutlich ständig nach emotionsrelevanten Informationen absucht. Im Salienznetzwerk arbeitet der mittlere cinguläre Cortex eng mit limbischen Systemen wie der Amygdala und der Inselrinde zusammen, um angemessene Reaktionen auf diese Informationen vorzubereiten. Bei Menschen mit Klimaangst reagiert dieses Netzwerk möglicherweise besonders empfindlich auf klimabedingte Bedrohungssignale. Daher könnte ein kleinerer mittlerer cingulärer Kortex kein Zeichen eines Defizits sein, sondern vielmehr ein effizienteres und ausgefeilteres System zur Bedrohungserkennung darstellen. Es ist bekannt, dass das Gehirn im Laufe der Zeit redundante Verbindungen abbaut und nur die nützlichsten Nervenbahnen behält. Die Forscher aus Michigan vermuten, dass selektives Beschneiden es klimaängstlichen Gehirnen ermöglichen könnte, beunruhigende Informationen effizienter zu verarbeiten, indem es eine schnelle Kommunikation zwischen dem mittleren cingulären Kortex und anderen Bereichen ermöglicht, die an der Bedrohungsvorwegnahme und -reaktion beteiligt sind. Mit anderen Worten, schreiben sie, könnte der Midcinguläre Cortex der klimaängstlichen Personen eine „effizientere neuronale Konnektivität“ aufweisen. Diese neurologische Sensibilität gegenüber potenziellen Gefahren hat sowohl Vor- als auch Nachteile. Einerseits könnte es einigen Menschen die tatsächlichen Gefahren bewusst machen, die vor uns liegen. Der mittlere cinguläre Cortex ist für die Vorhersage zukünftiger Bedrohungen von entscheidender Bedeutung. Eine Metaanalyse ergab, dass dieser Bereich ständig aktiviert wird, wenn Menschen an unvorhersehbare negative Ergebnisse denken. Angesichts der drohenden Klimakatastrophe könnten Systeme zur Erkennung von Bedrohungen mit hoher Auslösegeschwindigkeit eine anpassungsfähige Hilfe sein. Andererseits glauben die Forscher: Die Komplexität, die Ungewissheit und die zeitliche und geografische Distanz der Klimakrise, verbunden mit ihrem globalen Charakter, können dazu führen, dass Einzelpersonen die mit dem Klimawandel verbundenen Risiken unterschätzen oder sich überfordert und von der Realität losgelöst fühlen – ein Zustand, der manchmal als „ökologische Lähmung“ bezeichnet wird. Eine Überaktivität im mittleren cingulären Kortex wurde mit klinischen Angststörungen in Verbindung gebracht und die neuen Erkenntnisse legen nahe, dass Klimaangst mit einigen der gleichen neuronalen Grundlagen zusammenhängt (wobei man bedenken sollte, dass sich Klimaangst von generalisierter Angst zu unterscheiden scheint, da die in der Michigan-Studie beobachteten Unterschiede im Gehirn nicht durch das allgemeine Angstniveau erklärt werden konnten). Obwohl diese Ergebnisse lediglich spekulativ sind, legen sie nahe, dass die Klimaangst nicht einfach ein soziokulturelles Phänomen ist, sondern dass es theoretisch identifizierbare neuronale Korrelate gibt. Sie bieten einen potenziellen biologischen Rahmen zum Verständnis der Frage, warum manche Menschen anfälliger für die psychologischen Auswirkungen des Klimawandels sind als andere. Sie werfen außerdem eine spannende Frage auf: Sind die Gehirne von Menschen, die sich vor dem Klimawandel fürchten, besonders gut dafür geeignet, mit der existenziellen Bedrohung durch die globale Erwärmung umzugehen, oder sind sie davon leicht überfordert? Aber auf jeden Fall zeigt dies alles, dass die Außenwelt immer tiefer in unsere Herzen eindringt. --- Vielleicht gibt es noch eine andere Seite, die erkannt werden muss. Der Klimawandel wirkt sich auf unsere Neurobiologie aus. Was bedeutet es, unsere Neurobiologie an den Klimawandel anzupassen? Dies ist die Prämisse eines 2023 in Nature Climate Change veröffentlichten Artikels der Neurowissenschaftlerin Kimberly Doell von der Universität Wien in Österreich und ihrer Kollegen. Sie sind davon überzeugt, dass dieses Gebiet ein wichtiges Potenzial hat, uns dabei zu helfen, die Reaktionen auf den Klimawandel zu verstehen und Entscheidungen zum Umweltschutz zu erleichtern. Seit Ruskin die Umwelt wütend in Frage stellte, hat die Umweltneurowissenschaft begonnen, die Wechselbeziehungen zwischen Organismen und ihren ökologischen Nischen zu erforschen. Wir wissen heute, dass die Beschaffenheit unserer modernen Umwelt – Grünflächen, Zersiedelung, sozioökonomische Hierarchien – Spuren im Gehirn hinterlässt. Der Klimawandel ist keine Ausnahme. Doerr und andere sind daher der Ansicht, dass Wissenschaftler und Aktivisten Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft einbeziehen können, um Kommunikationsstrategien zur Förderung von Klimaschutzmaßnahmen zu verbessern. Sie hoffen, Erkenntnisse aus der Neurobiologie und der kognitiven Neurowissenschaft nutzen zu können, um wirksamere Klimalösungen zu entwickeln – sowohl für uns selbst als auch für die Gesellschaft als Ganzes. Für diese Art von Ansatz gibt es bereits Modelle. So besteht in der Armutsforschung beispielsweise schon seit langem ein Zusammenhang zwischen sozioökonomischen Bedingungen und schlechter Gesundheit. In den letzten Jahren hat die Neurowissenschaft untersucht, wie die verschiedenen Faktoren der Armut – etwa die Belastung mit Giftstoffen und chronischer Stress – neuronale Strukturen schädigen und die kognitive Entwicklung beeinträchtigen. Zwar kann die Hirnforschung allein die Armut nicht beseitigen, doch selbst ein begrenztes Verständnis dieser Mechanismen hat zur Erforschung von Programmen wie Head Start geführt, einem häuslichen Vorschullehrplan, der nachweislich die selektive Aufmerksamkeit und die Ergebnisse kognitiver Tests verbessert. Zwar lässt sich strukturelle Ungleichheit nicht so leicht beseitigen, doch ist es Neurowissenschaftlern gelungen, die neuronalen Korrelate der Armut aufzudecken, ihre reversiblen Schäden zu benennen und entsprechend präzise Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Doll und ihre Kollegen glauben, dass das gleiche Potenzial für die Neurowissenschaft des Klimawandels besteht. © EdSurge Um dieses Potenzial auszuschöpfen, müssen wir jedoch besser verstehen, wie der Fiebertraum des Anthropozäns unsere Wetware bereits verändert. Die Sozial- und Verhaltenswissenschaften haben begonnen, die psychologischen Folgen planetarischer Veränderungen zu dokumentieren, die neurologische Taxonomie des Klimawandels ist jedoch noch wenig erforscht. Das methodische und konzeptionelle Repertoire des Fachgebiets ist für die Herausforderung bereit, doch um es zu verfeinern, sind Allianzen mit so unterschiedlichen Bereichen wie der Klimawissenschaft, Medizin, Psychologie und Politikwissenschaft erforderlich. Die zentrale Frage lautet: Ist das Nervensystem in einer Biosphäre, in der Veränderung die einzige Konstante ist, flexibel genug, um Schritt zu halten, oder wird es Schwierigkeiten haben, sich anzupassen? Die erste Welle von Forschern, die sich Kaveris Herausforderung stellen, untersucht eine Reihe unterschiedlicher Organismen, von denen jeder in seiner einzigartigen Position ist, die Fähigkeit des Gehirns aufzudecken, sich angesichts der Störungen auf der Erde zu erholen. Wolfgang Stein von der University of Illinois in Urbana-Champaign und Steffen Harzsch von der Universität Greifswald in Deutschland haben sich beispielsweise auf Krebstiere konzentriert und versucht zu verstehen, wie ihre neuronalen Thermoregulatoren auf steigende Temperaturen in flachem und tiefem Wasser reagieren. Ein anderes Forschungsteam untersuchte die Gehirne von Kopffüßern, also Tieren, deren Fähigkeit zur RNA-Editierung möglicherweise entscheidend dafür ist, dass sie drastisch sinkende Sauerstoffwerte in zunehmend stickigen Wasserlebensräumen tolerieren können. Ein drittes Kaveri-Team unter der Leitung von Florence Kermen von der Universität Kopenhagen in Dänemark setzt Zebrafische extremen Temperaturen aus und sucht nach molekularen Signaturen in ihren Neuronen und Gliazellen, die ihnen ein Gedeihen ermöglichen – selbst wenn sich ihre Wasserwelt erwärmt. --- Das Gehirn, diese schwammartige Kommandozentrale auf dem Rückenmark, war schon immer eine Blackbox. Angesichts der sich verschärfenden Klimakrise und der zunehmenden Instabilität der ökologischen Grundlagen unter unseren Füßen wird es immer dringender, einen Blick in das Gehirn zu werfen. Wir können bereits die ersten Umrisse der neuen neuronalen Kartografie erkennen, die Sisodia und seine Kollegen entwerfen. Wir wissen heute, dass das Gehirn weniger eine statische, sich selbst regulierende Organisation ist als vielmehr eine dynamische, lebendige Landschaft, deren Hügel und Täler von den Konturen unserer Umwelt geprägt werden. So wie die grönländische Eisdecke unter der Hitze des Klimawandels ächzt und sich biegt, so werden auch unsere Synapsen schrumpfen und unsere Neuronen absterben, wenn das Quecksilber steigt. So wie der steigende Meeresspiegel Küstenlinien überschwemmt und Wälder Dürren und Bränden zum Opfer fallen, so werden auch die anatomischen Grenzen unseres Gehirns mit jedem neuen Ansturm von Umwelteinflüssen neu gezogen. Doch der Dialog zwischen Gehirn und Biosphäre ist keine Einbahnstraße. Die Entscheidungen, die wir treffen, die Verhaltensweisen, die wir an den Tag legen, die Art und Weise, wie wir auf Krisen reagieren – all diese Entscheidungen wirken sich auf die Umwelt aus, im Guten wie im Schlechten. Ich schlage daher Folgendes vor: Wenn wir verstehen wollen, wie der Klimawandel die Konturen unseres Denkens prägt, müssen wir auch darüber nachdenken, wie wir unsere intellektuelle Architektur im Dienste einer nachhaltigen Entwicklung aktualisieren können. Kartografen des anthropozänen Geistes stehen vor einer gewaltigen Aufgabe. Doch in den Händen der Neurowissenschaft – bewaffnet mit Gehirnscans, summenden Elektroden, der Präzision der Genom-Editierung und der Leistungsfähigkeit von Algorithmen – könnte es möglich sein, einem Ausgangspunkt nahe zu kommen. Indem wir die Wege der Umwelteinflüsse bis zu ihren neuronalen Wurzeln zurückverfolgen, können wir möglicherweise beginnen, das komplexe Netz zu entwirren, das den Geist mit dem Schicksal des Planeten verbindet. © Wikipedia Eines ist klar: Während sich die Räder der Klimakrise weiter drehen, werden auch unsere Gehirne davon betroffen sein. Die Frage ist: Sind wir passive Passagiere oder werden wir die Kontrolle übernehmen und unseren Weg in eine lebenswerte Zukunft finden? Die Last der Natur – das Ausmaß der Krise, vor der wir stehen – ist erschreckend. Aber es wird uns nicht lähmen. Von Punkt zu Punkt, von Synapse zu Synapse können wir einen Kurs durch die sich zusammenbrauende Seuchenwolke festlegen. In einem seiner klareren Momente sagte Ruskin einmal: „Unvollkommenheit zu beseitigen bedeutet, den Ausdruck zu zerstören, Anstrengung zu unterdrücken und Energie zu lähmen.“ Selbst wenn uns dies irgendwie gelingen würde, dürften wir die sogenannten Unvollkommenheiten im Einfluss der Umwelt auf den Geist nicht beseitigen. Stattdessen sollten wir darin eine enge und wichtige Beziehung zwischen dem Selbst und der Welt erkennen. Von Clayton Page Aldern Übersetzt von tamiya2 Korrekturlesen/Rabbits leichte Schritte Originalartikel/aeon.co/essays/how-a-warming-earth-is-changing-our-brains-bodies-and-minds Dieser Artikel basiert auf der Creative Commons License (BY-NC) und wird von tamiya2 auf Leviathan veröffentlicht Der Artikel spiegelt nur die Ansichten des Autors wider und stellt nicht unbedingt die Position von Leviathan dar |
<<: Färbe den See rosa! Es ist eigentlich für die Wissenschaft…丨Environmental Trumpet
Artikel empfehlen
Wie kann man die Explosivkraft steigern?
Wenn Du Deine Explosivkraft steigern möchtest, is...
Alarm! Blut im Stuhl muss nicht unbedingt auf Hämorrhoiden hindeuten, es kann auch ein Anzeichen für Krebs sein! Diese Kontrollen müssen durchgeführt werden!
Wie das Sprichwort sagt: „Neun von zehn Menschen ...
Wie bauen Männer Muskeln auf?
Alle männlichen Freunde wollen eine bessere Figur...
Die optimale Intensität und Methode des Aerobic-Trainings
Täglich etwas Aerobic-Übungen zu machen, kann uns...
Was sind die effektivsten Aerobic-Übungen?
Viele von uns treiben vielleicht Sport. Wenn wir ...
Wie können Sie Ihren Bizeps trainieren?
Heutzutage sind sich die Menschen zunehmend der B...
Warum heißt es, dass China bei Fahrzeugen mit neuer Energie definitiv führend sein wird?
Die Welt tritt in das Zeitalter der Elektrifizier...
Warum fühlen sich andere voller Energie, während ich immer noch so müde bin, obwohl wir beide 8 Stunden schlafen?
„Wie lange sollten Menschen am Tag am besten schl...
Gehen Wissenschaftler zu Forschungszwecken in von Fliegen befallene Restaurants, um dort Probiotika zu ergänzen?
Wenn Sie sich im Spiegel betrachten, fühlen Sie s...
Warum heben Menschen gerne ihre Füße?
Wie sehen die Typen aus, die in deiner Nähe herum...
Chinesischer Toon ist köstlich, aber wir haben Angst vor einer Nitritvergiftung! Bringen Sie Ihnen einen Weg bei, es zu lösen
Der Frühling ist wieder da und chinesische Toons ...
Die Taihang-Berge sind so schön!
Tai bedeutet groß Walker, Form Taihang-Gebirge Es...
Die Kraftfahrzeug- und Schiffssteuer wird halbiert oder ganz erlassen, was der Branche der Fahrzeuge mit neuer Energie gute Nachrichten bringen wird
Vor kurzem haben das Finanzministerium, die staat...
Welche Sportveranstaltungen gibt es?
Das Sporttreffen ist eine Sportveranstaltung, die...