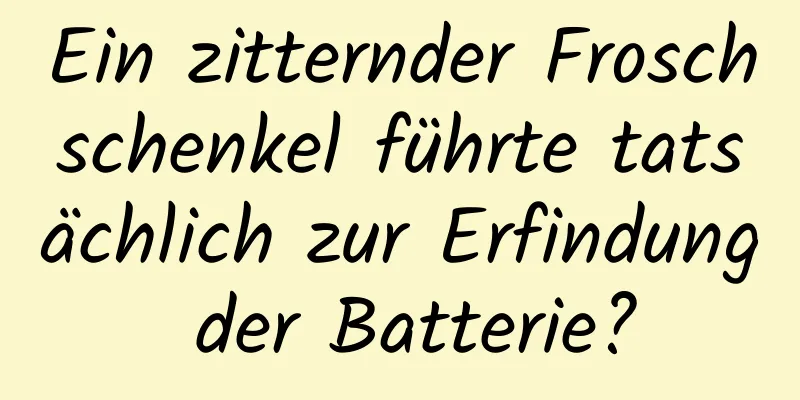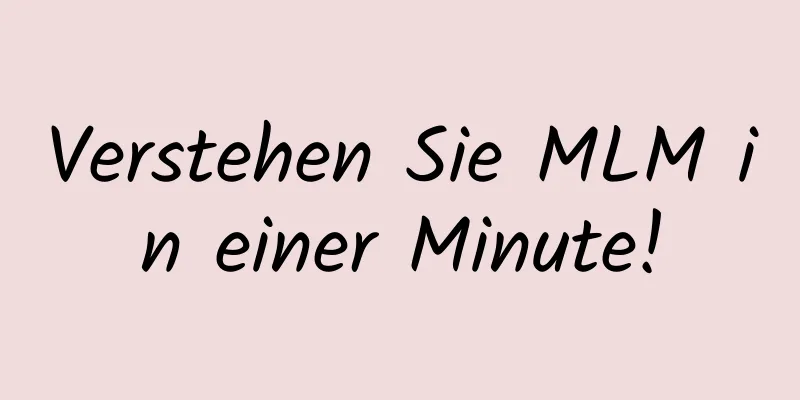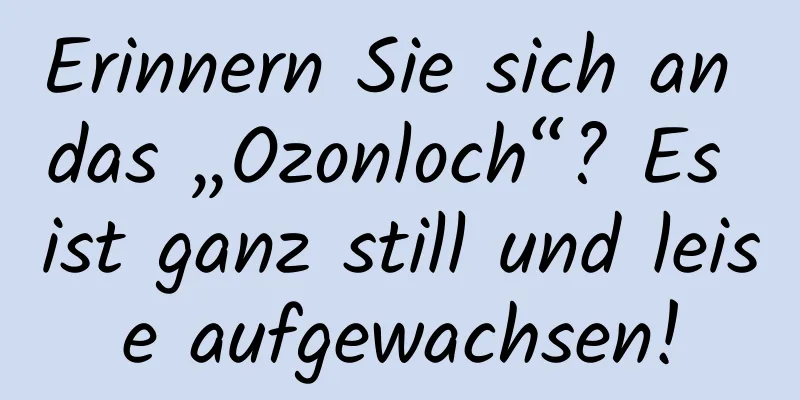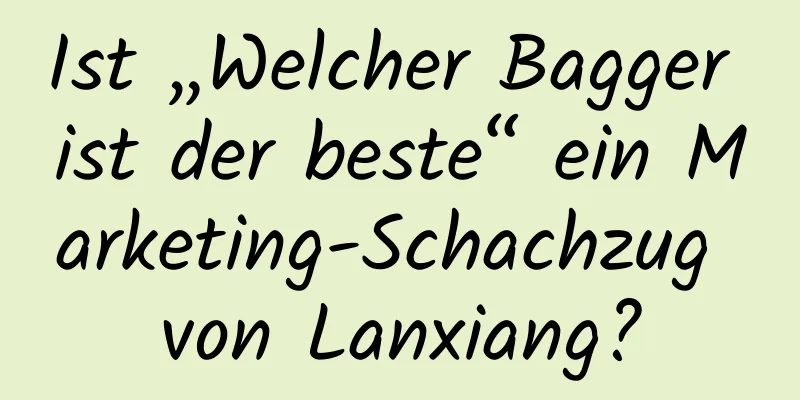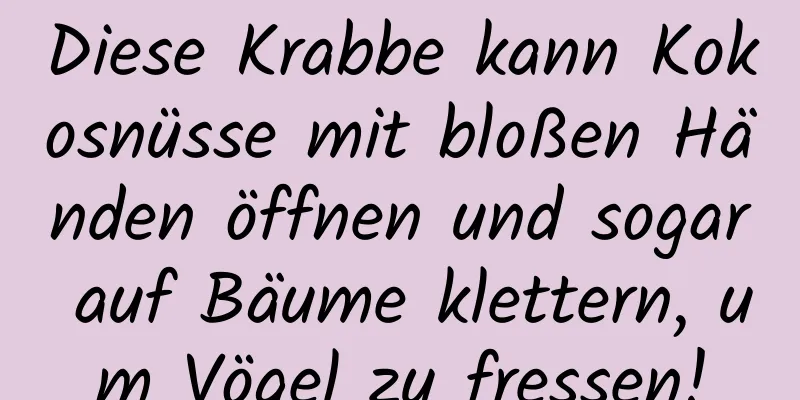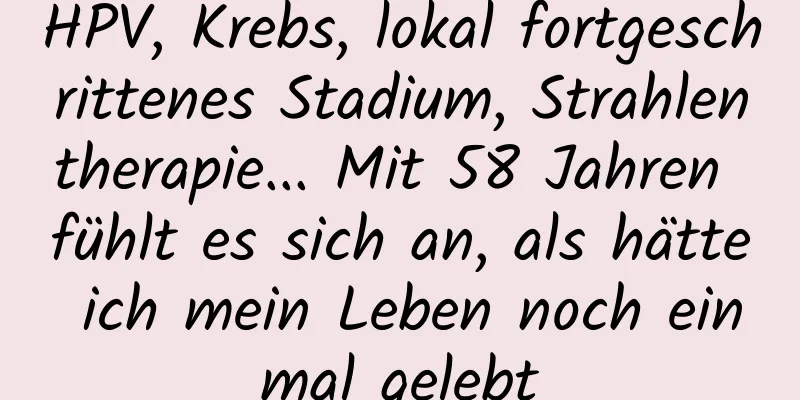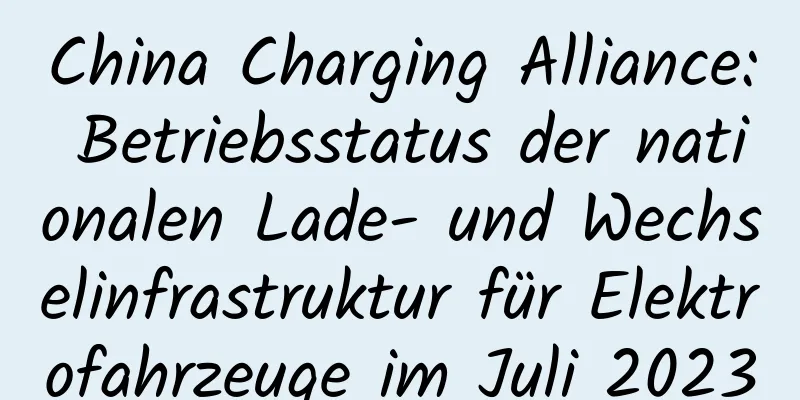Funkel, funkel, kleiner Stern, der Himmel ist voller "kleiner" Sterne
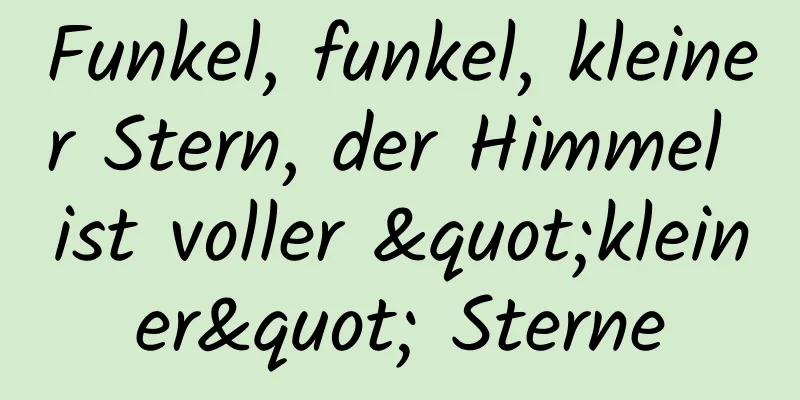
|
„Funkel, funkel, kleiner Stern, der Himmel ist voller kleiner Sterne.“ Am Nachthimmel können wir mit bloßem Auge etwa 6.000 Sterne erkennen, bei den meisten davon handelt es sich um Sterne, die wie die Sonne ihr eigenes Licht ausstrahlen können. (Planeten strahlen kein Licht aus und manche Planeten können von uns nur gesehen werden, wenn sie das Licht der Sterne reflektieren.) Lassen Sie uns heute über die Geschichte des Himmels voller Sterne sprechen. Die strahlende Milchstraße (Foto aufgenommen vom Astronomie-Enthusiasten Huang Dandan) [Die aus Sternen bestehenden "Sternbilder" werden nicht zur Wahrsagerei verwendet] Welche Sterne außer der Sonne können Sie noch nennen? Sirius? Beteigeuze? Formalhaut? Professionellere Sterngucker werden Ihnen auch sagen: Sirius steht im Großen Hund, Beteigeuz ist eines der sieben Sternbilder des Weißen Tigers, Fomalhaut liegt im Südlichen Fisch ... Welche Beziehung besteht zwischen Sternen und Sternbildern? (Im Vergleich zu „Horoskop“ und „Horoskop-Matching“, die nur Gesprächsthemen nach dem Abendessen sind, ist „Horoskop“ wirklich ein ernstes Konzept!) Um die „Sitze“ der Sterne am Himmel anzuordnen, verbanden die Menschen die hellen Sterne durch imaginäre Linien und bildeten so verschiedene Formen. So wurde der Sternenhimmel künstlich in mehrere Bereiche unterteilt. Diese Formen werden zusammen mit den Himmelsregionen, in denen sie sich befinden, in China als „Sternensymbole“ und im Westen als „Sternbilder“ bezeichnet. Im alten China war der Sternenhimmel in drei Bereiche (Purpurnes Emblem, Großes Emblem und Himmlisches Emblem), vier Symbole (Östlicher Azurdrache, Westlicher Weißer Tiger, Südlicher Zinnobervogel und Nördliche Schwarze Schildkröte) und achtundzwanzig Häuser unterteilt, was insgesamt 283 Sternbilder ergab. Im Jahr 1928 identifizierte die Internationale Astronomische Union (IAU) auf Grundlage der westlichen Sternbilder 88 Sternbilder, von denen sich 13 auf der Ekliptik befinden. Die Ekliptik bezeichnet die Bahn, die die Sonne von der Erde aus gesehen einmal jährlich auf ihrer Umlaufbahn am Himmel zurücklegt. Dies ist die Auswirkung der Erdumdrehung um die Sonne[1]. Neben den gleichnamigen Sternbildern des bekannten „Tierkreises“ gibt es ein weiteres Sternbild, das die Sonne auf der Ekliptik durchläuft: den Schlangenträger, der von der Erde aus gesehen nördlich von Skorpion und Schütze liegt. Ursprünglich nutzten die Menschen Sternbilder zur Zeitbestimmung. Die alten Babylonier teilten die Ekliptik in 12 gleichmäßige Segmente (entsprechend 12 Sternbildern) und die Sonne blieb einen Monat in jedem Segment. Die alten Ägypter sagten die Überschwemmung des Nils anhand des Erscheinens des Sirius am östlichen Horizont voraus. Im alten China zeichnete „Heguanzi“ die Eins-zu-eins-Entsprechung zwischen der Richtung Osten, Süden, Westen und Norden zeigenden Deichsel des Großen Wagens und Frühling, Sommer, Herbst und Winter auf, die damals die landwirtschaftliche Produktion effektiv steuerte. Später entdeckte man die Navigationsfunktion der Sternbilder. „Nachts auf den Großen Wagen schauen, um Nord und Süd zu erkennen“ bedeutet, dass man durch den Großen Wagen den Polarstern finden und so die Richtung bestimmen kann (siehe Abbildung 2). Vom 15. bis zum 17. Jahrhundert entwickelten die über den gesamten Globus verteilten europäischen Flotten die maritime Industrie und gleichzeitig den aufkeimenden Kapitalismus. Es gab zwar keine Bezugspunkte im weiten Ozean, aber die Sternbilder am Himmel hatten nicht nur eine einzigartige Form, sondern waren auch leicht zu beobachten, was sie für die Navigation der damaligen Flotte sehr geeignet machte. [Wenig Wissen] Die Art und Weise, wie die alten Babylonier den Tierkreis einteilten, ist der Ursprung der heute gängigen Sternbild-Datumstabelle. Allerdings variieren die Größen der Sternbilder nach den aktuellen Standards zur Sternbildunterteilung erheblich und die Verweildauer der Sonne in den einzelnen Sternbildern ist uneinheitlich. Im kleinsten Sternzeichen Skorpion bleibt sie nur 7 Tage, im größten Sternzeichen Jungfrau sogar 44 Tage und 8 Stunden. Daher sind die „Sternbilder“, die jeder kennt, nicht dieselben wie die Sternbilder in der Astronomie. Abbildung 2 Der Große Wagen und der Nordstern (schematische Darstellung) Im westlichen Sternbild befinden sich der Polarstern und der Große Wagen jeweils im Kleinen und Großen Bären. Da die Rotationsachse der Erde grundsätzlich auf den Nordstern zeigt, drehen sich die Himmelskörper optisch einmal am Tag um den Nordstern. Der Stern, auf den die Linie zeigt, die die beiden Sterne an der Öffnung des Schöpflöffels verbindet, ist immer der Nordstern, wenn man ihn fünfmal auszieht. Wenn sich der Große Wagen unterhalb des Horizonts befindet, können Sie den Polarstern anhand der fünf W-förmigen Sterne in der Kassiopeia finden. Zheng He führte seine Flotte sieben Mal in den Westlichen Ozean und bewältigte dabei mithilfe der „Sternenziehtechnik“ äußerst schwierige und komplizierte Reisen. Damit vollbrachte er ein Wunder in der Geschichte der Weltschifffahrt. Die in der „Sternenkarte für die Ozeanüberquerung“ beschriebenen Techniken, wie etwa „nur den Auf- und Untergang von Sonne und Mond zu beobachten, um Ost und West zu unterscheiden, und die Höhe der Sterne, um die Entfernung zu messen“, nutzen Sonne, Mond und Sterne, um die geografische Position und die Fahrtrichtung des Schiffes zu bestimmen. Zu den zugrunde liegenden Prinzipien gehören „die Erde dreht sich von Westen nach Osten, wodurch Sonne und Mond im Osten auf- und im Westen untergehen“ und „die Höhe des Polarsterns entspricht der lokalen Breite“ sowie andere Geheimnisse des Sternenhimmels. [Vor 100.000 Jahren sah der Große Wagen nicht so aus] Aufgrund des visuellen Projektionseffekts scheinen die Sterne, aus denen die lebhaften Muster in den Sternbildern bestehen, auf derselben Ebene zu liegen, tatsächlich kann ihre Entfernung zu uns jedoch stark variieren. Daher kann es sein, dass zwischen Sternen in derselben Konstellation nur eine geringe physikalische Wechselwirkung besteht. Nehmen wir weiterhin den Großen Wagen als Beispiel: Von den sieben Sternen sind Yaoguang und Tianshu 101 bzw. 124 Lichtjahre von der Erde entfernt (wie in Abbildung 3 gezeigt) und damit 20 bis 40 Lichtjahre weiter entfernt als die anderen fünf Sterne. Das von ihnen ausgesandte Licht benötigt mehr als hundert Jahre, um zur Erde zu gelangen. Abbildung 3 Die Entfernung zwischen dem Großen Wagen und der Erde [3] (schematische Darstellung) Der dem Sonnensystem am nächsten gelegene Stern ist Proxima Centauri, ein Mitglied des Dreifachsystems Alpha Centauri , etwa 4,2 Lichtjahre von der Erde entfernt. Das Dreifaltigkeitssystem Alpha Centauri ist das „Sonnensystem“, von dem das Überleben der von Liu Cixin beschriebenen Trisolaraner abhängt. Zudem ist es das endgültige Migrationsziel der Menschen auf der Erde im Science-Fiction-Film „Die wandernde Erde“. Sterne sind am Himmel nicht stationär; Sie bewegen sich mit sehr hoher Geschwindigkeit. Beispielsweise umkreist die Sonne das Zentrum der Milchstraße mit einer Geschwindigkeit von 238 Kilometern pro Sekunde[4] und vollendet eine Umlaufbahn um das Zentrum der Milchstraße in etwa 250 Millionen Jahren. Wenn wir die Geschwindigkeit der Erdrotation und -umdrehung berücksichtigen, ist es nicht schwer zu verstehen, dass man „80.000 Meilen am Tag zurücklegt, während man auf dem Boden sitzt“. Wenn sich Sterne so schnell bewegen, warum erscheinen sie uns dann stationär? Der Hauptgrund ist, dass die meisten Sterne zu weit von uns entfernt sind. Sie benötigen für ihre Umlaufbahn im Universum Hunderte von Jahren und es ist für uns schwierig, Veränderungen ihrer Positionen festzustellen. Nach einer langen Akkumulationsphase werden ihre Positionsänderungen jedoch deutlicher. Beispielsweise hatte der Große Wagen vor 100.000 Jahren und 100.000 Jahren später nicht die Form einer „Weinschale“ (wie in Abbildung 4 gezeigt). Abbildung 4 Schematische Darstellung der Form des Großen Wagens zu verschiedenen Zeiten (Bild von der Website [5], vom Autor modifiziert) [In der Welt der Sterne ist die Sonne nur ein kleiner Bruder] Die Sonne, die wir auf der Erde sehen, ist der größte und hellste Himmelskörper am Himmel. Tatsächlich ist es nur ein kleiner Bruder in der Welt der Sterne. Es gibt viele Sterne, die größer und heller sind als die Sonne. Allein in der Milchstraße gibt es Hunderte Milliarden Sterne, doch sie sind so weit entfernt und ihr Licht ist so schwach, dass die Menschen sehr wenig über die Natur dieser unerreichbaren Sterne wissen. Seit der Entstehung der Astrophysik, insbesondere seit dem 19. Jahrhundert, ist das Verständnis der Menschen für die Struktur, die chemische Zusammensetzung und den physikalischen Zustand von Himmelskörpern aufgrund der weitverbreiteten Anwendung von Techniken wie Spektroskopie, Photometrie und Fotografie bei der Beobachtung und Untersuchung von Himmelskörpern allmählich klarer geworden. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entdeckten der dänische Astronom Hertzsprung und der amerikanische Astronom Russell , dass Sterne im zweidimensionalen Bild der Leuchtkraft (d. h. Leuchtfähigkeit) und Temperatur ein sehr signifikantes Verteilungsmuster aufweisen . Dieses Bild wird Hertzsprung-Russell-Diagramm oder kurz HR-Diagramm genannt. Das Hertzsprung-Russell-Diagramm kann den „Status“ eines Sterns deutlich widerspiegeln, beispielsweise seine Größe und Masse, seine Leuchtkraft und sein Alter (d. h. seine Evolutionsgeschichte) sowie andere wichtige Eigenschaften. Es handelt sich um einen der bedeutendsten Atlanten der Astronomie. Abbildung 5: Hertzsprung-Russell-Diagramm, wobei die horizontale Achse die Oberflächentemperatur oder -farbe und die vertikale Achse die Leuchtkraft darstellt (Bild von der Website [6], vom Autor bearbeitet) Wie in Abbildung 5 dargestellt, können Sterne grob in die folgenden Typen unterteilt werden: Hauptreihensterne: Die meisten (mehr als 90 %) Sterne sind in einem schmalen Gürtel (Hauptreihe) von links oben nach rechts unten verteilt. Die Sterne in diesem Gürtel werden Hauptreihensterne genannt und befinden sich im Stadium der Wasserstoff-Helium-Kernfusion. Je höher die Temperatur eines Sterns, desto blauer ist seine Farbe und desto stärker ist seine Leuchtkraft. Umgekehrt gilt: Je röter die Farbe, desto schwächer ist die Leuchtkraft. Sterne sind am stabilsten und bleiben am längsten in diesem Stadium (sie verbringen mehr als 90 % ihres Lebens in diesem Stadium). Weißer Zwerg: Die Sterne im dichteren Bereich unten links sind heiß, bläulich-weiß, haben eine sehr schwache Leuchtkraft und sind klein, daher werden sie als Weiße Zwerge bezeichnet. Dieser Bereich ist das „Ziel“ massearmer Sterne nach ihrem Tod. Riesen und Überriesen: Die Sterne im dichteren Bereich auf der rechten Seite der Hauptreihe haben eine relativ hohe Leuchtkraft, aber niedrigere Temperaturen. Nachdem die Wasserstoffelemente im Zentralbereich des Sterns ausgebrannt sind und die Kernfusion schwererer Elemente gezündet wird, beginnt der Stern „fett“ zu werden und dringt in diesen Bereich ein, weshalb er als Riese bezeichnet wird. Der Stern oben links wird als Überriese bezeichnet. Basierend auf der Farbe der Sterne unterteilt das Harvard-Observatorium Sterne in sieben Typen: O, B, A, F, G, K und M. Jeder Typ kann in 10 Untertypen unterteilt werden, was der Harvard-Klassifikation entspricht. Da die Farbe eines Sterns mit der effektiven Temperatur seiner Oberfläche zusammenhängt, erfolgt die Klassifizierung in der Reihenfolge abnehmender effektiver Temperatur, wie in Abbildung 5 (horizontale Achse) dargestellt. Beispielsweise ist die Sonne ein Stern vom Typ G und hat eine gelbe Farbe, während Wega und Sirius Sterne vom Typ A sind und eine bläulich-weiße Farbe haben. Nach ihrer Leuchtkraft können Sterne in sieben Typen unterteilt werden: Überriese (Typ I), Heller Riese (Typ II), Riese (Typ III), Unterriese (Typ IV), Zwerg (Typ V), Unterzwerg (Typ VI) und Weißer Zwerg (VII). Dabei beziehen sich Riesensterne und Zwergsterne auf ihre Leuchtkraft. Diejenigen mit höherer Leuchtkraft sind Riesensterne, während diejenigen mit geringerer Leuchtkraft Zwergsterne sind. Bei der Harvard-Klassifikation handelt es sich um eine univariate Klassifikation auf Grundlage von Farbe oder Temperatur, die sich nicht gut zur Bestimmung der Position von Sternen in einem zweidimensionalen Hertzsprung-Russell-Diagramm eignet. Zu diesem Zweck schlugen die amerikanischen Astronomen Morgan (W. Morgan) und Keenan (P. Keenan) in den 1940er Jahren ein auf Temperatur und Leuchtkraft basierendes Binärklassifizierungssystem (das MK-Klassifizierungssystem) vor, mit dem die Position von Sternen im Hertzsprung-Russell-Diagramm genau bestimmt werden kann. Die Sonne ist beispielsweise vom Typ G2V. Die Sonne ist ein typischer Zwergstern. Es gibt Sterne im Universum, die Hunderte Millionen Mal größer als die Sonne oder sogar noch größer sind. Beispielsweise ist UY Scuti ein roter Überriese in der „Dämmerungsphase“ eines Sterns. Neueste Forschungen zeigen [7], dass der Radius dieses Sterns das 755-fache des Sonnenradius beträgt (siehe Abbildung 6), was 430 Millionen Sonnen entspricht, und dass seine Leuchtkraft das 87.000-fache der Sonne beträgt. Da er 5.100 Lichtjahre von uns entfernt ist, ist er von der Erde aus betrachtet trotz seiner enormen Größe nur ein kleiner heller Fleck. Abbildung 6 Vergleich der Sterngrößen (schematische Darstellung). Sonne und Sirius sind beide Zwergsterne (die Leuchtkraft von Sirius beträgt etwa das 25-fache der Sonne), während Pollux und Arktur beide orange Riesen sind und UY Scuti ein roter Überriese ist (ihre Leuchtkraft beträgt etwa das 40-, 170- bzw. 87.000-fache der Sonne). In den inneren Kernregionen dieser Giganten ist das Wasserstoffelement durch Kernfusion weitgehend aufgebraucht (Bild von der Website [8], vom Autor bearbeitet) Astronomen verwenden im Allgemeinen die scheinbare Helligkeit, um die Helligkeit von Sternen zu beschreiben. Je kleiner der Magnitudenwert, desto heller der Stern. Die scheinbare Helligkeit eines Sterns wird hauptsächlich durch drei Faktoren bestimmt: (1) die eigene Leuchtkraft des Sterns, die hauptsächlich durch seine Masse bestimmt wird; (2) die Entfernung des Sterns; Bei Sternen mit gleicher Leuchtkraft ist die Helligkeit umso geringer, je weiter sie entfernt sind. und (3) das interstellare Medium zwischen dem Stern und uns. Aufgrund physikalischer Prozesse wie Brechung und Streuung absorbiert das interstellare Medium (z. B. Staub) die blaue Komponente der hindurchtretenden Lichtwellen, wodurch Effekte wie Rötung und Abschwächung entstehen und sich die Farbe und Helligkeit der Sterne verändern. Unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren ist Sirius der hellste Stern am Nachthimmel (Venus ist der hellste Planet), der am Winternachthimmel im Großen Hund (in der Nähe von Orion) deutlich sichtbar ist. Abschluss Sollten unsere bekannten Liedtexte nach der Lektüre dieses Artikels wie folgt geändert werden? „Funkel, funkel, kleiner Stern, der Himmel ist voller ‚kleiner‘ Sterne …“ Die Frage ist also: Woher kommen die Sterne am Himmel? Bleiben Sie dran für die nächste Folge, um es herauszufinden. |
>>: Wann sind die Elefanten in Zhejiang verschwunden?
Artikel empfehlen
Schock! Der Verzehr von zu viel proteinreicher Nahrung kann großen Schaden anrichten! Trauen Sie sich nach der Lektüre immer noch, so zu essen?
Zusammengestellt von: Gong Zixin Eine proteinreic...
Wie werden Muskeln aufgebaut?
Viele Menschen sind verwirrt und möchten wissen, ...
Ist es für Babys ein Problem, an ihren Fingern zu lutschen? Halten Sie Ihr Baby nicht davon ab, die Welt mit dem Mund zu „schmecken“
Es heißt oft, dass „Kinderhände voller Honig sind...
Neue Art, TV-Spiele zu spielen: KO Arcade Customized Edition Onmyoji Arcade Joystick Bildbewertung
Aufgrund der Popularität von TV-Spielen stellen d...
Der Trend zu Upgrades im High-End-Konsumbereich nimmt rasch zu. Welche Rolle spielt Sony?
Angesichts der Veränderungen in der Konsumstruktur...
Schrödingers Katze „zähmen“: Durchbruch in der Quantencomputer-Entwicklung
Physiker der University of Sussex haben eines der...
Wird man durch das Trinken von Grünkohlpulver schlanker? Kann Acai-Beerenpulver Ihre Haut aufhellen? Schauen Sie sich diesen Artikel an!
Autor: Xue Qingxin, einer der ersten Ernährungsle...
Das Geheimnis des anhaltenden Erfolgs von Baidu und Google
Ob Google, Baidu oder Yandex (Russlands größte Suc...
So gehen Sie mit Verletzungen im Freien um
Das Beharren auf Bewegung im Freien im Winter kan...
【Kreatives Kultivierungsprogramm】Warum müssen Festplatten partitioniert werden?
Autor: Zhou Lei Rezensent: Chen Xudong Ich glaube...
Von Dinosauriern bis zu Vögeln: Warum verlangsamte sich die Evolution?
Es gibt einige wichtige Knotenpunkte in der Gesch...
Samsung Galaxy S8 Akkulaufzeit-Test: Eklatant reduziert im Vergleich zum S7!
Das Samsung S8/S8+ ist gerade erschienen und die A...
Sind Liegestütze eine gute Übung für die Arme?
Der Körper ist für uns unbeschreiblich wichtig, i...
Wie können Sie Ihre Nackenmuskulatur trainieren?
In einigen Werbematerialien für Filme und Fernseh...
Im Frühling kommt es häufig zu Urtikaria. Wie wird man es los?
Das Wetter wird wärmer und die Tage werden länger...