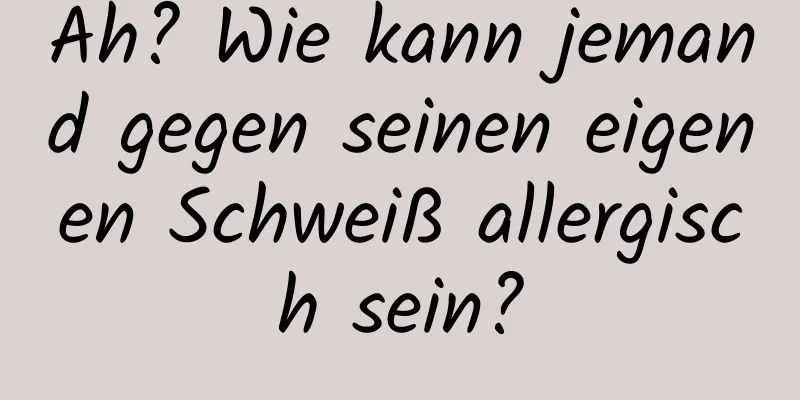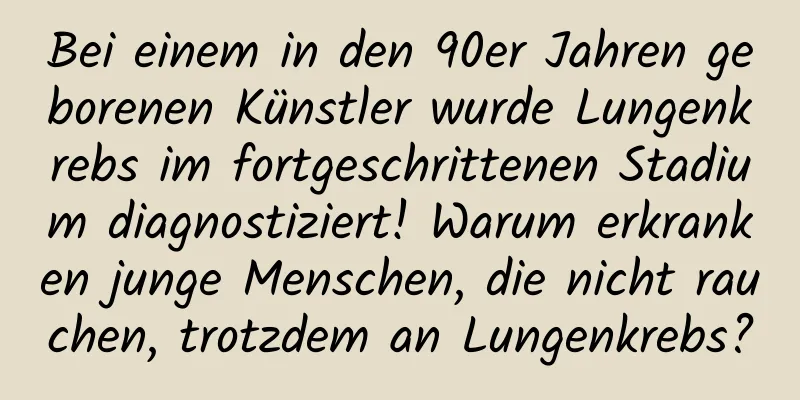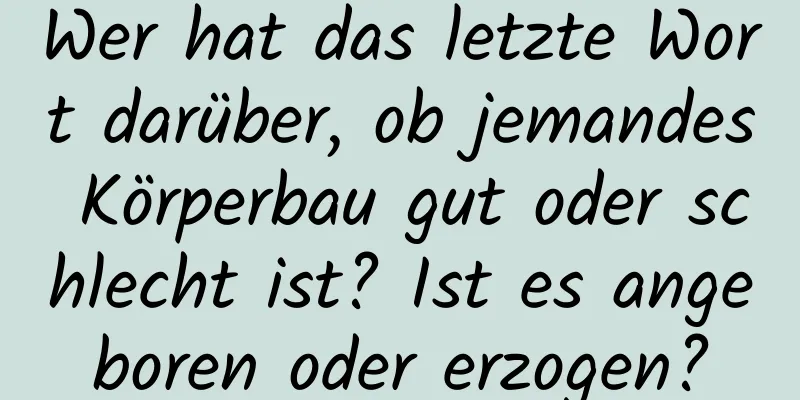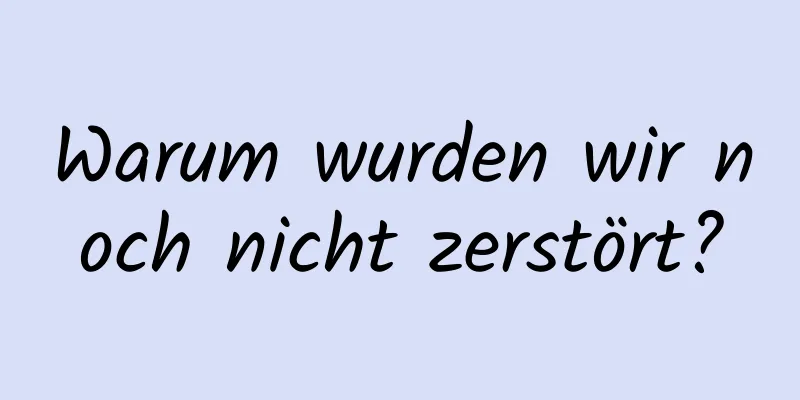Hat die menschliche Evolution aufgehört?
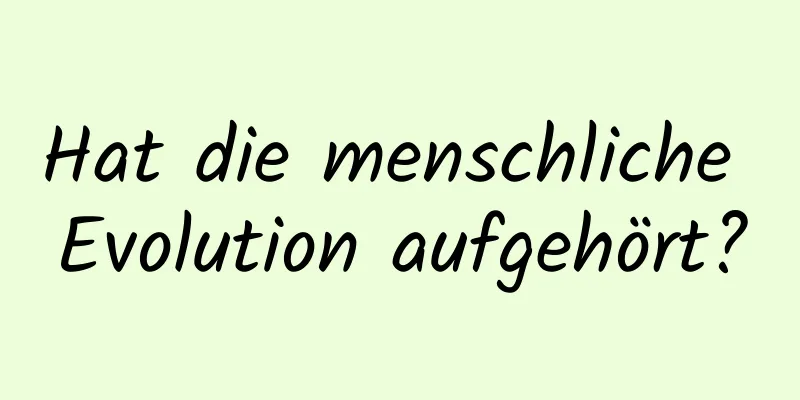
|
Bildquelle: pixabay Seit die Vorfahren des Menschen Afrika verließen und in alle Teile der Welt auswanderten, passten sich die Menschen in den verschiedenen Regionen schnell an die örtliche Umgebung an und entwickelten unterschiedliche Eigenschaften, was darauf hindeutet, dass sich die menschliche Evolution in letzter Zeit beschleunigt hat. Durch die Analyse des menschlichen Genoms sind die Wissenschaftler jedoch zu einer völlig anderen Erkenntnis gelangt: Die natürliche Selektion verläuft äußerst langsam, und der Mensch wird auch in 5.000 Jahren noch derselbe sein wie heute. Von Jonathan Pritchard Übersetzung | Wang Chuanchao und Li Hui Vor Tausenden von Jahren reisten die Menschen über Berge und Flüsse und erreichten erstmals das Qinghai-Tibet-Plateau, das mehr als 4.200 Meter über dem Meeresspiegel liegt. In solch großen Höhen beträgt der durchschnittliche Sauerstoffgehalt der Luft nur etwa 60 % des Sauerstoffgehalts auf Meereshöhe. Dies kann zu chronischer Höhenkrankheit führen, die Kindersterblichkeit erhöhen und eine schwere Belastung für den Körper der Kinder darstellen. Vor etwa zehn Jahren wurde im Rahmen einer Reihe von Studien eine Genvariante entdeckt, die unter Tibetern in China häufig vorkommt, in anderen Bevölkerungsgruppen jedoch selten ist. Es kann die Menge der bei Tibetern produzierten roten Blutkörperchen regulieren, was möglicherweise erklärt, warum sich Tibeter an die raue Lebensumgebung anpassen können. Die Entdeckung ist ein anschauliches Beispiel dafür, wie sich Menschen in der nicht allzu fernen Vergangenheit schnell an neue Umgebungen angepasst haben. Einer Studie zufolge verbreitete sich die vorteilhafte Mutation vor weniger als 3.000 Jahren unter den meisten Tibetern – evolutionär gesehen ein Wimpernschlag. Die Ergebnisse bei Tibetern scheinen die Ansicht zu stützen, dass der Mensch seit seinem Auszug aus Afrika vor etwa 60.000 Jahren (Schätzungen reichen von 50.000 bis 100.000 Jahren) viele solcher physiologischen Anpassungen durchgemacht hat. Es lässt sich nicht leugnen, dass viele der menschlichen Anpassungen an die Umwelt „technologische“ Elemente enthalten. Wir haben beispielsweise Kleidung entwickelt, um uns vor der Kälte zu schützen. Doch in prähistorischen Zeiten reichte Technologie allein nicht aus, um Umweltprobleme wie die weite Verbreitung von Infektionskrankheiten und die dünne Luft in den Bergen zu lösen. In diesen Fällen kann die Anpassung des Menschen an die Umwelt nur durch genetische Evolution und nicht durch Technologie gelöst werden. Daher kann man davon ausgehen, dass eine umfassende Untersuchung des menschlichen Genoms viele neue genetische Mutationen zutage fördern wird, die sich in jüngster Zeit aufgrund natürlicher Selektion in verschiedenen Populationen ausgebreitet haben. Das bedeutet, dass Menschen mit diesen Mutationen gesündere und reproduktiv erfolgreichere Kinder haben werden als die Kinder anderer Menschen. Im Jahr 2004 machten sich meine Kollegen und ich auf die Suche nach Spuren weitreichender Umweltprobleme im menschlichen Genom. Wir möchten verstehen, wie sich der Mensch entwickelt hat, nachdem er vor Zehntausenden von Jahren diese globale Reise angetreten hat. Inwieweit sind genetische Unterschiede zwischen Menschen in verschiedenen Teilen der Welt auf die Anpassung der Menschen an unterschiedliche Umweltbelastungen im Rahmen der natürlichen Selektion zurückzuführen? Wie viele dieser genetischen Unterschiede sind auf andere Faktoren zurückzuführen? Dank der technologischen Fortschritte bei der Untersuchung genetischer Variationen sind wir nun in der Lage, diese Fragen zu beantworten. Studien haben gezeigt, dass es im menschlichen Genom fast keine genetischen Mutationen gibt, die durch sehr schnelle und intensive natürliche Selektionsprozesse verursacht werden. Im Gegensatz dazu scheint der Großteil der natürlichen Selektion, die wir im menschlichen Genom beobachten, über Zehntausende von Jahren stattgefunden zu haben. Häufig scheint es vorgekommen zu sein, dass sich eine vorteilhafte Mutation vor langer Zeit als Reaktion auf lokale Umweltbelastungen in einer menschlichen Population verbreitete und dann bei der Migration dieser Menschen in neue Gebiete weiter verbreitet wurde. Diese uralten Spuren der natürlichen Selektion bleiben Tausende von Jahren im Genom erhalten, ohne durch neue Umwelteinflüsse verändert zu werden. Dies zeigt, dass der Prozess der natürlichen Selektion viel langsamer abläuft, als Wissenschaftler sich das vorgestellt haben. Es scheint, dass die schnelle Evolution dieses wichtigen Gens bei Tibetern nur ein Sonderfall sein könnte. Als Evolutionsbiologe frage ich mich oft: Entwickelt sich der Mensch heute noch weiter? Wir entwickeln uns sicherlich noch weiter. Die Antwort auf die Frage, wie wir uns weiterentwickeln, ist jedoch viel komplizierter. Die klassische natürliche Selektion funktioniert folgendermaßen: Eine vorteilhafte Mutation verbreitet sich wie ein Lauffeuer in der menschlichen Bevölkerung. Unsere Daten zeigen jedoch, dass diese Art der natürlichen Selektion beim Menschen in den letzten 60.000 Jahren tatsächlich selten vorkam. Für diese Art der Evolution ist es normalerweise erforderlich, dass bestimmte Umweltbelastungen über Zehntausende von Jahren unverändert bleiben. Dies wurde seltener, als die Menschen begannen, weltweit zu wandern und die Geschwindigkeit technologischer Erfindungen zuzunehmen begann. Die Erkenntnisse vertiefen nicht nur unser Verständnis der jüngsten menschlichen Evolution, sondern vermitteln uns auch ein tieferes Verständnis davon, wie die Zukunft der Menschheit aussehen könnte. Derzeit stehen wir vor zu vielen Herausforderungen, wie etwa dem globalen Klimawandel und häufigen Infektionskrankheiten. Die natürliche Selektion erfolgt zu langsam und wird uns wahrscheinlich nicht viel helfen. Wir können uns nur auf Kultur und Technologie verlassen. Impressum auswählen Im 20. Jahrhundert war es für Wissenschaftler äußerst schwierig, die genetischen Mutationen zu finden, die unsere Vorfahren als Reaktion auf Umweltveränderungen entwickelten, da die für diese Forschung erforderlichen Instrumente nicht existierten. Mit der vollständigen Entschlüsselung des menschlichen Genoms entdeckten Wissenschaftler immer mehr Genmutationen, und diese Situation hat sich grundlegend geändert. Insgesamt gesehen sind die Genome zweier beliebiger Menschen äußerst ähnlich und unterscheiden sich nur in etwa einem von 1.000 Nukleotidpaaren. Eine DNA-Stelle, an der ein Nukleotidpaar durch ein anderes ersetzt wird, wird als Einzelnukleotid-Polymorphismus (SNP) bezeichnet, und die einzelnen DNA-Fragmente an jeder SNP-Stelle werden Allele genannt. Da die meisten Sequenzen im Genom weder Proteine kodieren noch die Genexpression regulieren, haben viele SNPs möglicherweise keine signifikante Wirkung auf einzelne Personen. Wenn jedoch ein SNP in einer Region auftritt, die Proteine kodiert oder die Genexpression reguliert, kann dies die Struktur und Funktion eines Proteins oder den Ort oder das Ergebnis der Proteinsynthese beeinträchtigen. Wenn die natürliche Selektion ein bestimmtes Allel besonders „bevorzugt“, wird dieses Gen im Zuge der Reproduktion der Population immer häufiger vorkommen. Umgekehrt werden unbeliebte Gene immer seltener. Wenn die Umwelt in diesem Zustand bleibt, verbreitet sich das vorteilhafte Allel, bis jeder in der Population es trägt – ab diesem Zeitpunkt gilt das Allel als in der Population verankert. Wenn ein vorteilhaftes Allel einem Individuum einen großen Überlebensvorteil verschaffen kann, kann sich das Gen theoretisch innerhalb weniger hundert Jahre in der Population festsetzen. Wenn der damit verbundene Vorteil hingegen nicht so offensichtlich ist, wird es Tausende von Jahren dauern, bis sich die Population stabilisiert. Ideal wäre es, wenn wir bei der Untersuchung der jüngsten menschlichen Evolution DNA-Proben aus urzeitlichen menschlichen Überresten entnehmen und anhand dieser Proben verfolgen könnten, wie sich vorteilhafte Allele im Laufe der Zeit verändert haben. Allerdings zerfällt die DNA in antiken Überresten oft schnell, was die Gewinnung von DNA-Proben erschwert. Aus diesem Grund haben wir und viele Wissenschaftler auf der ganzen Welt Methoden entwickelt, um durch die Untersuchung der genetischen Variation des modernen Menschen nach Hinweisen auf die Wirkung natürlicher Selektion in der Vergangenheit zu suchen. Bildquelle: pixabay Mehrere Studien haben im menschlichen Genom Hunderte eindeutiger Anzeichen natürlicher Selektion aus den vergangenen 60.000 Jahren gefunden, seit unsere Vorfahren aus Afrika ausgewandert sind. Bei einigen dieser Marker ist den Wissenschaftlern bereits bekannt, welchen Selektionsdruck sie darstellen und welchen Nutzen die Allele mit diesen Markern dem Menschen bringen. Bei Nomadenvölkern in Europa, dem Nahen Osten und Ostasien haben Regionen des Genoms, die Gene für das Enzym Laktase enthalten, das die Laktose in Milchprodukten spaltet, offensichtlich ein hohes Maß an natürlicher Selektion erfahren. In den meisten Bevölkerungsgruppen werden Säuglinge mit der Fähigkeit geboren, Laktose zu verdauen. Nach dem Abstillen wird das Laktasegen jedoch nicht mehr exprimiert, sodass Menschen als Erwachsene keine Laktose mehr verdauen können. Im Jahr 2004 veröffentlichte ein Forscherteam des Massachusetts Institute of Technology einen Artikel im American Journal of Human Genetics, in dem es feststellte, dass es ihrer Schätzung zufolge nur 5.000 bis 10.000 Jahre dauerte, bis sich die Mutation des Laktase-Gens, das bei Erwachsenen noch aktiv ist, unter europäischen Nomaden durchsetzte. Im Jahr 2006 berichtete ein Forscherteam unter der Leitung von Sarah Tishkoff, heute an der University of Pennsylvania, in Nature Genetics, dass sie Hinweise auf eine schnelle Evolution des Laktase-Gens bei ostasiatischen Nomaden gefunden hätten. Bei diesen Veränderungen handelt es sich definitiv um eine Anpassung an neue Lebensbedingungen. Wir können den Einfluss der Selektion auch in einer Reihe von Genen erkennen, die Resistenzen gegen Infektionskrankheiten verleihen. Pardis Sabeti von der Harvard University in den USA entdeckte ein Gen, das sich erst vor kurzem bei den meisten Yoruba in Nigeria verbreitet hat, das sogenannte LARGE-Gen. Dies ist höchstwahrscheinlich eine Folge der Reaktion der Yoruba auf das Lassa-Fieber (ein akutes virales hämorrhagisches Fieber), das erst vor kurzem in der Region aufgetreten war. Langsame Entwicklung Diese und einige andere Beispiele liefern starke Beweise dafür, dass die natürliche Selektion die Verbreitung nützlicher Allele rasch fördern kann. Bei den verbleibenden mehreren hundert Kandidaten für Imprinting-Gene wissen wir jedoch noch nicht, welche Umweltbedingungen die Verbreitung dieser ausgewählten Allele gefördert haben und welche Auswirkungen das Tragen dieser Allele hätte. Unsere Analyse und die anderer Wissenschaftler lassen darauf schließen, dass diese Hunderte von möglichen Abdrücken mindestens mehrere Hundert Episoden schneller selektiver Eliminierung in den untersuchten menschlichen Populationen der letzten 15.000 Jahre darstellen könnten. Doch in einer neueren Studie fanden meine Kollegen und ich Hinweise darauf, dass die überwiegende Mehrheit dieser Prägungen keineswegs auf eine schnelle, kürzlich erfolgte Anpassung des Menschen an die örtlichen Gegebenheiten zurückzuführen ist. In Zusammenarbeit mit Kollegen der Stanford University in den USA haben wir einen großen Satz von SNP-Daten aus DNA-Proben von 1.000 Menschen auf der ganzen Welt analysiert. Als wir die geografische Verteilung von Allelen mit selektiven Prägungen untersuchten, stellten wir fest, dass die meisten der scheinbaren selektiven Prägungen einem von drei Verteilungsmustern folgten: „Out-of-Africa-Clearance-Muster“, „West-Eurasisches Clearance-Muster“ und „Ost-Asien-Clearance-Muster“. Diese Säuberungsmuster legen etwas Interessantes nahe: Die Migrationen der menschlichen Vorfahren hatten einen starken Einfluss auf die globale Verteilung nützlicher Allele, während die natürliche Selektion wenig dazu beigetragen hat, diese Verteilungen an die modernen Umweltbelastungen anzupassen. Nehmen wir zum Beispiel eine Mutation im SLC24A5-Gen, einem der wichtigsten Gene für helle Hautfarbe. Da es sich um eine Anpassung an eine verringerte Lichtintensität handelt, könnte man erwarten, dass die Häufigkeit dieser Mutation in der Population mit zunehmendem Breitengrad zunimmt und ihre Verteilung in nordasiatischen und nordeuropäischen Populationen ähnlich ist. Was wir jedoch beobachten, ist ein „westeurasisches Clearance-Muster“: Diese Mutation und ihre „per Anhalter-DNA“ kommen in Populationen von Pakistan bis Frankreich häufig vor, sind jedoch in ostasiatischen Populationen, sogar in nordostasiatischen Populationen, fast nicht vorhanden. Ein solches Verteilungsmuster bedeutet, dass dieses vorteilhafte Mutationsgen in der westeurasischen Population produziert und in das Gebiet gebracht wurde, in dem diese Population lebt, nachdem sich der gemeinsame Vorfahr der westeurasischen Population und der ostasiatischen Population getrennt hatte. Daher war das anfängliche weitverbreitete Auftreten des Gens SLC24A5 in der menschlichen Bevölkerung das Ergebnis natürlicher Selektion. Welche Populationen dieses Gen heute besitzen und welche nicht, wird jedoch zu einem gewissen Grad durch die Geschichte der frühen Menschen bestimmt (die helle Hautfarbe der Ostasiaten wird durch andere genetische Varianten verursacht). Eine genauere Analyse dieser und anderer Daten zum selektiven Imprinting brachte ein weiteres merkwürdiges Muster ans Licht. Die Häufigkeit einiger Allele variiert stark zwischen verschiedenen Populationen. Beispielsweise haben fast alle Asiaten sie, aber kein Afrikaner. Man könnte erwarten, dass die natürliche Selektion erhebliche „Tramper“-Effekte aufweist und die schnelle Verbreitung dieser neuen Allele fördert. Aber die überwiegende Mehrheit dieser Gene zeigte keinen derartigen Effekt. Stattdessen scheinen sich die Gene im Laufe der 60.000 Jahre seit der Auswanderung unserer Vorfahren aus Afrika allmählich verbreitet zu haben. Angesichts dieser Erkenntnisse gehen meine Kollegen und ich davon aus, dass klassische Selektionswellen – bei denen sich eine neue vorteilhafte Mutation durch natürliche Selektion rasch in einer Population festsetzt – tatsächlich nur selten auftraten, nachdem unsere Vorfahren zu ihren abenteuerlichen Reisen rund um den Globus aufgebrochen waren. Wir vermuten, dass die Auswirkungen der natürlichen Selektion auf einzelne Allele relativ schwach sind und daher die Verbreitung von Genen nur langsam fördern können. Auf diese Weise können sich die meisten Allele unter Selektionsdruck nur dann in der Population verbreiten, wenn die Umweltbelastungen über Zehntausende von Jahren unverändert bleiben. Sich weiterentwickeln? Unsere Schlussfolgerungen scheinen paradox: Wenn es tatsächlich 50.000 und nicht 5.000 Jahre dauert, bis ein nützliches Allel in einer Population weit verbreitet ist, wie kommt es dann, dass sich der Mensch so schnell an neue Umgebungen anpassen konnte? Obwohl die am besten verstandenen adaptiven Veränderungen auf Mutationen einzelner Gene zurückzuführen sind, entsteht die überwiegende Mehrheit der adaptiven Veränderungen wahrscheinlich nicht auf diese Weise, sondern ist das Ergebnis einiger weniger genetischer Varianten, die geringfügige Auswirkungen auf Tausende oder Zehntausende verwandter Gene im Genom haben. Wenn die natürliche Selektion die menschliche Körpergröße moduliert, geschieht dies über einen weiten Bereich und verändert die Häufigkeit von Hunderten oder sogar Tausenden verschiedener Allele. Wie die Pygmäen leben sie in den tropischen Regenwäldern Afrikas, Südostasiens und Südamerikas, wo ihre geringe Körpergröße eine bessere Anpassung an die nährstoffarme Umwelt darstellt. Wenn die Prävalenz jedes „Kleinwuchsgens“ nur um 10 % zunehmen könnte, würden die meisten Pygmäen in kurzer Zeit mehr dieser Gene erwerben und die Körpergröße der gesamten Gruppe würde kleiner werden. Selbst wenn die Körpergröße der Pygmäen insgesamt einem sehr starken Selektionsdruck unterworfen wäre, könnte der Selektionsdruck auf jedes einzelne „Körpergrößen-Gen“ dennoch sehr schwach sein. Aus diesem Grund hinterlässt die polygene Anpassung nicht die Art selektiver Spuren im Genom, die wir in unseren Studien oft sehen. Entwickelt sich der Mensch noch weiter? Es ist immer noch schwierig, Beweise dafür zu finden, dass die natürliche Selektion auch heute noch auf den Menschen einwirkt. Es ist jedoch nicht schwer, sich vorzustellen, welche menschlichen Eigenschaften von der natürlichen Selektion beeinflusst werden könnten. In Entwicklungsländern üben Infektionskrankheiten wie Malaria und AIDS einen starken Selektionsdruck auf die Bevölkerung dieser Länder aus. Bekannte genetische Mutationen, die der lokalen Bevölkerung eine gewisse Resistenz gegen diese Krankheiten verleihen, unterliegen möglicherweise einer starken Selektion, da Menschen mit diesen Mutationen eine höhere Überlebenschance und höhere Nachkommenschaftsraten haben als Menschen ohne diese Mutationen. In Industrieländern, wo nur wenige Menschen vor dem Erwachsenenalter sterben, sind es die Gene, die möglicherweise dem größten Selektionsdruck unterliegen, die die Anzahl der Kinder beeinflussen. Theoretisch könnte jeder Aspekt der Fruchtbarkeit oder des Fortpflanzungsverhaltens, der durch genetische Mutationen beeinflusst wird, Ziel der natürlichen Selektion sein. Doch die meisten genetischen Merkmale des Menschen verändern sich im Vergleich zur Geschwindigkeit des Wandels in Kultur, Technologie und natürlich der Umwelt der Erde äußerst langsam. Darüber hinaus würden größere Anpassungsänderungen erfordern, dass die Umwelt über Dutzende Millionen Jahre unverändert bliebe. Daher wird sich die Umwelt, in der die Menschen leben, in den nächsten 5.000 Jahren zweifellos stark verändern. Solange das Genom jedoch nicht in großem Maßstab künstlich verändert wird, werden die Menschen wahrscheinlich unverändert bleiben. Globale Wissenschaft |
<<: Die heißen Wolken zerstreuten sich und die kühle Brise stieg auf
>>: Shaxian ist das Reich der Snacks und Danxia ist ein Weltkulturerbe
Artikel empfehlen
GAC Toyota: Im März 2025 erreichte der Absatz von GAC Toyota 66.066 Einheiten, ein Anstieg von 19,3 % gegenüber dem Vorjahr
Kürzlich gab GAC Toyota offiziell bekannt, dass s...
Erstmals auf dem chinesischen Markt eingeführt, wurden Spionagefotos des neuen Audi Q8 bei Straßentests veröffentlicht
Ausländischen Medienberichten zufolge wurden Spio...
Untergraben Sie die Erkenntnis! Specht prallt gegen Baum, ohne einen „Schutzhelm“ zu tragen
Man geht oft davon aus, dass die schwammartigen K...
Diese „Sonnenschutz-Wunderwaffe“ birgt bei falscher Anwendung echte Risiken! Viele Leute wenden es immer noch bei ihren Kindern an …
Der Sommer kommt Verschiedene „Sonnenschutz-Zaube...
Wie viele Schritte sind nötig, um einen Wal in ein Museum zu bringen?
Am 9. Dezember wurde das Finnwalskelett im Shangh...
Taobao Mobile gibt Weitao-Daten bekannt: Nach zwei Monaten interner Tests übersteigen die Nutzerzahlen 60 Millionen
Anfang 2013 kündigte Qiu Changheng, Leiter von Ta...
Olympiasieger Zheng Qinwen besteht darauf, 360 Tage lang Hühnerbrust und Brokkoli zu essen. Können normale Menschen dasselbe tun?
Gutachter: Peng Guoqiu, stellvertretender Chefarz...
China beginnt heute mit der Kontrolle seiner Galliumexporte. Wie stark wird die globale Lieferkette beeinträchtigt?
Ab dem 1. August wird China Exportkontrollen für ...
Mercer & Marsh & McLennan: Bericht zum Aging and Automation Resilience Index
Eine neue Studie von Mercer und Marsh & McLen...
Sobald Fubao nach Hause kam, begann er, mit Bambus anzugeben. Er ist offensichtlich ein Bär, warum also entscheidet er sich, Vegetarier zu sein? | Expo Daily
Sobald Fubao nach Hause kam, begann er, mit dem B...
Ihr Telefon nach Belieben falten lassen? Das von Wissenschaftlern entwickelte elastische ferroelektrische Material kann es!
Produziert von: Science Popularization China Auto...
Ein Blick auf den Nobelpreis 2022: Wie ist der Mensch entstanden?
Am 3. Oktober 2022 um 11:30 Uhr Ortszeit (17:30 U...
CBRE: Nutzen Sie die Chance für Logistikinvestitionen in erstklassigen Städten in den nächsten zwei Jahren
Aufgrund des neuen Angebots und der wirtschaftlic...
Welche Auswirkungen hat körperliche Betätigung auf den Körper
Viele Menschen treiben nicht gern Sport, was nich...
Atemanpassung beim Laufen
Jeder von uns muss beim Laufen seine Atmung kontr...