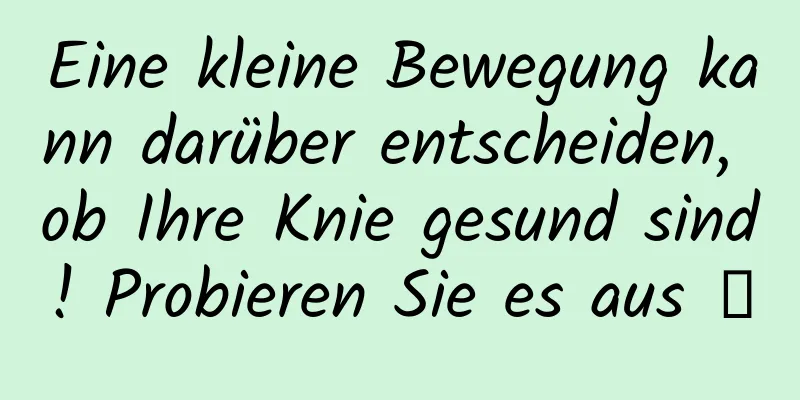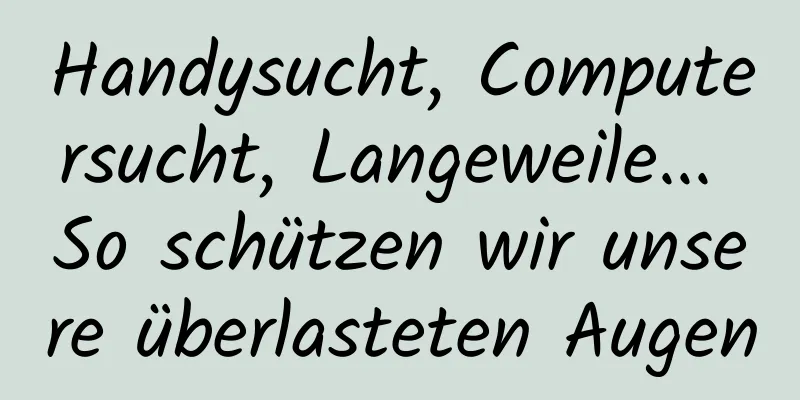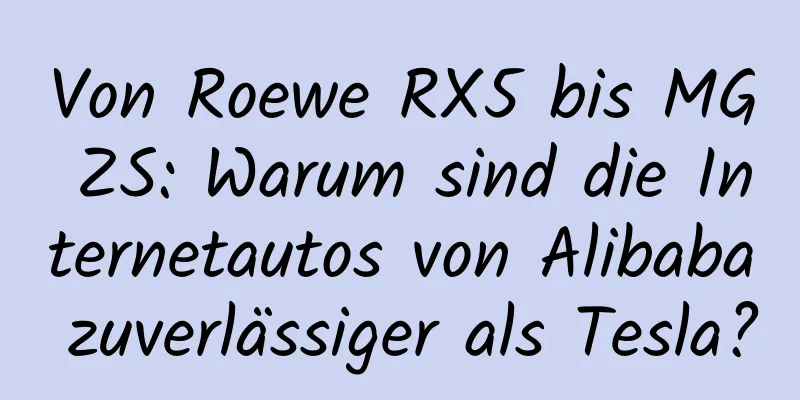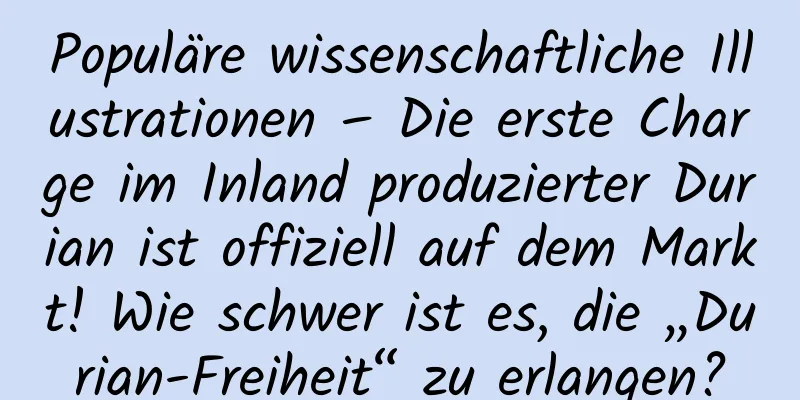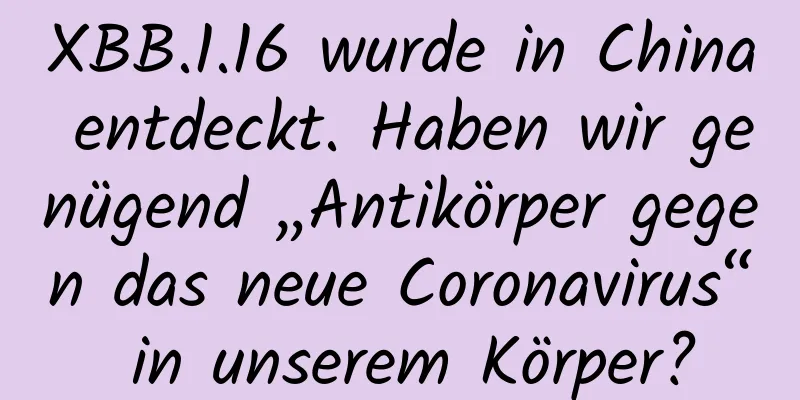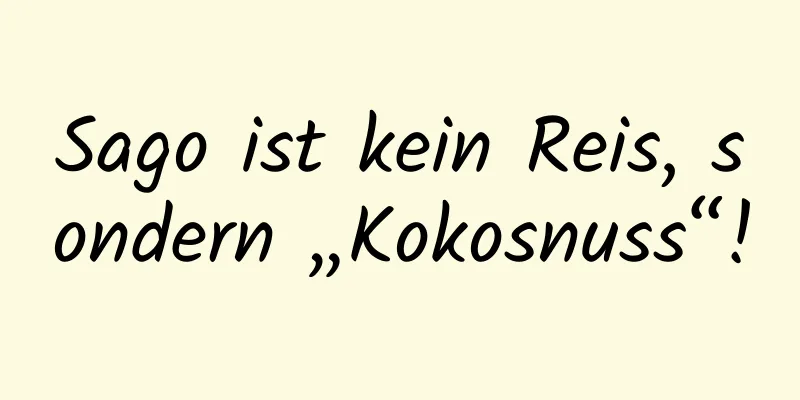Hubble entdeckt, dass es in diesem 20.000 Lichtjahre entfernten Sternhaufen schwer ist, Planeten zu bilden
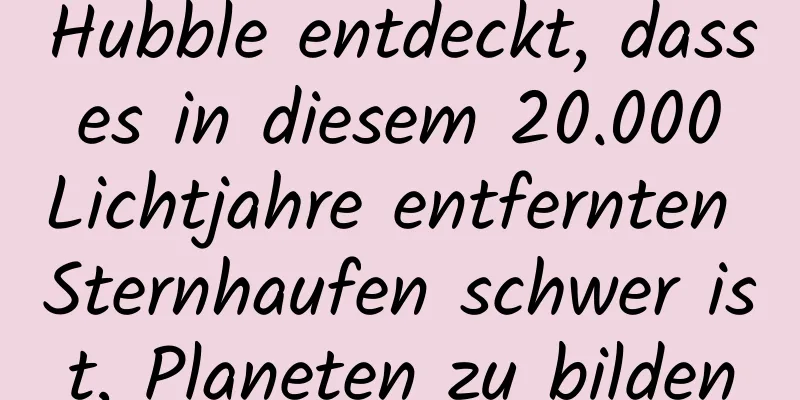
|
Mithilfe des Hubble-Weltraumteleskops haben Astronomen entdeckt, dass es in der chaotischen Zentralregion des massereichen und überfüllten Sternhaufens Westerlund 2 schwer ist, Planeten zu bilden. Westerlund 2 liegt 20.000 Lichtjahre entfernt und ist ein einzigartiges Labor für die Untersuchung von Sternentwicklungsprozessen, da es relativ nahe und recht jung ist und eine große Anzahl von Sternen enthält. Eine dreijährige Untersuchung der Westerlund-2-Sterne durch das Hubble-Weltraumteleskop ergab, dass die Vorläufer der protoplanetaren Scheiben, die Sterne in der Nähe des Zentrums des Haufens umgeben, auf mysteriöse Weise keine großen, dichten Staubwolken aufweisen. Denn aus diesen Staubwolken könnten sich Millionen von Jahren später Planeten entwickeln. Beobachtungen zeigen jedoch, dass Sterne in den äußeren Bereichen des Haufens Wolken aus riesigem, planetenbildenden Staub aufweisen, die in protoplanetare Scheiben eingebettet sind. Forscher glauben, dass unser Sonnensystem diesem Muster folgte, als es vor 4,6 Milliarden Jahren entstand. Warum fällt es manchen Sternen in Westerlund 2 schwer, Planeten zu bilden, anderen hingegen nicht? Es scheint, dass die Planetenentstehung vom Standort abhängt, wobei die massereichsten und leuchtkräftigsten Sterne eines Haufens im Kern konzentriert sind, was durch Beobachtungen anderer Sternentstehungsgebiete bestätigt wird. Große Sternhaufen enthalten in ihrem Zentrum mindestens 30 extrem massereiche Sterne, von denen einige bis zu 80-mal so massereich sind wie unsere Sonne. Ihre gleißende Ultraviolettstrahlung und orkanartigen Winde aus geladenen Teilchen sprengen protoplanetare Scheiben um nahegelegene Sterne mit geringerer Masse und zerstreuen riesige Staubwolken. „Grundsätzlich gilt: Wenn es Monstersterne gibt, verändert deren Energie die Eigenschaften der protoplanetaren Scheiben um nahegelegene, weniger massereiche Sterne“, erklärt Elena Sabbi vom Space Telescope Science Institute in Baltimore und leitende Forscherin der Hubble-Studie. Möglicherweise existiert noch immer eine protoplanetare Scheibe, doch der Stern verändert die Zusammensetzung des Staubs in der Scheibe, sodass die Bildung stabiler Strukturen erschwert wird und es letztlich auch schwierig wird, Planeten zu bilden. Die Studie legt nahe, dass der Staub entweder nach einer Million Jahren verdunstete oder sich in Zusammensetzung und Größe so dramatisch veränderte, dass sich kein Planet bildete. Die Hubble-Beobachtungen stellen das erste Mal dar, dass Astronomen einen extrem dichten Sternhaufen analysiert haben, um zu untersuchen, welche Umgebungen für die Planetenentstehung günstig sind. Allerdings ist unter Wissenschaftlern noch immer umstritten, ob massereiche Sterne im Zentrum geboren werden oder dorthin wandern. Obwohl es sich mit 2 Millionen Jahren um ein relativ junges System handelt, weist Westerlund 2 in seinem Kern bereits massereiche Sterne auf. Mithilfe der Wide Field Camera 3 des Hubble-Teleskops stellten die Forscher fest, dass 1.500 der fast 5.000 Sterne im Westerlund-2-Cluster, deren Massen zwischen dem 0,1- und dem 5-fachen der Sonnenmasse liegen, Schwankungen in ihrem Licht zeigten, da die Sterne Material aus protoplanetaren Scheiben anhäuften. In der protoplanetaren Scheibe angesammelte Orbitalmaterie kann vorübergehend einen Teil des Sternenlichts blockieren und so Helligkeitsschwankungen verursachen. Hubble hat diese Signatur jedoch nur von Material entdeckt, das Sterne außerhalb der dichten Zentralregion des Haufens umkreist. Hubble beobachtete große Helligkeitseinbrüche, die bis zu 10 bis 20 Tage anhielten, bevor etwa 5 % der Sterne wieder ihre normale Helligkeit erreichten. Bei Sternen im Umkreis von 4 Lichtjahren um das Zentrum wurden diese Einbrüche nicht festgestellt. Diese Schwankungen könnten durch große Staubwolken verursacht werden, die vor dem Stern vorbeiziehen. Von der Erde aus gesehen würden diese Klumpen auf einer geneigten Scheibe erscheinen, fast von der Seite, und die Forscher glauben, dass es sich dabei um Planetenkörper oder im Entstehen begriffene Strukturen handelt. Dies könnten die Keime sein, aus denen in sich entwickelnden Systemen schließlich Planeten entstehen. Diese Systeme sind nicht in der Nähe sehr massereicher Sterne zu sehen, sondern nur in Systemen außerhalb des Zentrums. Dank Hubble können Astronomen nun sehen, wie sich Sterne in Umgebungen ansammeln, die dem frühen Universum ähneln, wo Sternhaufen von Monstersternen dominiert wurden. Die mit Abstand bekannteste nahe Sternumgebung mit massereichen Sternen ist die Sternentstehungsregion im Orionnebel. Allerdings ist Westerlund 2 ein ergiebigeres Ziel, da es dort eine viel größere Anzahl an Sternen gibt. Durch Hubbles Beobachtungen von Westerlund 2 haben die Astronomen ein besseres Verständnis davon gewonnen, wie sich Sterne unterschiedlicher Masse im Laufe der Zeit verändern und wie die starken Winde und die Strahlung supermassereicher Sterne nahegelegene Sterne mit geringerer Masse und ihre protoplanetaren Scheiben beeinflussen. Wir sehen beispielsweise, dass Sterne mit geringerer Masse wie unsere Sonne, wenn sie sich in der Nähe extrem massereicher Sterne in einem Haufen befinden, immer noch protoplanetare Scheiben haben und während ihres Wachstums immer noch mit Materie koexistieren können. Doch die Struktur ihrer protoplanetaren Scheiben scheint sich stark von den Scheiben um Sterne zu unterscheiden, die sich in einer ruhigen Umgebung weit entfernt vom Kern eines Sternhaufens gebildet haben. Diese Information ist für die Erstellung von Modellen zur Planetenentstehung und Sternentwicklung von großer Bedeutung. Der Cluster wird ein hervorragendes Labor für Folgebeobachtungen mit dem kommenden James Webb-Weltraumteleskop der NASA sein. Das Hubble-Weltraumteleskop hat Astronomen dabei geholfen, Sterne zu identifizieren, die möglicherweise planetarische Strukturen aufweisen. Mit dem Webb-Weltraumteleskop können Forscher untersuchen, welche protoplanetaren Scheiben um Sterne kein Material ansammeln und welche Scheiben noch Material enthalten, aus dem möglicherweise Planeten entstehen könnten. Diese Informationen zu 1.500 Sternen werden es Astronomen ermöglichen, das Wachstum und die Entwicklung von Sternsystemen zu kartieren. Das Webb-Weltraumteleskop kann außerdem die chemische Zusammensetzung protoplanetarer Scheiben in verschiedenen Stadien ihrer Entwicklung untersuchen, ihre Veränderungen beobachten und Astronomen dabei helfen, herauszufinden, welche Rolle die Umgebung bei ihrer Entwicklung spielt. Bo Ke Yuan | Forschung/Von: NASA Goddard Space Flight Center Die Studie wurde in der Zeitschrift Astrophysics veröffentlicht DOI: 10.3847/1538-4357/ab7372 BoKeYuan|Wissenschaft, Technologie, Forschung, Populärwissenschaft Folgen Sie [Bokeyuan], um mehr über die schöne kosmische Wissenschaft zu erfahren |
Artikel empfehlen
Ist die Lazy-Density-Maschine wirklich nützlich?
Entspannte Gewichtsverlustmaschinen erfreuen sich...
Einblicke | Andere gut zu behandeln ist eine Art persönlicher Charme
Galerie berühmter Künstler | Albert Marche, einer...
So trainieren Sie mit dem Fahrrad
Heutzutage sind Fahrräder nicht nur ein Fortbeweg...
Wie behandelt man Beinschmerzen nach dem Joggen?
Das Hinterbein ist ein sehr wichtiger Teil des me...
Wie trainieren Fitnesssportler ihre schrägen Bauchmuskeln?
Die schrägen Bauchmuskeln sind für einen Fitnesss...
Ist Tennisspielen eine Aerobic-Übung?
Tennis ist ein sehr beliebter Sport, nicht nur be...
Zu gefährlich! Eine Gruppe von Leuten grillte und plötzlich gab es eine Explosion! Der Grund liegt eigentlich im Boden
Austern, Rindfleischwürfel, Schweinebauch Hähnche...
Werden chinesische Chiphersteller von japanischen Zulieferern aus kommerziellen oder politischen Gründen erdrosselt?
Vor Kurzem hat der japanische Wafer-Riese Sumco b...
Paul Dirac: Du wirst niemals allein gehen
Dirac ist eine einzigartige Figur in der Geschich...
Muss ich beim Seilspringen Unterwäsche tragen?
Ich glaube, jeder kennt Seilspringen, denn es ist...
Hemmt Rauchen während des Trainings das Muskelwachstum?
Fitness ist eine trendige Bewegungsform, insbeson...
„Happy Family“ oder „Glückliche Familie“, kann man bei der Begrüßung des neuen Jahres wirklich nichts falsch machen?
Autor: Cleaner, Doktorand für Exegese an der Nank...
Von Roewe RX5 bis MG ZS: Warum sind die Internetautos von Alibaba zuverlässiger als Tesla?
Alibaba, das sich kürzlich mit Roewe zusammenschl...
1-jähriges Baby an Vergiftung gestorben! Dieses Ding hat fast jeder Haushalt! Seien Sie vorsichtig!
Bei Xiaoxi (Pseudonym), einem 1 Jahr und 4 Monate...