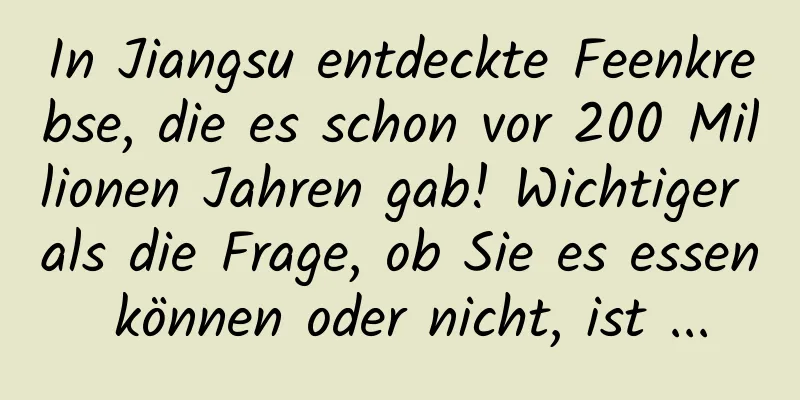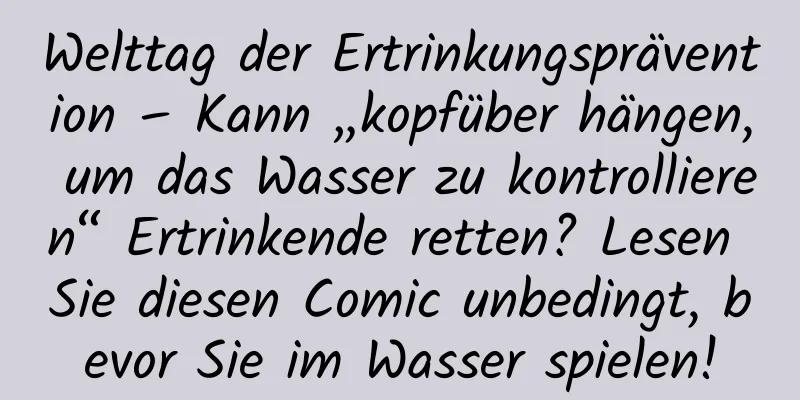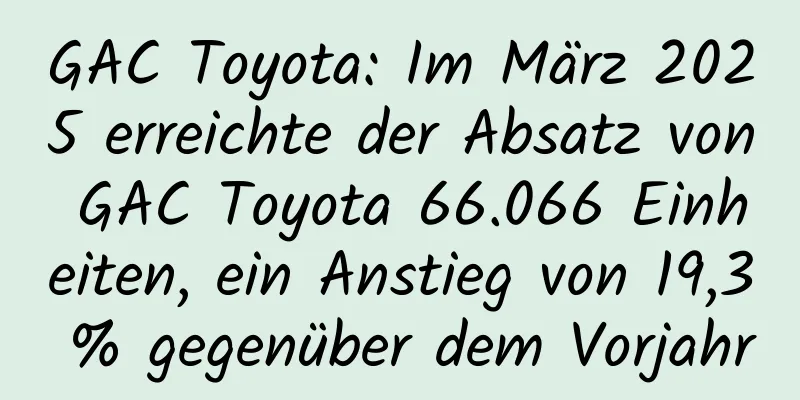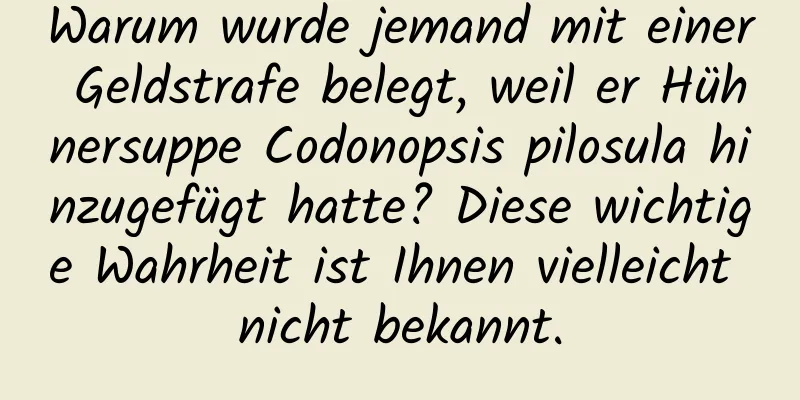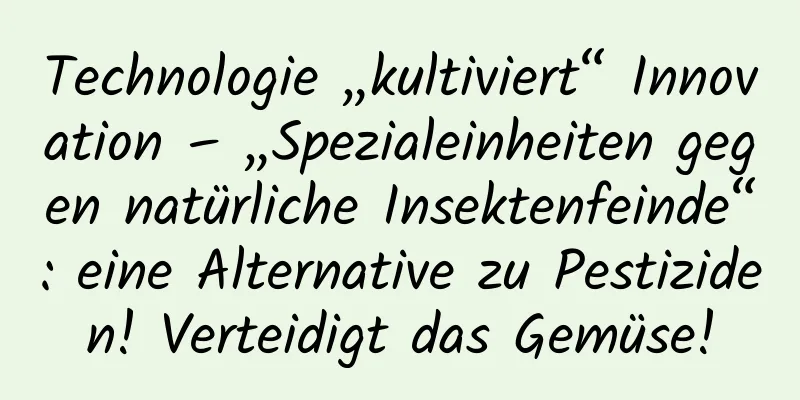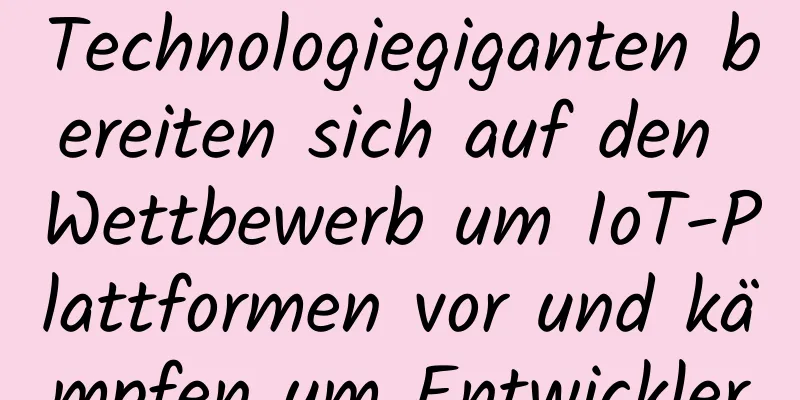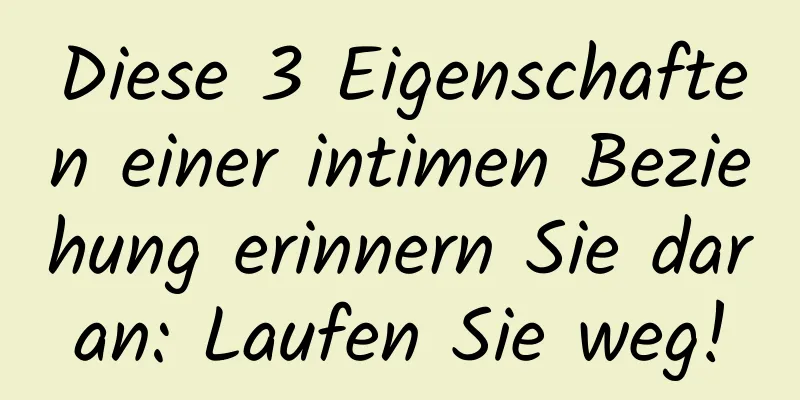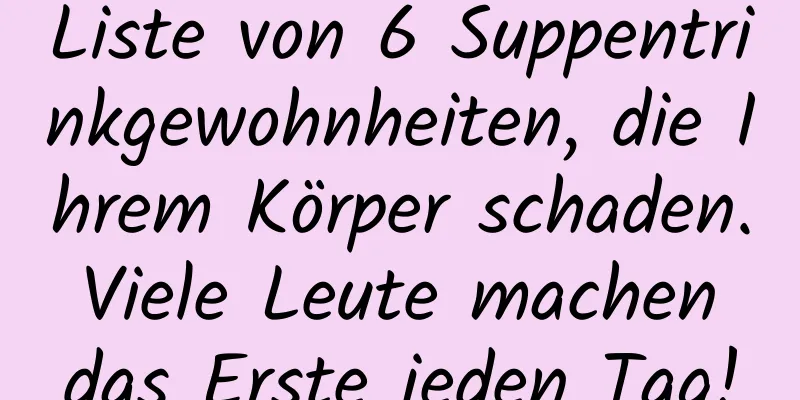Der Plan eines Mannes, die Tiere wiederzubeleben, die wir nicht retten können
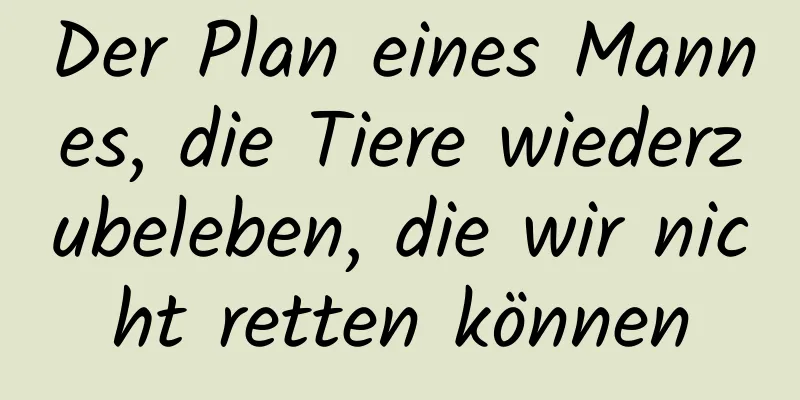
|
Leviathan Press: Wissenschaftler schätzen, dass 98 % aller Lebewesen, die jemals auf der Erde existiert haben, ausgestorben sind. Viele Experten warnen uns davor, dass die Erde das sechste Massenaussterben von Arten erlebt, da die Aktivitäten des Menschen zur Zerstörung der Lebensumwelt, zur Übernutzung natürlicher Ressourcen, zu Umweltverschmutzung und zur Klimaerwärmung führen. Wenn uns tatsächlich eine solche Zukunft bevorsteht, dann liegt die Schuld dieses Mal wahrscheinlich bei uns Menschen. Auch wenn die Aussage, dass „der Mensch 60 % der Arten auf der Erde ausgerottet hat“, nicht stimmt, müssen wir uns dennoch mit den tieferen Beweggründen für die Rettung dieser bedrohten Arten auseinandersetzen. Manche sagen, dass der Mensch hier die Rolle Gottes spielt und technologische Mittel nutzt, um bedrohte Arten wiederherzustellen oder sogar ausgestorbene Arten wiederzubeleben. Das klingt intuitiv gut, aber ist diese „Hand Gottes“, die auf der moralischen Schuld der Menschen beruht, wirklich notwendig? Schließlich muss Gott sich nicht selbst retten, aber die Menschen müssen sich letzten Endes immer noch selbst retten. In diesem Moment befindet sich Tullis Matson in einem Hubschrauber über einem Wildreservat in Südafrika. Der Hubschrauber schwebte über dem grauen, mit Gestrüpp übersäten Land und in den Staubwolken, die er aufwirbelte, konnte er gerade noch einen rennenden Elefantenbullen erkennen. Dieses riesige Monster, voller Kraft und Angst, tobte. Dem Elefanten waren zwei mit Beruhigungsmitteln gefüllte Pfeile in die Flanke geschossen worden, doch er kämpfte noch immer gegen die Wirkung des Narkosemittels an und weigerte sich, umzufallen. Es geriet in Panik und rannte zu einer nahegelegenen Pfütze. Ein Hubschrauber hielt ihm im Weg, um ihn aufzuhalten: Wenn der Elefant ins Wasser fiele, würde er ertrinken. Die Pattsituation wurde schnell aufgelöst, als die Elefanten auf die Knie fielen, ein Stück Gestrüpp plattmachten und ein Hubschrauber neben mehreren Lastwagen landete. Was folgt, ist eine magische Szene. Eine Gruppe von Menschen drehte den Elefanten eilig um, damit er ungehindert atmen konnte. Ursprünglich lag es auf dem Bauch, jetzt liegt es auf der Seite. Mattson, 53, aus Shropshire, England, trug wie ein Streifenpolizist Khakihosen und eine Sonnenbrille. Er kniete neben dem Elefanten nieder und führte seine Genitalien in ein Gerät ein, das wie ein riesiges Kondom aussah. Ein Naturschützer führt eine Sonde ein, die einen leichten elektrischen Strom abgibt, um die Prostata des Elefanten zu stimulieren (und so die Ejakulation anzuregen). Diese Methode wird als elektrische Stimulation der Samengewinnung bezeichnet. Sie begannen mit der Arbeit und nachdem die Samensammlung abgeschlossen war, packten sie ihre Ausrüstung zusammen, stiegen in den Hubschrauber und schwebten in der Luft, um zu beobachten, bis der Elefant aufwachte und langsam wegging. Mattson schickte mir per WhatsApp ein Video der bizarren Szene, das im Oktober 2019 gefilmt wurde. Er sagte, es sei eine der besten Erfahrungen gewesen, die er je gemacht habe. Das gesammelte Elefantensperma wird zur Lagerung auf Mattsons Farm gebracht und später in Zuchtprogrammen verwendet. Die Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) gibt an, dass es bei Elefanten in Gefangenschaft eine hohe Totgeburten- und Kälbersterblichkeitsrate gibt. Da diese gefährdete Art in den kommenden Jahrzehnten vom Aussterben bedroht ist, arbeiten Naturschützer und Elefantenschutzgebiete zusammen, um Samenproben von wilden Elefanten zu sammeln und an Schutzgebiete anderswo zu schicken. So könnte die Überlebensrate der Nachkommen durch künstliche Befruchtung verbessert werden. Aber Mattson ist weder Ranger noch Elefantenschützer. Er betreibt ein Unternehmen für künstliche Befruchtung von Rennpferden und versorgt damit seine eigene Farm in Shropshire, England. Das Unternehmen sammelt und lagert Sperma von preisgekrönten Hengsten zur Verwendung in der Zucht. Er ist vielleicht nicht der Auserwählte, der das Tierreich retten soll, aber genau das ist sein Ziel. Mattson hat seine Fähigkeiten von Pferden auf gefährdete Tiere übertragen und plant, Europas größte Biobank tierischer Zellen aufzubauen. Im Dezember 2020 gründete er die Wohltätigkeitsorganisation Nature’s SAFE, deren Ziel es ist, 50 Millionen genetische Proben zu sammeln und sie in einen „Zeitgefrierschrank“ zu legen. Dabei werden Kryotanks verwendet, um Zellen einiger vom Aussterben bedrohter Arten wie dem Amurleoparden, dem Spitzmaulnashorn und dem Berghühnerfrosch zu konservieren. Er arbeitet unter anderem mit Institutionen wie dem Chester Zoo, der European Association of Zoos and Aquaria und Forschern der Universität Oxford zusammen. Dabei hofft er, Spermaproben sowie Eizellen und andere Gewebe zu sammeln und aufzubewahren, die eines Tages dazu verwendet werden könnten, die Populationen schwindender Arten zu stärken und ihr Aussterben zu verhindern. Als wir das erste Mal sprachen, war seine Organisation erst einen Monat alt und hatte bereits 30 Exemplare gesammelt, darunter Tamarine, Hirschferkel, Kolumbianische Klammeraffen und Pantherchamäleons. „Was wir tun, ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagte er. „Wir wollen wie die Millennium Seed Bank sein, die Samenbank für das Tierreich.“ Der vom Aussterben bedrohte bunte Tamarin. © TIM FLACH Umweltschützer sind schon lange von der Idee fasziniert, dass wir vielleicht nicht nur bedrohte Arten schützen, sondern auch Tiere vor dem Aussterben bewahren könnten. In den letzten Jahrzehnten führten sie einen aussichtslosen Kampf, um die Schäden auszugleichen, die der Mensch den Tieren zugefügt hat. Im Jahr 2003 schrieben Naturschützer Geschichte, als eine Ziege unter den aufgeregten Augen der Wissenschaftler einen Pyrenäensteinbock (im Volksmund „Bucardo“ genannt) zur Welt brachte. In den letzten 200 Jahren ist die Population des Pyrenäensteinbocks durch die Jagd auf nur noch einen einzigen geschrumpft. Die letzte Ziege namens Celia wurde vor drei Jahren von einem umstürzenden Baum getötet. Doch ein Team des Zentrums für Forschung und Technologie im Bereich Nährstoffe in Agrarökosystemen im spanischen Aragon unter der Leitung des Wissenschaftlers José Folch Pera hat das ausgestorbene Tier erstmals wieder zum Leben erweckt. Folch-Pera und sein Team verwendeten flüssigen Stickstoff, um Hautzellen aus den Ohren des letzten Pyrenäensteinbocks einzufrieren, als dieser starb. Später tauten sie die Probe auf, entfernten die DNA aus 208 Eizellen von Hausziegen und ersetzten sie durch DNA aus den Probenzellen. Diese Eizellen werden dann in die Gebärmutter von Leihmüttern übertragen. Bei der Leihmutter handelt es sich um eine weitere Unterart der Spanischen Ziege, einer Kreuzung aus Bergziege und Wildziege. Obwohl die Chancen auf eine Empfängnis gering waren und nur sieben Ziegen trächtig wurden, wurde schließlich eine Pyrenäenziege geboren. Das Licht des Sieges ist vergänglich. Die per Kaiserschnitt geborene Pyrenäenziege starb nur etwa sieben Minuten später an Atemproblemen. Eine Autopsie ergab, dass das Lamm anomale Lungen hatte, andere Organe jedoch normal erschienen. Nun ist es dieser Art vielleicht zum ersten Mal gelungen, zwei Artenaussterben zu überleben. Die Wiederbelebung schlug fehl, doch Wissenschaftler bestätigten eine einfache Hypothese: Gefrorene Zellen eines ausgestorbenen Tieres könnten dazu verwendet werden, diese Art wiederzubeleben. „Unsere derzeitige Arbeit fördert unter anderem die Einlagerung von Gewebe und Zellen aller gefährdeten oder anderweitig gefährdeten Arten, da diese für künftige Artenschutzbemühungen auf Grundlage des Klonens von großem Nutzen sein könnten“, schrieb Folch-Pera 2009 in einem Artikel über das Klonen. Im Jahr 2019 veröffentlichten die Vereinten Nationen einen Bericht, in dem es hieß, dass in den nächsten Jahrzehnten eine Million Tier- und Pflanzenarten verschwinden werden. Viele Arten, darunter das Spitzmaulnashorn, der Sumatra-Orang-Utan und der Sunda-Tiger, sind in die Spirale des Aussterbens geraten: Wenn nur noch sehr wenige Individuen übrig sind, ist die Vielfalt des Genpools extrem begrenzt und es kann nur ein hohes Maß an Inzucht selektiert werden. Diese Arten haben geringere Überlebensraten und es besteht eine größere Wahrscheinlichkeit, dass sie allmählich aussterben. Eine der wenigen Möglichkeiten, diese Aussterbespirale zu durchbrechen, besteht darin, DNA in den Genpool einzuführen, die schon lange verloren ist – DNA von Vorfahren, die schon lange gestorben sind. Christina Hvilsom ist Naturschutzgenetikerin im Kopenhagener Zoo und Mitglied der Expertengruppe für Naturschutzgenetik der European Association of Zoos and Aquariums. „Um den Rückgang bestehender Arten zu stoppen oder umzukehren, müssen wir eine Vielzahl von Instrumenten einsetzen. Biobanken sind eines davon“, sagte sie. Die extrahierten tierischen Zellproben werden zur Vorbereitung auf das Einfrieren in ein Lösungsmittel gegeben. © SEBASTIAN NEVOLS Mattson ist groß und geht zügig in Dreiviertel-Jogginghosen, selbst wenn er einen auffälligen Laborkittel trägt. Er sagte, er habe sich für eine künstliche Befruchtung entschieden, weil er „zur richtigen Zeit am richtigen Ort“ gewesen sei. Matson brach im Alter von 16 Jahren die Schule ab und stürzte sich in die Pferderennbranche, zunächst als Jockey. Anschließend musste er im Amateur-Springsport und in der Rennpferdezucht immer wieder Rückschläge hinnehmen, später kam es zum Unfalltod einer Stute, woraufhin er sich dem Geschäft der künstlichen Befruchtung zuwandte. Über 30 Jahre lang konzentrierte er sich auf die Pferdezucht und half später Menschen, die ihre geliebten Haustiere verloren hatten, ihre Haustiere zu klonen. Dann, im Jahr 2018, nachdem er an einer Konferenz in den USA teilgenommen und eine Partnerschaft mit dem Klonunternehmen Viagen geschlossen hatte, die den Versand von gefrorenem Gewebe aus Europa erleichterte, hatte er andere Ideen. „Ich dachte: Wenn ich Katzen, Hunde und Pferde wiederbeleben kann, warum kann ich dann nicht dabei helfen, seltene Arten wiederzubeleben?“ Er sagte, als er sich mit seiner Idee zum ersten Mal an den Chester Zoo wandte, sei er zwar „nicht aus der Tür geworfen“ worden, aber an der Idee, Tiere zum Zwecke des Artenschutzes zu klonen, sei man nicht interessiert gewesen. „Sie sagten nein, es sei wie ein Frankenstein-Job, man müsse sich der Grenzen bewusst sein, die man nicht überschreiten dürfe. Aber jetzt ist es völlig anders.“ Sue Walker ist wissenschaftliche Leiterin im Chester Zoo und Mitbegründerin von Nature's Vault. In der Vergangenheit, sagte er, wollten Zoos nichts mit dem Klonen zu tun haben. Das Klonen eines einzelnen Tieres ist sehr teuer und weist eine hohe Fehlerquote auf. Außerdem besteht die Gefahr, dass die geklonten Tiere übermäßigem Stress ausgesetzt sind oder jung sterben. Es wäre weitaus besser, sich auf die Rettung von Arten zu konzentrieren, die sich in einer Aussterbespirale befinden, indem man die Populationen stärkt und Lebensräume schützt. Doch die Zeit läuft uns davon und die Überlebenschancen einiger Arten werden immer geringer. In extremen Fällen können künstliche Befruchtung und Klonen die beste oder letzte Option sein. An einem kalten Märzmorgen zeigt mir Mattson seine Farm in Whitchurch, Shropshire. Im ersten Stock des Hauptgebäudes stehen Gefrierfässer, in denen Zellproben gelagert werden. Die kleinere sieht aus wie eine Milchkanne und die beiden größeren ähneln riesigen Färbebottichen. Mattson ging die Stufen hinauf und öffnete einen Eimer. Als der Wasserdampf abkühlte, stieg weißer Nebel heraus. Im Inneren befinden sich speziell gestaltete Fächer mit Tausenden winziger Reagenzgläser in Form von Cocktail-Strohhalmen, die jeweils die DNA eines Rennpferds enthalten. Er zeigte auf einen großen Kryotank und sagte: „Das ist flüssiger Stickstoff, ich glaube, er hat -196 Grad Celsius. Er hält alles am Leben.“ Um die Zellen zu konservieren, mischte Mattsons Team die Zellen mit einem Kryoprotektivum, das physiologisches Gewebe vor Erfrierungen schützt. Mit Mattsons Worten: Es ist Frostschutzmittel. Im vergangenen Jahr exportierte sein Unternehmen Tiersamen im Wert von etwa 60.000 Pfund in 21 Länder. Im nächsten Raum steht ein spezieller Lagertank für flüssigen Stickstoff: ein gelbes Fass von der Größe eines Barhockers, das derzeit weit weniger Proben fasst als die Pferdesamentanks. „Wir brauchen definitiv mehr Platz“, sagte Mattson. „Wir befinden uns in einem echten Wettlauf gegen die Zeit. Theoretisch benötigen wir 50 verschiedene Proben jeder Art, um der Nachfrage gerecht zu werden.“ Das Sammeln von mindestens 50 Proben würde den Wissenschaftlern genügend genetische Vielfalt bieten, um sinnvolle Veränderungen für gefährdete Arten vorzunehmen. Wenn Sie mehrere Tiere aus derselben Probe klonen, wären sie genetisch identisch, was die Anzahl der Arten, die sich selbstständig fortpflanzen können, nicht erhöhen würde. Nach der Besichtigung des Labors sagte Mattson, er wolle mir die „Einnahmequelle“ zeigen. Er führte mich zu einem großen überdachten Platz. Das Ding auf der rechten Seite sieht aus wie ein großes, quadratisches Gewölbe, das schräg geneigt ist. Hinten waren zwei Ställe: einer mit einer eher ruhigen schwarzen Stute, der andere leer. Durch die Scheunentür auf der anderen Seite entdeckte ich den stellvertretenden Platzwart Josh Steer und die Hengstpflegerinnen Teresa Hayley und Emily Coombes mit einem Fuchshengst namens Clippy. Combs hielt etwas in der Hand, das wie ein riesiges braunes Gummikondom aussah. Der Begriff lautet „Pferdevagina“. Steele kontrolliert den Hengst, während Haley die folgende amüsante Szene kommentiert. „Er schwankt“, sagte Haley. Wir warteten schweigend, während aus der künstlichen Vagina Wasser auf den Betonboden tropfte. Die Szene hatte nicht viel Würde. Clippy wieherte und stampfte mit den Füßen. Haley sagte: „Denk darüber nach.“ Ihre Stimme hallte im kalten Wind wider: „Denk darüber nach“, eine kurze Pause, „Denk darüber nach.“ „Das ist die Phase des Kennenlernens“, scherzte Mattson. „Sie treffen sich gerade zum ersten Mal, also brauchen sie vielleicht zuerst ein paar Drinks.“ Als Clippy sich dazu entschloss, seinen nächsten Schritt vor aller Augen zu tun, handelten alle schnell. Kämme reinigten den Penis des Pferdes mit einem Tuch und einem Eimer, um eine Verunreinigung der Probe durch Bakterien zu verhindern. Dann führen sie es zum künstlichen Pferd, setzen die künstliche Vagina ein und nach ein paar Stößen ist die Sache erledigt. Es ist vielleicht nicht sehr respektabel, aber diese eher grobe Form der Überredung ist die sicherste Methode, um an Sperma zu gelangen, das dann an Leute verkauft werden kann, die Hochleistungsrennpferde haben möchten. Verglichen mit dem, was mit Elefanten in Südafrika geschieht, wo es manchmal die einzige Möglichkeit ist, genetisches Material von Organismen in der Wildnis zu erhalten, ist dies zumindest etwas zivilisierter. Es sei ein ziemlich seltsamer Job, gibt Steele zu. Mattson im Nature Vault-Labor. Die meisten Proben in den Tanks von Nature’s Vault wurden von Menschen aufbewahrt, die Mattsons Team nie persönlich gesehen hatten – sie starben, bevor sie Mattsons Labor erreichten. Die bei Pferden oder Elefanten angewandte Methode der Spermiengewinnung kann nicht bei allen Tieren angewendet werden: beispielsweise bei der Thailändischen Schweinsnasenfledermaus, die mit etwa 3 cm Länge das kleinste Säugetier der Welt ist; und der Antarktische Blauwal, der etwa 180 Tonnen wiegt. Was tatkräftige Naturschützer davon abhält, den Genpool bedrohter Arten zu erweitern, sind nicht nur organisatorische Probleme, sondern auch sehr unterschiedliche Regeln und Vorschriften. So verbietet beispielsweise der Ethikkodex des Royal Veterinary College Tierärzten die Entnahme von DNA-Proben von gefährdeten Tieren in Gefangenschaft oder nach dem Tod der Tiere, außer aus legitimen Gründen, etwa für medizinische Untersuchungen. Nachdem die Tiere gestorben sind, schickt Chester Park ihre Proben zur sofortigen Lagerung in Tanks mit flüssigem Stickstoff an Mattsons Team 40 Kilometer südlich. „Man kann sich einen Krankenwagen vorstellen, der mit heulenden Sirenen über die Schnellstraße rast“, sagte Walker. „Es ist viel weniger dramatisch als das.“ Sterbende Tiere werden von Zoozoologen betreut, die sich täglich mit Fragen der Tiergesundheit auseinandersetzen. Anschließend führen sie einen normalen chirurgischen Eingriff durch und entnehmen den Hoden oder Eierstock zusammen mit einer Gewebeprobe. Dann würden sie Matteson und sein Team anrufen, um die Proben abzuholen. Deshalb liegt auf einer Bank auf Mattesons Farm ein winziges schwarzes Ding, das wie ein Ohr aussieht, und zwei Fledermaushoden von der Größe von Olivenkernen. Die Kurzschwanz-Blattnasenfledermäuse des Chester Zoos leben normalerweise im „Flughundwald“ und Besucher können sie im Rahmen des 56 £ teuren „Erlebnisses“ füttern. Obwohl diese Fledermausart derzeit nicht als gefährdet gilt, ist kein Tier völlig sicher, da die Artenvielfalt weltweit kritische Punkte erreicht hat. Der Besitzer dieses Hodenpaares stirbt eines natürlichen Todes, seine Gene werden jedoch weitergegeben. Das erste, was Lucy Morgan, wissenschaftliche Beraterin von Nature’s Vault, tat, war, die Ohren zu rasieren. „Das Ohr bleibt in gewisser Weise ein Leben lang bestehen und die Zellen im Ohr werden ständig regeneriert“, sagte sie. „Wenn Sie also eine Probe auswählen möchten, die Sie in Zukunft kultivieren möchten, ist das Ohr eine hervorragende Lösung.“ Sie legte das Ohr zur Desinfektion in eine Chlorhexidinlösung und stoppte die Zeit. Zwei Minuten später legte sie das Ohr in eine Petrischale und schnitt es in Stücke von der Größe von Schokoladenstückchen. Mithilfe einer Pinzette legte sie sie in ein Kryoröhrchen mit flüssigem Stickstoff. Die beiden kleinen Hoden bleiben unversehrt erhalten. Eine Spermagewinnung erfolgt nicht, da bei zu kleinen Tieren eine Konservierung mit herkömmlichen Methoden meist nicht möglich ist. Gewebe, Hoden oder Eierstöcke von Tieren werden sicher in Kryoröhrchen oder Strohhalme pipettiert und in Gefrierschränken aufbewahrt, um sie später für die Verwendung in Zoos oder Wildtierzuchtprogrammen aufzutauen. Bei Tieren, deren anatomische Merkmale eine künstliche Befruchtung mit Sperma oder Eizellen unmöglich machen, können Proben über Jahrzehnte aufbewahrt werden. Derzeit werden alle Proben von Nature’s Vault an einem Ort aufbewahrt, das Unternehmen plant jedoch, eine Zweigstelle einzurichten, damit die Gewebe an verschiedenen Standorten aufbewahrt werden können, um die Lagerungsrisiken zu verringern. In flüssigem Stickstoff eingefrorene und in Strohhalmen aufbewahrte Samenproben. Mattsons Plan scheint ehrgeizig, aber er ist nicht beispiellos. 8.000 Kilometer entfernt betreibt der San Diego Zoo in Kalifornien seit den 1970er Jahren ein Biobankprojekt und bewahrt mehr als 10.000 Proben lebender Zellen, Keimzellen und Embryonen auf. Die als „Frozen Zoo“ bekannte Sammlung hat Küken mehrerer Fasanenarten hervorgebracht und konnte beobachten, wie gefrorene Eizellen (Zellen, die Eier bilden) von Katzen nach einer künstlichen Befruchtung zu Embryonen im Spätstadium heranreiften. Im Jahr 2020 gelang Naturschützern in San Diego ein weiterer großer Erfolg: Sie konnten erfolgreich ein Schwarzfußiltis klonen, indem sie Proben eines seit 30 Jahren toten Tieres verwendeten. Das anmutige Frettchen, das von Forschern Elizabeth Ann genannt wurde, wurde am 10. Dezember in einem Forschungsinstitut in Colorado geboren und sieht genauso aus wie Willa, ein Frettchen, das 1988 starb. In den 1980er Jahren galt die Art als gefährdet, aber ein Zuchtprogramm hat dazu beigetragen, die Population auf 6.000 zu erhöhen. Das Problem besteht jedoch darin, dass lebende Schneefrettchen sehr eng miteinander verwandt sind. Ryan Phelan, Geschäftsführer von Revive & Restore, einer gemeinnützigen Organisation, die sich auf das Klonen spezialisiert hat, sagte: „Fortschrittliche Reproduktionstechnologien wie das Klonen ermöglichen es uns, Tierpopulationen zu retten und einen Teil der Vielfalt wiederherzustellen, die sonst mit der Zeit verloren gehen würde.“ Es gibt auch gleichgesinnte Projekte wie die Gewebeprobenbibliothek für die akademische Forschung. Sie versuchen, möglichst viele Exemplare zu sammeln – nicht, um die Tierpopulationen wiederherzustellen, sondern in erster Linie für die zukünftige Forschung. Ihre Arbeit ist pragmatisch: Wenn wir die Tiere nicht retten können, haben wir zumindest genügend Material zum Untersuchen, bevor sie verschwinden. Zu solchen Probensammlungen gehört die Ambrose Monell Cryo Collection, die dem American Museum of Natural History angeschlossen ist. Das Kryo-Gewebelabor des American Museum of Natural History kann bis zu 1 Million Exemplare konservieren und lagert derzeit Exemplare wie Schmetterlinge, Froschfüße, Walhaut und Krokodilhaut in Tanks mit flüssigem Stickstoff. Auch in Großbritannien gibt es eine ähnliche Probenbank – CryoArks, die erste nationale Tierbiobank Großbritanniens für genetische und genomische Forschung an Tierarten. Die „Cryoark“ verfügt über drei kryogene Basen: eine im Natural History Museum in Großbritannien, eine im National Museum of Scotland und eine im Edinburgh Zoological Gardens. Zwei weitere Biobanken, die European Association of Zoos and Aquariums und FrozenArk, arbeiten ebenfalls zusammen. „Das bedeutet, dass wir nicht in die Wildnis gehen und Tierproben sammeln müssen“, sagte Michael Bruford, leitender Forscher und Direktor von CryoArk. Das hat viele Vorteile, nicht nur die geringere Beeinträchtigung, sondern auch die logistische Vereinfachung. Tatsächlich repräsentieren die Proben, die wir haben, jedoch zu viele ausgestorbene Arten. Sie existieren nicht mehr. Glücklicherweise wurde die riesige Probenbibliothek der „Frozen Ark“ früher angelegt als die des San Diego Zoos und der „Nature’s Vault“. Dadurch haben die Menschen mehr Möglichkeiten, früher ausgestorbene Tiere zu studieren und wertvolle Informationen über Ökosysteme und längst verloren geglaubte Lebensräume zu gewinnen. Wilsom sagte, Nature’s Vault gehe über die bloße Extraktion von DNA für die Veterinärmedizin oder Forschung hinaus, sondern „bringe es auf die nächste Ebene“ und konzentriere sich auf Zelllinien und Keimzellen für die künstliche Reproduktion. Ihre Arbeit verleiht Biobanken eine deutlich größere Bedeutung. Derzeit und in den nächsten Jahren werden diese Zelllinien in pluripotente Stammzellen (Zellen, aus denen sich jede Art von Zelle oder Gewebe entwickeln kann) umgewandelt, die sich dann in Keimzellen differenzieren können, sodass die Schaffung neuer Tiere möglich ist. Bradley betonte, dass nicht nur sichergestellt werden müsse, dass das gespeicherte genetische Material von mehr als nur einigen wenigen in Gefangenschaft lebenden Tieren stamme, sondern auch, dass im Genpool eine ausreichende Vielfalt vorhanden sei. „Wenn wir Kryonik-Einrichtungen weltweit einbeziehen, verfügen sie über die Kapazität, Millionen von Proben zu lagern. Die Frage ist jedoch nicht, wie viele Proben wir lagern können, sondern woher sie kommen und ob wir sie richtig nutzen können“, sagte er. „In gewisser Weise ist dies die Rolle der Kryonik, da Forscher und Naturschützer sehen können, welche Proben verfügbar sind, und die beste Strategie auswählen können.“ Doch es gibt noch immer Lücken in den gesammelten Proben, die Brared als „Fehler der Vergangenheit“ bezeichnet. Weniger liebenswerte und ästhetisch weniger ansprechende Tiere werden oft aus Sammlungen ausgeschlossen, weil sie in Vergessenheit geraten oder ihre Erhaltung schwieriger ist. In den meisten dieser Lücken leben wirbellose Tiere, beispielsweise Regenwürmer. „Ob sie nun die charismatischsten Tiere der Erde sind oder nicht, aufgrund ihrer Beiträge sind sie die wichtigsten Wesen in ihren Ökosystemen“, sagte er. „Dennoch gibt es kaum biologische Proben von ihnen.“ Dies ist ein geklontes Pferd, dessen Zellen von einem 2008 verstorbenen Rennpferd stammen. © SEBASTIAN NEVOLSAT Zu Beginn eines der „Jurassic Park“-Filme, bevor die Dinosaurier anfangen, Menschen zu fressen, kritisiert Dr. Ian Malcolm (Jeff Goldblum) in einer Lederjacke den berühmten Freizeitparkbesitzer John Hammond (Sir Richard Attenborough) für seine Ethik: „Ihr Wissenschaftler seid besessen davon, ob ihr es schaffen könnt. Sie denken nicht darüber nach, ob ihr es tun solltet.“ Dies ist ein sehr wichtiger Punkt. Wenn wir Lebewesen zurückbringen können, die seit Jahrzehnten verschwunden sind, dann ist es auch sinnvoll, Lebewesen zurückzubringen, die vor Hunderten von Jahren ausgestorben sind, wie Säbelzahntiger, Dodos, Wollmammuts und sogar Tyrannosaurus Rex. Dem japanischen Genetiker Teruhiko Wakayama gelang es, mithilfe von 16 Jahre lang eingefrorenen Mauszellen neue Zellen zu klonen. Dies gibt mehr Hoffnung auf die Wiederbelebung längst ausgestorbener Arten. Doch die Wiederbelebung des Mammuts und des Dodos wird nicht einfach sein. Obwohl ihre Körper eingefroren sind, zersetzt sich ihre DNA mit der Zeit, sodass uns nicht genügend genetische Informationen zur Verfügung stehen, um gesunde neue Individuen wiederzubeleben. © The Economic Times Im vergangenen Jahr veröffentlichten Wissenschaftler jedoch ein nahezu vollständiges Genom des Wollhaarmammuts, obwohl das Tier seit etwa 10.000 Jahren ausgestorben ist. Dies führte zu Spekulationen darüber, dass es möglich sein könnte, Mammut-DNA künstlich zu synthetisieren. Im März 2021 gründete das Forschungsteam, das das oben erwähnte Schwarzfußiltiß geklont hatte, die Woolly Mammoth Revival Fellowship im Labor von George Church, einem berühmten Genetiker der Harvard Medical School, um die Wissenschaft der Wiederbelebung von Mammuts zu erforschen. In einem Telefongespräch im März fragte ich Church nach den ethischen Dilemmata der Wiederbelebung ausgestorbener Tiere. Warum ausgestorbene Tiere klonen, anstatt Arten zu retten, die noch nicht ausgestorben sind? „Normalerweise ist es keine Entweder-oder-Entscheidung“, antwortet er. Es gibt Arten, die in freier Wildbahn und in Zoos [oder in Gefangenschaft] ausgestorben sind. Man muss das einfach ein wenig zurückdrängen, damit sie in der Wildnis erfolgreich sein können. Als Beispiel nennt er den Bison, eine Art, die im 19. Jahrhundert vom Aussterben bedroht war, sich heute aber auf etwa 12.000 Exemplare erholt hat. „Deshalb denke ich, dass unser Fokus wirklich darauf liegen sollte, die Vielfalt der bestehenden Arten zu erhöhen.“ Das Wollmammutprojekt von Church zielt nicht darauf ab, ausgestorbene Arten wiederzubeleben. Er erklärte: „Ziel ist es, die Vielfalt ausgestorbener Arten den modernen Arten zurückzugeben, um den bestehenden Arten und den Ökosystemen, in denen sie vorkommen, zu helfen.“ Durch die Bearbeitung von Oligonukleotiden (unabhängig synthetisierte einzelsträngige DNA-Sequenzen mit 40 bis 350 Basen), die mit bestimmten Merkmalen in Zusammenhang stehen, und das Einfügen von DNA des alten Wollmammuts in das Genom des asiatischen Elefanten plant Church, mithilfe der CRISPR-Genbearbeitungstechnologie einen Elefanten zu erschaffen, der kälteresistent und virenresistent ist und dessen Stoßzähne auch vor Raubtieren schützen können. „Ich kenne wirklich kein Projekt, das sich ausschließlich der Wiederbelebung ausgestorbener Arten widmet und nicht gleichzeitig an der Verbesserung der Vielfalt moderner Arten arbeitet“, sagt er. Er muss nicht nur gegen die Zeit antreten, um die DNA gefährdeter Tiere zu erhalten, sondern auch dafür sorgen, dass die Vielfalt direkt in die Gene der Tiere eingearbeitet wird. Die meisten der heute existierenden gefrorenen Elefantenzellen seien beispielsweise im vergangenen Jahrzehnt gesammelt worden, sagte er. Sie könnten jedoch auch als Grundlage für das Einfügen alter DNA dienen und so eine genauere DNA-Sequenz der Vorfahren der Art liefern. „Bislang liegt unser Rekord für die größte Zahl von Gen-Editierungen bei einem einzelnen lebenden Tier bei 42, und zwar bei einem Schwein namens ‚Version 3.0‘“, sagte Church. Dies ist zwar kein großer Unterschied zwischen den Arten, reicht aber aus, um deutlich erkennbare Variationen in der Expression bestimmter Schlüsselgene hervorzurufen. Wenn Wissenschaftler nicht über genügend Tierproben gefährdeter Arten verfügen, könnte diese Editiertechnologie dazu beitragen, die Lücken in den genetischen Informationen zu schließen und möglicherweise Millionen von Arten zu wesentlich geringeren Kosten wiederzubeleben. Tatsächlich könne man die wiederbelebten Arten vielfältiger und gesünder machen, sagte Church. „Es könnte Vielfalt aus verschiedenen Orten und aus verschiedenen Zeiten geben. Man könnte zwei Tiere zurückbringen, die nie gleichzeitig existiert hätten, die an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten gelebt und sich nie begegnet wären. Das ist eine interessante Möglichkeit.“ Church ist nicht der Ansicht, dass Wissenschaftlern das Überschreiten einer Grenze unbedingt untersagt werden sollte, warnt jedoch davor, dass bei der Freilassung jeglicher Art in die freie Wildbahn große Vorsicht geboten sei. Er erwähnte Ziegen, die in das Ökosystem der Galapagosinseln eindrangen und die Vegetation fraßen, wodurch Bodenerosion verursacht, das Überleben seltener Pflanzen bedroht und das Leben einheimischer Tiere wie Riesenschildkröten beeinträchtigt wurde. Die Ziegen mussten entfernt werden. Wielsom ist der Ansicht, dass sich das Klonen zum Zwecke des Artenschutzes stark vom Klonen zur Wiederbelebung längst ausgestorbener Arten unterscheidet. „Für mich ist es zumindest ein schmaler Grat zwischen dem Beitrag zur Erhöhung der Population einer gefährdeten Art und dem Versuch, etwas wiederzubeleben, das längst ausgestorben ist, wie etwa das Wollhaarmammut“, sagte sie. Sie ist davon überzeugt, dass wir Lebensräume wiederherstellen können – und sollten –, um die durch menschliche Aktivitäten verursachten Schäden zu beheben. Sie ist der Ansicht, dass Klonen nur dann zum Einsatz kommen sollte, wenn wir keine andere Wahl haben. Mattson, der in Shropshire, England lebt, vertritt eine ähnliche Ansicht. „Ich mache mir Sorgen, dass die Leute von Dingen wie Jurassic Park besessen werden und die ursprüngliche Absicht vergessen, die noch lebenden Tiere retten zu wollen“, sagte er. „Heute gehen die Ambitionen der Menschen darüber hinaus.“ Nature Vault befolgt die strengen ethischen Prozesse des Zoos und hat eine Absichtserklärung unterzeichnet, um sicherzustellen, dass alle Partner informiert sind. Alle Proben im Nature Vault gehören dem Zoo, der über deren Verwendung in Artenschutz- oder Zuchtprojekten entscheidet. Die einzigen Proben, die der Zoo auftauen kann, werden für Routinetests verwendet, um zu prüfen, ob die Lagerbedingungen angemessen sind. Heute werden keine der gespeicherten Proben mehr in laufenden Projekten verwendet. Bei unserem Rundgang über die Farm stoppten wir auf einer großen Koppel und Mattson deutete auf ein weißes Pferd namens Mulka Jewel, das 2011 geboren wurde und ein Klon von Jewel Twist war, einem berühmten Springpferd, das 2008 starb. Wir sahen zu, wie das Pferd auf und ab ging und Gras fraß, und schließlich bemerkte es uns und rannte davon. „Interessant ist, dass dieses Pferd Zelle für Zelle genau dasselbe ist, aber fünf Zentimeter kleiner“, sagte Mattson. Vielleicht war die Stute, die das ursprüngliche Pferd zur Welt brachte, größer oder hatte eine längere Tragzeit. Zwanzig Jahre nach dem Klonen der Pyrenäenziege und 25 Jahre nach dem Klonen des Schafs Dolly ist das Gebiet der Genetik noch immer in Geheimnisse gehüllt. Von Natasha Bernal Übersetzt von Yord Korrektor/Apotheker Originalartikel/www.wired.co.uk/article/natures-safe Dieser Artikel basiert auf der Creative Commons License (BY-NC) und wird von Yord auf Leviathan veröffentlicht Der Artikel spiegelt nur die Ansichten des Autors wider und stellt nicht unbedingt die Position von Leviathan dar |
<<: Dieses ohrenbetäubende Verhalten legen wir wahrscheinlich täglich an den Tag!
>>: 16 Käsesticks für Kinder im Test: Hoher Zucker- und Fettgehalt, nicht zum Verzehr empfohlen
Artikel empfehlen
【Theorie】Liu Xiqing: Die Beziehung zwischen Malerei und Wissenschaft
Es wird allgemein angenommen, dass die europäisch...
Wie sollten Männer mittleren Alters trainieren?
In der Gesellschaft stellen Männer mittleren Alte...
Ist das Internet eine Katastrophe für die Filmindustrie?
„Das Internet könnte der traditionellen Filmindus...
Ich hatte das Gefühl, meine Sicht sei verzerrt und der Raum verdreht. Der Arzt sagte, ich sei in Alice im Wunderland hineingestolpert.
Standbild aus Svankmajers Alice (Něco z Alenky, 1...
Was sind die Vor- und Nachteile von Bauchmuskelübungen?
Wir alle wissen, dass ein gesunder Körper das Wic...
Apple MacBook Pro hat ein neues Problem: Die Tastatur funktioniert nicht
Der Marktanteil der Mac-Serie ist rückläufig. Appl...
Weijing-CEO Li Huaiyu: VR ist definitiv der nächste Billionen-Dollar-Trend
Artikelquelle: Internet Hotspot Einleitung: Der A...
Ist es in Ordnung, wenn ein Fünfjähriger Fechten lernt?
Fechten ist ein international anerkannter Wettkam...
Die Sterblichkeitsrate durch Tollwut beträgt 100 %? Darf man noch Hunde halten?
Dieser Artikel wurde zuerst von „Hunzhi Health“ (...
Mein Gesicht ist nach der Anwendung dieser „Bleaching-Methoden“ verdorben! Die richtige Haltung beim Aufhellen ist wie folgt →
Mit der Entwicklung der Zeit Heutzutage wird die ...
Die klassische TV-Version von "Tank War 2014" wird auf der großen Leinwand wiedergegeben
. Bildschirm: Soundeffekte: arbeiten: Handlung: E...
Der neue Landwind Xiaoyao hat ein ausgereiftes und jugendliches Design und kostet zwischen 79.900 und 131.900 RMB.
Am Abend des 4. Januar wird Landwinds neuer Kompa...
Ist es gesund, immer Vegetarier zu sein? Falsch! Sie bekommen außerdem eine Fettleber!
Experte dieses Artikels: Huang Jia, Doktor der Me...
Was sind die Vorteile des Yoga-Kopfstands?
Das Praktizieren von Yoga ist eine sehr gute Mögl...
Wie schlimm sind tote Winkel bei Fahrzeugen? Der Fahrer hat keines der 75 Kinder gesehen!
Wie gut wissen Sie über den toten Winkel von Fahr...