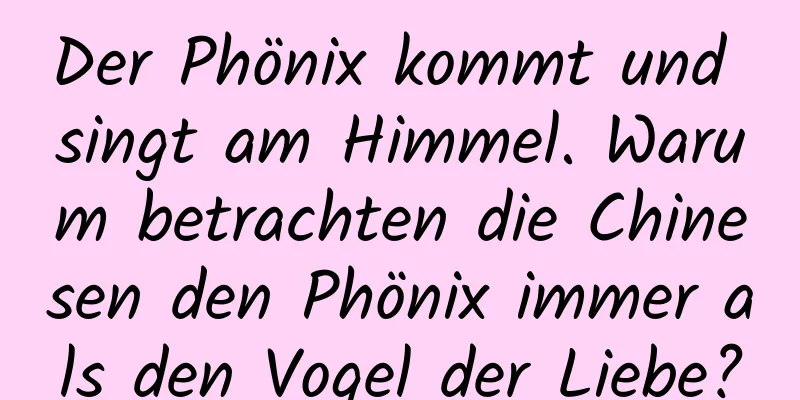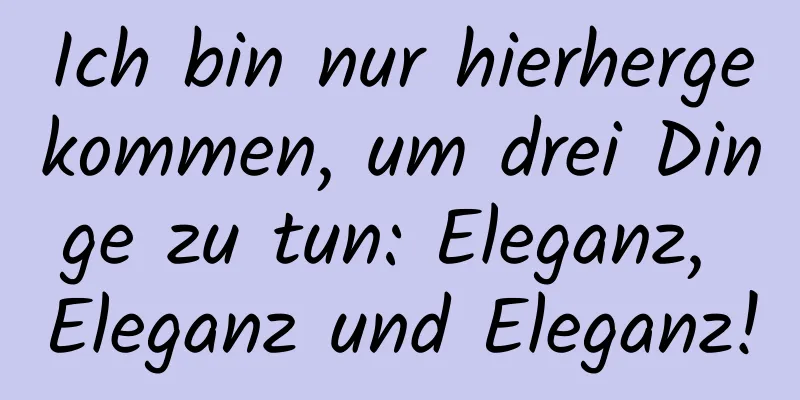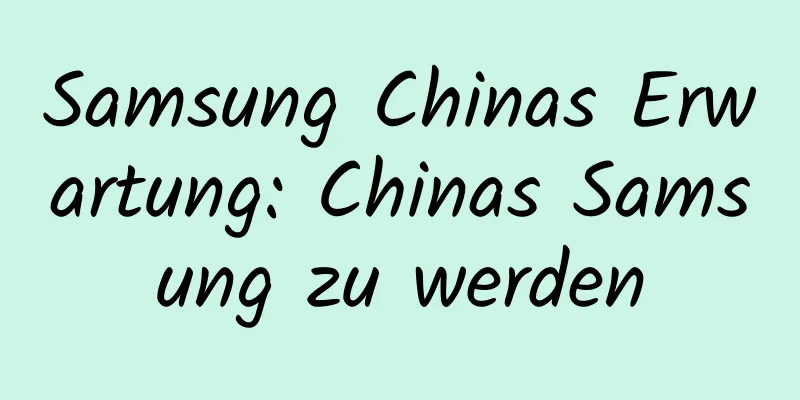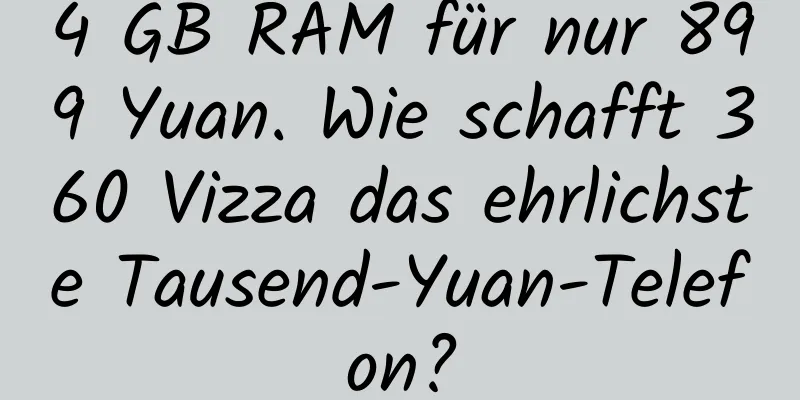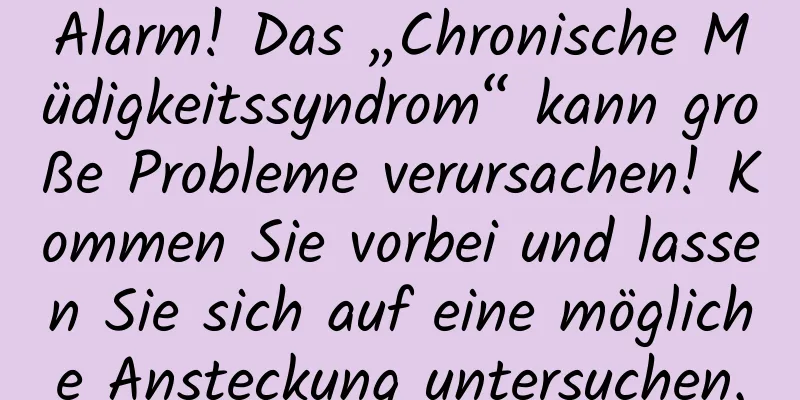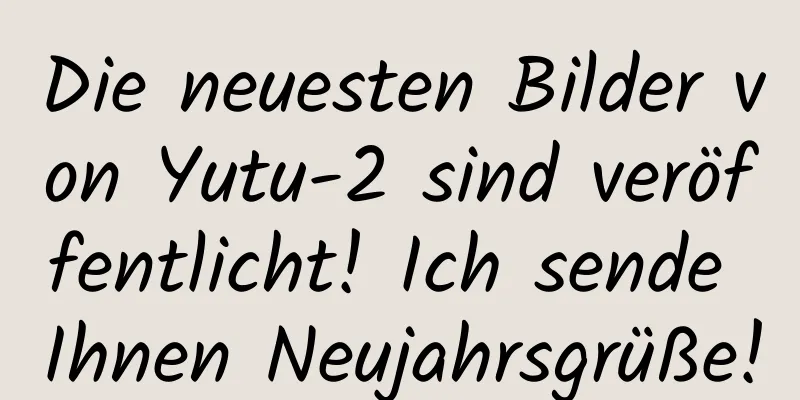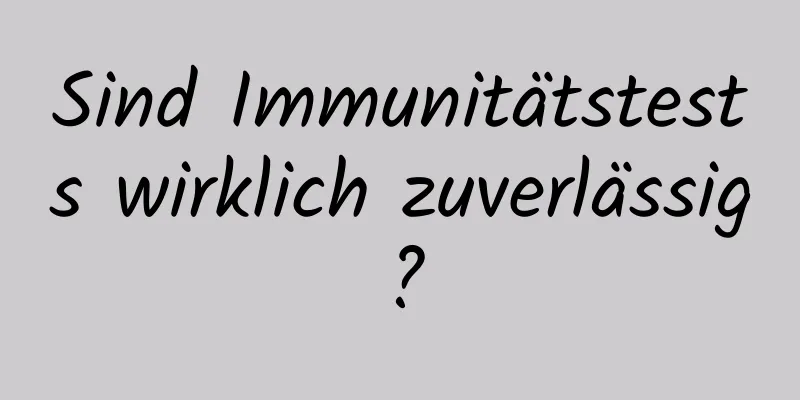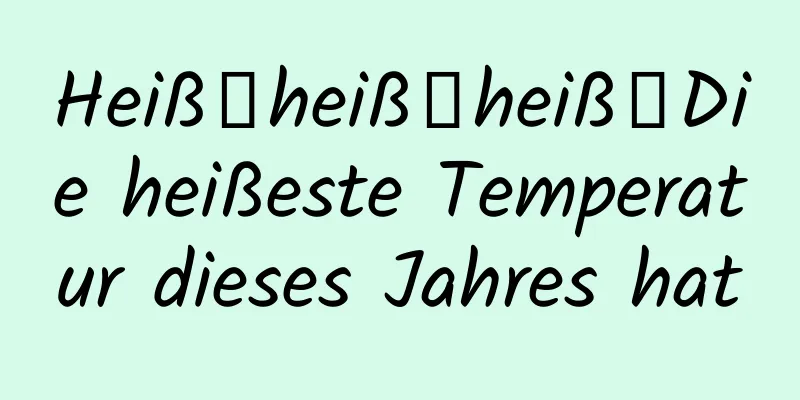Die faszinierende Geschichte der Meerjungfrauen
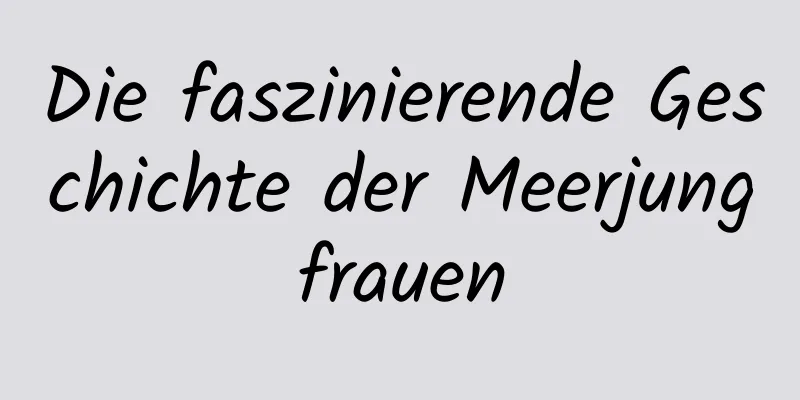
|
Leviathan Press: Glauben Sie immer noch an mysteriöse Kreaturen? Meerjungfrauen, Einhörner, Drachen … die Existenz all dieser Kreaturen war einst „offiziell bestätigt“, heute werden sie jedoch als Fantasie eingestuft. Teilweise lagen die Gründe darin, dass die Theorie unwissenschaftlich war (wie konnte ein Drache ohne Flügel in den Wolken fliegen), und teilweise darin, dass es plausiblere Erklärungen gab (die Sichtungen von Meerjungfrauen wurden als Ausnahme vom Vorkommen wilder Dugongs angesehen). Wir akzeptieren die Wissenschaft, verlieren aber nicht unsere romantischen Fantasien – schließlich sind Fantasien nur dann am attraktivsten, wenn sie noch immer verzaubert sind. „Meerjungfrauen wurden in den Jahren 1758, 1775 und 1795 erfolgreich ausgestellt“, handilluminierte Lithografie von John Paas, 1817. © loc.gov Am 6. Mai 1736 informierte der gelehrte Benjamin Franklin seine Leser in der Pennsylvania Gazette über die kürzliche Sichtung eines „Seeungeheuers“ auf den Bermudas, „dessen Oberkörper die Form eines etwa zwölfjährigen Jungen mit langem schwarzen Haar hatte und dessen Unterkörper die Form eines Fisches hatte“. Offenbar war die „Menschenähnlichkeit“ der Kreatur für ihre Entführer der Grund, sie am Leben zu lassen. Ein ähnlicher Bericht erschien 1769 in einer Ausgabe der Providence Gazette. Darin hieß es, dass die Besatzung eines britischen Schiffes vor der Küste von Brest in Frankreich ein „Seeungeheuer in Menschengestalt“ beobachtet habe, das um das Schiff herumschwamm und an einem Punkt „eine Zeit lang die schöne weibliche Gestalt auf unserem Bug beobachtete“. Der Kapitän, der Navigator und „die gesamte 32-köpfige Besatzung“ bestätigten den Vorfall. Für die Menschen im modernen Großbritannien sind die oben genannten Beispiele typische Zeitungsberichte. Die Tatsache, dass über diese Begegnungen zwischen Menschen und Seeungeheuern berichtet wird, sagt viel aus. Sogar kluge Leute wie Benjamin Franklin hielten die Geschichten über Sichtungen von Seeungeheuern und Meermännern für so plausibel und wahr, dass sie bereit waren, Zeit und Geld zu investieren, um sie in ihren weit verbreiteten Zeitungen abzudrucken. Auf diese Weise haben Drucker und Autoren eine kuriose Erzählung rund um diese fantastischen Kreaturen geschaffen. Wenn sich ein Londoner mit seiner Zeitung hinsetzt (vielleicht in einem Pub namens „The Mermaid“) und schon wieder eine Geschichte über die Sichtung einer Meerjungfrau oder eines Meeresgottes liest, könnte sein Misstrauen in Neugier umschlagen. Die Debatten der Philosophen dieser Zeit über Meerjungfrauen und Meeresgötter verdeutlichen ihre Bereitschaft, sich auf ihrer Suche nach dem Verständnis der menschlichen Ursprünge dem Wunderbaren zu stellen. Naturforscher haben eine große Bandbreite an Methoden verwendet, um diese seltsamen Hybriden kritisch zu untersuchen und zu argumentieren, dass die Menschheit aus dem Wasser stammt, indem sie betonten, dass es Wassermänner tatsächlich gibt. Auf ihren Reisen um die Welt behandelten die europäischen Philosophen den Meermann wie jedes andere Lebewesen, dem sie begegneten. Sie wandten eine Vielzahl von Theorien an – darunter Theorien über rassische, biologische, taxonomische und geografische Unterschiede –, um seinen Platz in der Natur zu verstehen und, im weiteren Sinne, den Platz der Menschheit darin zu definieren. „Es gab eine ‚seltsame und unerwartete Nymphe … 1784 im Golf von Stanchio gefangen‘ und 1795 in Spring Gardens, London, ausgestellt.“ © London Metropolitan Archives Diese Kombination aus westlicher Neugier und imperialer Expansion spiegelt sich gut in der kulturellen Bedeutung der Meermenschen wider. Wohlhabende Einzelpersonen und philosophische Gesellschaften finanzierten Expeditionen von Naturforschern, Botanikern und Kartografen in die Neue Welt in der Hoffnung, dass diese das Verständnis der Menschheit für die Welt und ihren Platz darin erweitern würden. Da immer mehr Studien über Meerjungfrauen und Meeresgöttinnen durchgeführt werden, zeigen Naturforscher eine wachsende Liebe zu diesen erstaunlichen Geschöpfen. Wichtig ist auch, dass die Studien zeigen, wie sich der Verlauf der wissenschaftlichen Forschung in den letzten zweihundert Jahren dramatisch verändert hat. Anstatt sich ausschließlich auf alte Texte und Hörensagen zu verlassen, nutzten die Naturforscher des 18. Jahrhunderts eine Vielzahl „moderner“ Ressourcen – globale Kommunikationsnetzwerke, Publikationsmöglichkeiten für Wissenschaftler, transatlantische Reisen, Tierpräparation und gelehrte Gesellschaften –, um Dinge, die viele für abwegig hielten, rational zu prüfen. Aus diesem Grund beschäftigen sich immer mehr Männer mit den geheimnisvollen Meerjungfrauen und wenden dabei bekannte und wirksame Forschungsmethoden an. Dabei setzen sie die sogenannte Logik der Aufklärung fort und vermeiden sie zugleich. Auf diese Weise komplizierten Philosophen des 18. Jahrhunderts wie Cotton Mather, Peter Collinson, Samuel Fallours, Carl Linnaeus und Hans Sloane unsere und die Vorstellungen ihrer Zeitgenossen von Wissenschaft, Natur und menschlicher Natur. Kurz gesagt: Während eines Großteils des 18. Jahrhunderts jagten die klügsten Köpfe der westlichen Welt Wassermännern rund um den Globus hinterher. Die Royal Society of London spielt in dieser Kampagne eine Schlüsselrolle, sowohl als Aufbewahrungsort als auch als Sponsor legitimer wissenschaftlicher Forschung. Sir Robert Sibbald war ein angesehener schottischer Arzt und Geograph, der den Wunsch der Gesellschaft nach bahnbrechender Forschung verstand. Am 29. November 1703 schrieb er an Sir Hans Sloane, den Präsidenten der Gesellschaft. Darin teilte er dem Londoner Gentleman mit, dass er und seine Kollegen die Situation der schottischen Amphibien dokumentiert hätten. Er fügte Kupferstichzeichnungen bei, in der Hoffnung, diese Bilder der Royal Society vorlegen zu können. Siebold war sich des großen Interesses der Gesellschaft an der neuesten Forschung bewusst und erzählte Sloane, dass er „an der Aufzeichnung und Zeichnung bestimmter Wasseramphibien und Hybridarten beteiligt war, bei letzteren handelt es sich um Meerjungfrauen oder Sirenen, die manchmal in unseren Meeren gesichtet wurden.“ Hier sehen wir zwei große Denker des 18. Jahrhunderts, die in einem intellektuellen Briefwechsel Meerjungfrauen erwähnen. Illustration: „Pesce Donna“ (Die Fischfrau), aus Giovanni Antonio Cavazzis Istorica de’tre regni Kongo, Matamba und Angola, 1687. © wikimedia Am 5. Juli 1716 schrieb Cotton Mather auch einen Brief an die Royal Society of London. Dies ist nicht überraschend, da der Bostoner Naturforscher oft detaillierte Berichte über seine wissenschaftlichen Entdeckungen verfasste. Allerdings ist der Betreff des Briefes etwas merkwürdig: Er trägt den Titel „Meeresgötter“ und zeigt, dass Mercer aufrichtig an die Existenz von Meermännern glaubte. Das Mitglied der Royal Society of London erklärte zunächst, dass er Meermänner bis vor Kurzem immer für ebenso imaginär gehalten habe wie „Zentauren oder Sphinxen“. Mather fand zahlreiche historische Berichte über Wassermenschen, von der Sichtung des „mumifizierten Körpers des Poseidon … in Tanagra“ durch den antiken Griechen Demostratus bis hin zu den Behauptungen Plinius des Älteren über die Existenz von Wassermenschen und Poseidon. Mather merkte jedoch an, dass er viele dieser alten Behauptungen für falsch halte, weil „die Lehren von Plinius dem Älteren in unserer Zeit keinen guten Ruf genießen“. Als Mather jedoch verstreute antike Aufzeichnungen von angesehenen europäischen Denkern wie Boaistuau und Bellonius las, wurden seine „Zweifel ... bis zu einem gewissen Grad zerstreut“ hinsichtlich der Existenz der Kreatur. Mather war jedoch nicht völlig überzeugt, zumindest nicht bis zum 22. Februar 1716, als „drei ehrliche und vertrauenswürdige Personen, die mit dem Schiff von Milford nach Brainford, Connecticut reisten“, Poseidon begegneten. Nachdem Mather die Neuigkeit mit eigenen Ohren gehört hatte, konnte er nur erklären: „Jetzt ist mein Vertrauen endgültig gewonnen. Ich muss glauben, dass Poseidon wirklich existiert.“ Als das Wesen der Gruppe entkam, „sahen sie seine ganze Gestalt, seinen Kopf, sein Gesicht, seinen Hals, seine Schultern, seine Arme, Ellbogen, seine Brust und seinen Rücken, alles in der Gestalt eines Menschen … aber der untere Teil war der eines Fisches und hatte die Farbe einer Makrele.“ Obwohl der „Meeresgott“ entkam, überzeugte er Mercer von der Existenz von Meerjungfrauen. Mather bestand darauf, dass seine Geschichten keine Fiktion seien, und versprach der Royal Society, dass er weiterhin über „alle neuen Ereignisse in der Natur“ berichten werde. Abbildung des „Martinique Triton“ aus The Universal Magazine of Knowledge and Pleasure, Band XXIX (1761). © Wellcome Collection Auch der berühmte Naturforscher Carl von Linné widmete sich dem Studium von Meerjungfrauen und Meeresgöttern. Nachdem Linnaeus im Jahr 1749 mehrere Zeitungsartikel über Meerjungfrauen-Sichtungen im schwedischen Nyköping gelesen hatte, schrieb er einen Brief an die Schwedische Akademie der Wissenschaften, in dem er sie drängte, eine Jagd zu organisieren, „um das Tier entweder lebend zu fangen oder den Kadaver zu fangen und in Alkohol einzulegen“. Linnaeus gab zu: „Die Wissenschaft hat keine eindeutige Antwort auf die Frage, ob die Existenz von Meerjungfrauen Fakt, Fiktion oder die Einbildung einiger Meeresfische ist.“ Seiner Meinung nach überwiegt jedoch der Nutzen der Meerjungfrauenjagd die Risiken, denn ein so seltenes Phänomen „wäre wahrscheinlich eine der größten Entdeckungen, die die Akademie der Wissenschaften machen könnte, und die ganze Welt wäre ihr dankbar.“ Vielleicht können diese Kreaturen die Ursprünge der Menschheit enthüllen? Für Linnaeus, der für seine taxonomischen Studien berühmt war, musste dieses uralte Rätsel gelöst werden. Auch der niederländische Künstler Samuel Fallours behauptete, in einer abgelegenen Gegend Meermänner entdeckt zu haben, und löste damit eine jahrzehntelange Debatte aus, die sich über Kontinente und Medien hinweg erstreckte. Von 1706 bis 1712 lebte Fallul in Ambon, Indonesien, und arbeitete als Assistent des Klerus der Niederländischen Ostindien-Kompanie. Während seines Dienstes auf einer der „Gewürzinseln“ schuf Fahlul zahlreiche Illustrationen der lokalen Flora und Fauna. Auf einem der Gemälde war zufällig eine Meerjungfrau oder Sirene abgebildet. Die von Falour gemalte „Sirene“ ähnelt stark dem klassischen Bild einer Meerjungfrau, mit langem meergrünem Haar, einem fröhlichen Gesicht, einem nackten Oberkörper und einem blaugrünen Schwanz von der Taille abwärts. Allerdings hat diese Meerjungfrau eine dunkle Haut (leicht grünlich), was bedeutet, dass sie Ähnlichkeiten mit den einheimischen Aborigines aufweist. In den Begleitnotizen zu Fahluls Originalgemälde behauptete der niederländische Künstler, er habe „diese Sirene vier Tage lang in einem Wassertank in meinem Haus in Ambon am Leben erhalten“. Es wurde ihm von Faluls Sohn von der nahegelegenen Insel Buru gebracht, „der es von den Schwarzen für zwei Ellen Stoff gekauft hatte“ (Anmerkung des Übersetzers: Elle ist eine alte Längeneinheit für Stoff und entspricht etwa 115 cm). Schließlich wimmerte das Wesen und verhungerte, „es wollte nichts essen, weder Fisch noch Schalentiere, weder Moos noch Gras.“ Nachdem die Meerjungfrau gestorben war, wurde Fallul neugierig und hob die Flossen an der Vorder- und Rückseite ihres Körpers an und stellte fest, dass sie die Gestalt einer Frau hatte. Fallul behauptet, das Exemplar sei anschließend in die Niederlande transportiert worden, dort aber verloren gegangen. Die Geschichte dieser Ambon-Sirene hat jedoch gerade erst begonnen. Samuel Fallulls Aquarell „Die Sirenen“, um 1706–1712. © wikimedia Eine Kopie von Fallouls „Die Sirenen“ und der „Ecrevisse“ aus der zweiten Ausgabe von Louis Renards „Atlas der Fische, Garnelen und Krabben“ (1754). © wikimedia Louis Renard, ein in Frankreich geborener Buchhändler, der sich in Amsterdam niederließ, veröffentlichte sein Buch Poissons, ecrevisses et crabes (1719), dem auch eine Ausgabe von Fallours Die Sirenen beilag. Fallours Originalwerk war jedoch bereits mehrere Jahre zuvor weit verbreitet. Aufgrund der ungewöhnlich lebendigen Farben in Fahluls Gemälden und der ungewöhnlichen Kreaturen selbst zweifeln viele Menschen jedoch an ihrer Genauigkeit und Authentizität. Renard zeigte sich besonders besorgt über die Authentizität von Fallouls „Sirenen“-Gemälde und sagte: „Ich befürchte sogar, dass das Monster, das unter dem Namen einer Meerjungfrau gezeichnet wurde … korrigiert werden muss.“ In Fallouls Gemälden und in den Gesprächen, die Renard anschließend mit seinen Briefen anregte, fanden die Philosophen sowohl Hoffnung als auch Abscheu. Aernout Vosmaer, ein niederländischer Sammler und Leiter der Menagerie und des „Kabinetts für Natur und Kunst“ des Statthalters, schrieb das Vorwort zu Renards Ausgabe des Atlas der Fische und Krabben von 1754. Darin stellte er fest, dass die Einwände gegen die Realität des Meermanns „schwach“ seien, und behauptete, dass „dieses Monster – wenn wir es ein ‚Monster‘ nennen müssen (obwohl ich den Grund nicht verstehe)“ nur selten gesehen wurde, weil es menschlichen Fallen besser ausweichen konnte als andere Kreaturen (weil es ein Mischling des Menschen war). Darüber hinaus glaubt Washmal, dass Meermänner aufgrund ihrer biologischen Ähnlichkeit mit Menschen „anfälliger für die postmortale Verwesung sind als andere Fische“. Diese Schwierigkeit bei der Konservierung von Körpern erschwert nicht nur Sichtungen, sondern erklärt auch, warum vollständige Exemplare von Meerjungfrauen in antiken Sammlungen nur selten zu finden sind. Ab der Mitte des 18. Jahrhunderts glaubten immer mehr Ärzte nicht nur an die Existenz von Meermännern, sondern begannen auch, die Bedeutung dieser Kreaturen für unser Verständnis unserer Herkunft und Zukunft zu bedenken. G. Robinson schrieb in The Beauty of Nature and Art Displayed in a Tour Through The World (1764): „Obwohl die allgemeine Meinung der Naturhistoriker ist, dass Meermänner Tiere aus Legenden sind, … scheint es angesichts der Anzahl der Autoren, die Beweise für die Realität solcher Kreaturen hinterlassen haben, viele Gründe zu geben, an ihre Existenz zu glauben.“ Vier Jahre später präzisierte Reverend Thomas Smith Robinsons Argumentation und erklärte, dass zwar „viele an der Existenz von Meermännern zweifeln, es aber genügend Beweise zu geben scheint, die ihre Existenz zweifelsfrei belegen“. Doch das Problem bleibt bestehen: Leute wie Robinson und Smith können sich als „Beweise“ nur auf uralte, oft belächelte Augenzeugenberichte oder fadenscheinige Annahmen stützen. Sie brauchten wissenschaftliche Forschung, um ihre Behauptungen zu untermauern, und die gab es auch. Zwischen 1759 und 1775 erschienen im Gentleman’s Magazine zwei besonders wichtige Artikel, die sich jeweils mit Meermenschen aus einer einzigartigen wissenschaftlichen Perspektive befassten. Die erste Ausgabe, die im Dezember 1759 veröffentlicht wurde, enthielt eine ganzseitige Illustration „einer Sirene oder Meerjungfrau … die angeblich 1758 auf dem Jahrmarkt von St. Germain (Paris) ausgestellt war“. Der Autor weist darauf hin, dass diese Zeichnung der Sirene „vom berühmten Monsieur Gautier nach dem Leben gezeichnet wurde“. Jacques-Fabien Gautier d'Agoty war ein französischer Drucker und Mitglied der Académie de Dijon, der für sein Können beim Drucken von Bildern exakter wissenschaftlicher Themen weithin anerkannt war. Sogar ein so seltsames Bild gewann sofort an Glaubwürdigkeit, als Gautiers Name damit in Verbindung gebracht wurde. Doch auch ohne Gautiers Billigung zeichnen sich das Gemälde und seine Bildunterschriften durch die Verwendung moderner wissenschaftlicher Methoden aus. Gautier hatte offenbar Kontakt mit dem Wesen und fand es „etwa zwei Fuß lang, lebendig, sehr aktiv, in einem Behälter mit Wasser spielend und scheinbar sehr fröhlich und agil“. Illustration einer Meerjungfrau von Jacques-Fabien Gautier d’Agotye, kolorierte Radierung, ca. 1758. © Wellcome Collection Gautier notierte später: „Wenn es sich nicht bewegte, war seine Haltung immer aufrecht. Es war ein Weibchen und schrecklich hässlich.“ Gautier stellte fest, dass seine Haut „rau, seine Ohren groß und sein Hinterteil und Schwanz mit Schuppen bedeckt“ war. Diese Beschreibungen werden in den beigefügten Abbildungen ausführlicher wiedergegeben. Den Bildern nach zu urteilen, handelt es sich nicht um die Meerjungfrau, die seit langem Kathedralen in ganz Europa schmückt. Es passt auch nicht zu den Beschreibungen vieler anderer Naturforscher und Entdecker im Laufe der Geschichte. Während die meisten Menschen Meerjungfrauen als äußerst weibliche Figuren mit wallendem blaugrünem Haar wahrnehmen, ist Gautiers Meerjungfrau völlig kahl, hat „sehr große“ Ohren und „schrecklich hässliche“ Gesichtszüge. Die von Gautier dokumentierten Sirenen waren zudem viel kleiner als traditionelle Meerjungfrauen und maßen nur 60 Zentimeter (zwei Fuß) groß. Noch wichtiger ist, dass Gautiers Bericht über die Meerjungfrau eine Herangehensweise an die Erforschung der magischen Seite der Natur aus der Mitte des 18. Jahrhunderts widerspiegelt: Der Franzose verwendete hoch angesehene wissenschaftliche Techniken – in diesem Fall untersuchte er sorgfältig die Anatomie des Wesens und fertigte eine genaue Zeichnung an (in einem Stil, der dem anderer anatomischer Zeichnungen von Lebewesen dieser Zeit sehr ähnlich war) – um etwas darzustellen, das viele noch immer für Fantasie hielten. Wissenschaftler haben von Gautier veröffentlichte Zeichnungen verwendet, um die Echtheit der Meerjungfrau zu untersuchen. Ein anonymer Autor der Juni-Ausgabe 1762 des Gentleman’s Magazine meinte, Gautiers Zeichnung scheine „unwiderlegbar die Tatsache zu beweisen, dass solche Monster in der Natur existieren“. Doch der Autor verfügt über weitere Beweise. In der Aprilausgabe des Mercure de France aus dem Jahr 1762 wurde berichtet, dass im Juni des Vorjahres zwei Mädchen, die am Strand der Insel Noirmoutier (direkt vor der Südwestküste Frankreichs) spielten, „in einer natürlichen Höhle ein Tier in der Gestalt eines Menschen fanden, das sich auf seine Hände stützte“. In einer schrecklichen Wendung der Ereignisse stach eines der Mädchen mit einem Messer auf das Wesen ein und sah zu, wie es „wie ein Mensch stöhnte“. Die beiden Mädchen schnitten dem armen Geschöpf daraufhin die Hände ab – „mit vollständig ausgebildeten Fingern und Nägeln und Schwimmhäuten zwischen den Fingern“) – und suchten Hilfe beim Chirurgen der Insel. Der Chirurg, der das Wesen untersuchte, schrieb: Es hatte die gleiche Größe wie der größte Mensch ... seine Haut war weiß wie die eines Ertrunkenen ... seine Brust war wie die einer rundlichen Frau, seine Nase war flach, sein Mund war groß und sein Kinn war mit etwas übersät, das wie ein Bart aus winzigen Muscheln aussah, und sein Körper war mit Ansammlungen ähnlicher weißer Muscheln bedeckt. Es hatte einen Fischschwanz, an dessen Ende sich ein Paar fußähnlicher Gebilde befand. Eine solche Geschichte – bestätigt durch einen gut ausgebildeten, vertrauenswürdigen Chirurgen – stützt Gautiers Forschung zusätzlich. Für eine wachsende Zahl von Briten im 18. Jahrhundert existierten Wassermänner tatsächlich, sie hatten eine verblüffende Ähnlichkeit mit Menschen und verlangten nach weiteren Studien. Im Mai 1775 veröffentlichte das Gentleman's Magazine einen Bericht über eine Meerjungfrau, in dem es hieß, dass im August 1774 „ein Kaufmann auf dem Weg zu Handelsreisen nach Natolia im Golf von Stanchio im Archipelmeer oder der Ägäis eine Meerjungfrau gefangen habe“. Wie Gautiers „Sirene“ von 1759 wurde dieses Exemplar detailliert gezeichnet und beschrieben. Der Autor distanzierte sich jedoch auch von Gautier und stellte fest, dass seine Meerjungfrauen „sich stark von denen unterschieden, die einige Jahre zuvor auf der Messe in Saint-Germain ausgestellt worden waren“. Hier nehmen die Dinge eine interessante Wendung: Durch den Vergleich der beiden Meerjungfrauenabdrücke spekuliert der Autor über damit verbundene rassische und biologische Fragen und argumentiert, dass „Grund zu der Annahme besteht, dass es zwei verschiedene Gattungen von Meerjungfrauen gibt, oder genauer gesagt, zwei verschiedene Arten derselben Gattung, eine ähnlich den afrikanischen Schwarzen und die andere ähnlich den europäischen Weißen.“ Während Gautiers Sirenen „in jeder Hinsicht negroide“ waren, stellt der Autor fest, dass seine Meerjungfrauen „europäische Züge und einen europäischen Teint“ aufweisen. Ihr Gesicht ähnelt dem einer jungen Frau, mit hellblauen Augen, einer kleinen, hübschen Nase, einem kleinen Mund und dünnen Lippen. Eine gemischte Seite mit Illustrationen, von denen die zweite die „in der Stanchio Bay gefangene Meerjungfrau“ zeigt. Aus The Gentleman's Magazine and Historical Annals, Nr. 45, 1775. © archive.org Die Historikerin Jennifer L. Morgan weist darauf hin, dass sich englische Schriftsteller der frühen Neuzeit auf zwei Stereotypen stützten, um den Körper afrikanischer Frauen zu kommerzialisieren und herabzuwürdigen. Erstens stellen sie „oft Bilder schwarzer Frauen Bildern weißer Frauen gegenüber – also schöner Frauen.“ Hier folgt der Autor von 1775 perfekt der Vorlage und stellt Gautiers „schwarze“ Meerjungfrau, die „schrecklich hässlich“ ist, seiner eigenen wunderschönen Meerjungfrau gegenüber, die „europäische Gesichtszüge und Hautfarbe“ hat. Zweitens konzentrierten sich die Europäer der frühen Neuzeit auf die angebliche „mit Sexualität und Fortpflanzung verbundene Wildheit“ afrikanischer Frauen, um schließlich „schwarze Frauen als Beweis kultureller Unterlegenheit zu sehen, die sich letztlich als rassische Unterschiede ausdrücken würde“. Naturforscher nutzten die wissenschaftliche Untersuchung der Meermänner nicht nur, um ein tieferes Verständnis der natürlichen Ordnung des Meereslebens zu gewinnen, sondern sie nutzten ihre Interpretationen dieser geheimnisvollen Kreaturen auch, um über die Rolle des Menschen – insbesondere der Weißen – in sich verändernden rassischen und biologischen Rahmenbedingungen nachzudenken. Carl Linnaeus und sein Schüler Abraham Osterdam haben die Geschichte hinsichtlich der Klassifizierung und Authentizität von Wassermännern noch komplizierter gestaltet. Obwohl die Schwedische Akademie sich 1749 dazu bereit erklärte, nach den von Linné gesuchten Meerjungfrauen zu suchen, fand man keine Hinweise. Daher beschlossen Linné und Österdam, das Problem selbst in die Hand zu nehmen und veröffentlichten 1766 eine Abhandlung über „Siren lacertina“. Auf den ersten Seiten der Abhandlung führen sie eine lange Liste historischer Meermann-Sichtungen auf und stellen dann eine Reihe „magischer Tiere und Amphibien“ vor, die den legendären Kreaturen so ähnlich sind, dass ihre Klassifizierung äußerst schwierig ist. Letztendlich kamen sie zu dem Schluss, dass das meerjungfrauenartige Wesen „es verdient, als Tier klassifiziert zu werden und den Neugierigen als neue Form gezeigt werden sollte.“ Der „Vater der Klassifizierung“ hatte offenbar ein „äußerst wertvolles“ Stück des Naturpuzzles gefunden, das den Menschen (wenn auch nur entfernt) mit den Meerestieren verband. Noch wichtiger ist jedoch, dass die „Echsensirene“ die taxonomischen Grenzen, die Linnaeus so stolz festgelegt hatte, noch weiter verwischte und den Schluss zuließ, dass der Mensch möglicherweise entfernt mit Amphibien verwandt ist. Abbildungen: „Die Sirene“ und „Sirene Bartholini“ (benannt nach dem dänischen Arzt Thomas Bartholin, der behauptete, 1664 eine solche Sirene gesehen zu haben), aus Carl Linnaeus’ Amoenitates academicae, Buch VII, 1789. © biodiversitylibrary.org Die Untersuchung von Meerjungfrauen durch Philosophen des 18. Jahrhunderts zeigt, dass sich das Konzept des „Wunders“ während der Aufklärung noch hartnäckig hielt, die rationale Wissenschaft jedoch ebenfalls auf dem Vormarsch war. Meerjungfrauen und Meeresgöttinnen standen einst im Mittelpunkt der Mythen und am Rande wissenschaftlicher Studien, doch heute ziehen sie zunehmend die Aufmerksamkeit von Philosophen auf sich. Anfangs beschränkte sich diese Forschung auf Zeitungsartikel und kurze Erwähnungen in Reiseberichten oder Hörensagen, doch in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts begannen Naturforscher, moderne wissenschaftliche Methoden zur Erforschung von Wassermännern einzusetzen, indem sie diese geheimnisvollen Kreaturen auf äußerst sorgfältige Weise sezierten, konservierten und zeichneten. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts zählten Meerjungfrauen und Meeresgöttinnen zu den nützlichsten Vorbildern für das Verständnis der marinen Ursprünge der Menschheit. Die Möglichkeit (oder für manche die Realität) der Existenz von Meermännern hat viele Philosophen dazu gezwungen, frühere Klassifizierungskriterien, Rassenparameter und sogar Evolutionsmodelle zu überdenken. Als immer mehr europäische Denker zu der Überzeugung gelangten, dass es in der Natur tatsächlich solche Monster gebe – oder diese Möglichkeit zumindest in Betracht zogen –, verbanden die Philosophen der Aufklärung Staunen und Vernunft, um die natürliche Welt und den Platz der Menschheit darin zu verstehen. Von Vaughn Scribner Übersetzt von Kushan Korrekturlesen Kublai Khan Originalartikel/publicdomainreview.org/essay/mermaids-and-tritons-in-the-age-of-reason Dieser Artikel basiert auf der Creative Commons License (BY-NC) und wird von Kushan auf Leviathan veröffentlicht Der Artikel spiegelt nur die Ansichten des Autors wider und stellt nicht unbedingt die Position von Leviathan dar |
<<: Qianlong: Ist Qianlong-Kohl ein kaltes Gericht? Ich habe es nicht gesehen!
>>: Wow, mein astronomisches Wissen hat sich erweitert! | Ausgabe 25
Artikel empfehlen
Elektroauto-Technologie-News: Kann der CS55 Changan nach dem Erfolg auf dem SUV-Markt mit einem Preiskampf mit offiziellen Preissenkungen retten?
Zuvor hatte Changan gute Ergebnisse auf dem SUV-M...
So trainieren Sie die Brustmuskulatur am schnellsten
Die Brustmuskulatur kann den männlichen Charme st...
Wie lange nach dem Training kann man Wasser trinken?
Vielleicht mögen viele von uns bestimmte Sportart...
Golf für Anfänger
In westlichen Ländern gilt Golf als aristokratisc...
Das Chang'e-5-Unterstützungsfahrzeug muss eine chinesische Marke sein und ist der Stolz des chinesischen Volkes! Es ist der sicherste MPV in China!
Am 17. Dezember 2020 um 1:59 Uhr kehrte Chang'...
Die Jakobsmuscheln im Grillrestaurant sind die kleinen Monster mit hundert Augen.
In einer heißen Sommernacht gibt es nichts Entspa...
Warum haben manche Menschen hervortretende Venen an den Händen? Seien Sie vorsichtig, wenn an diesen Stellen blaue Adern auftreten
Ist Ihnen dieses Phänomen schon einmal aufgefalle...
Können Frauen während der Menstruation Sit-ups machen?
Ich glaube, jede Freundin kennt die Menstruation....
Fühlen Sie sich oft schwach und antriebslos? Vielleicht ernährst du dich nicht richtig ...
Dieser Artikel wurde von Pa Li Ze, Chefarzt für E...
Veränderungen in der Smart-TV-Branche: Amazon steigt, Sony sinkt
Immer mehr Internetunternehmen mischen im Bereich...
Warum dauerte es 2 Milliarden Jahre, bis sich die Oxidation der Ozeane entwickelte? Der Schlüssel liegt in dieser riesigen "Bibliothek" →
Sauerstoff ist die Quelle des Lebens. Der Sauerst...
Wie können Männer Muskeln aufbauen?
Es gibt viele Möglichkeiten, männlichen Charme zu...
Was sind die richtigen Wege, um durch Fitness abzunehmen?
Jeder sollte sich darüber im Klaren sein, dass Ab...
Warum sammelt Ice and Snow World nur Eis aus dem Songhua-Fluss?
Rezensionsexperte: Zhu Guangsi, Mitglied der Beij...
Wie heilt das beliebte „Dopamin-Outfit“ Ihre und meine Stimmung?
Der neue Favorit in der Modewelt, der in letzter ...