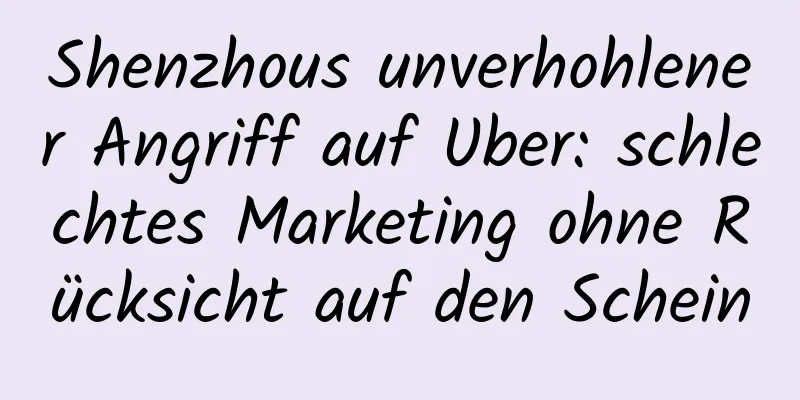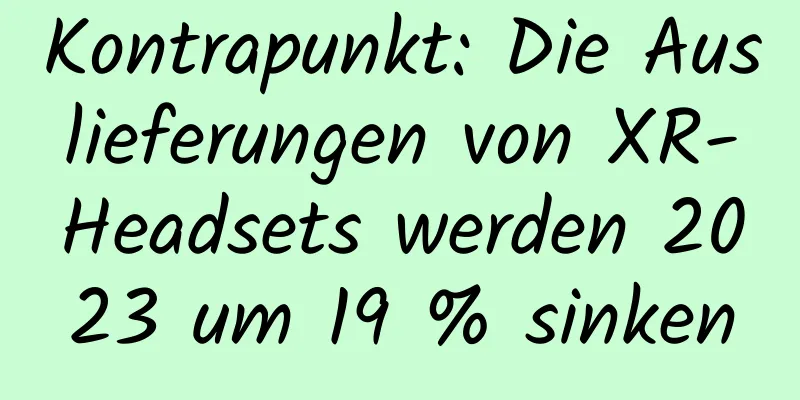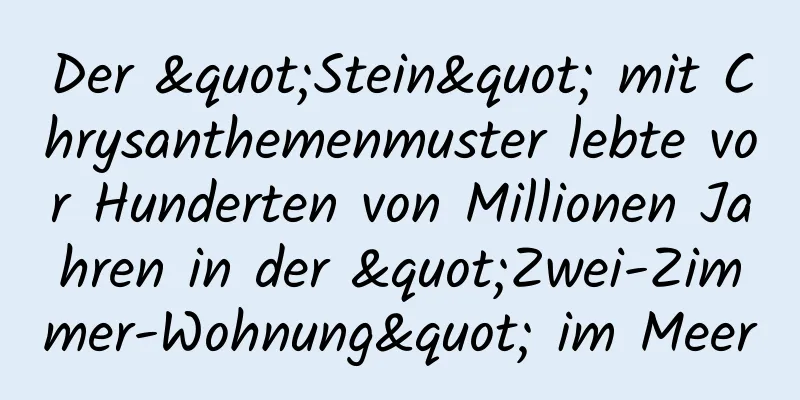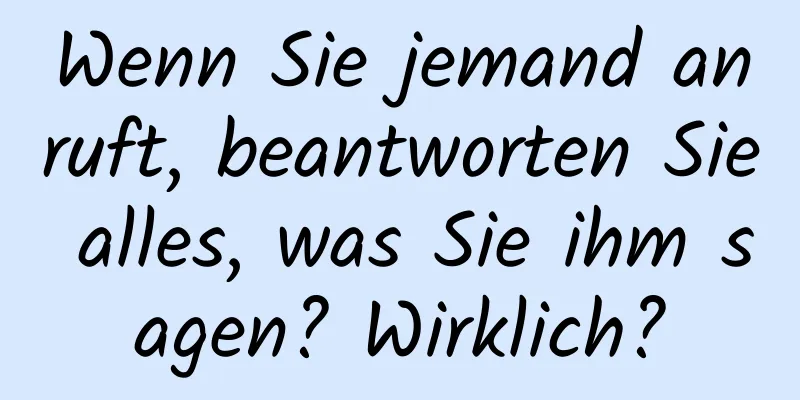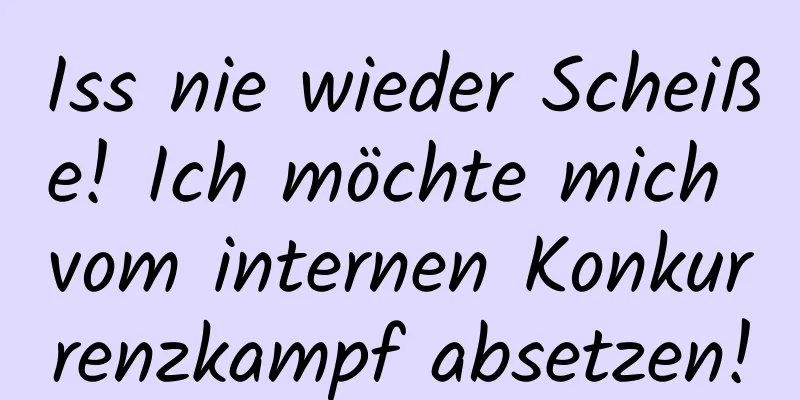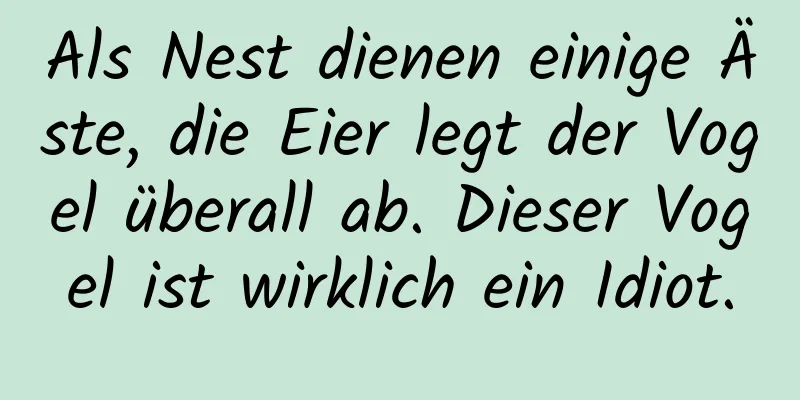Warum sollten wir seltene Arten schützen?
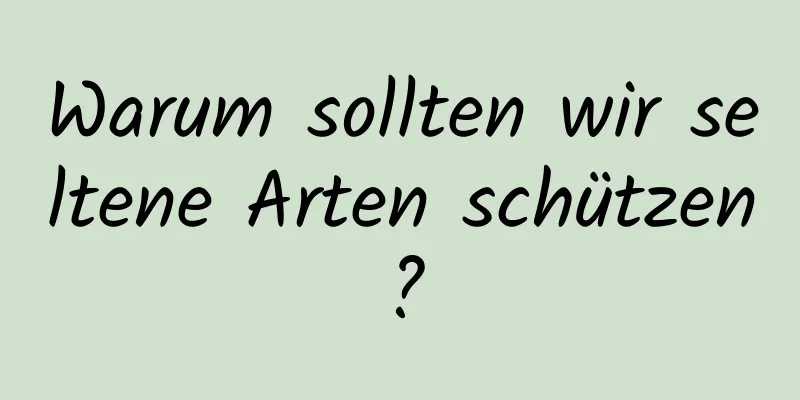
|
Im April 2020 wanderte ein Pinguin auf dem leeren Parkplatz eines Restaurants in Kapstadt, Südafrika. Das Restaurant am berühmten Boulders Beach in Kapstadt wurde aufgrund des Ausbruchs vorübergehend geschlossen. © Rodger Bosch Leviathan Press: Im April 2021 wurde der Dokumentarfilm „The Year Earth Changed“ offiziell veröffentlicht. In diesem neu erschienenen Film laufen Ziegen in Wales in Gruppen auf leeren Gehwegen, Rehe in Nara knabbern Gras am Straßenrand und Buckelwale in Alaska springen endlich wieder aus dem Wasser, als sich das Meer wieder beruhigt ... All dies geschah während der durch die Epidemie verursachten weltweiten Ausgangssperre, und die Tiere haben neue Aktivitätsmuster entwickelt, weil die Menschen in ihren Häusern geblieben sind. Dies führt zwangsläufig dazu, dass wir die Beziehung zwischen uns und dem Planeten, auf dem wir leben, überdenken. Wir haben zu viele Gründe, seltene Arten sich selbst zu überlassen. Bei jedem Massenaussterben, das durchschnittlich alle 75 Millionen Jahre stattfindet, überleben nur 5 % der Arten. Dies bedeutet, dass 98 % der 50 Milliarden Lebensarten, die jemals auf der Erde existiert haben, längst zu Öl, Fossilien oder einer Rauchwolke zerfallen sind. © Divaneth-Dias/Getty Auf lange Sicht werden alle seltenen Arten, die wir heute mit allen Mitteln zu schützen versuchen, irgendwann verschwinden. Die Unvermeidlichkeit des Todes behandelt alle gleich und ist eine Hommage an alles Leben. Das Aussterben einzelner Arten, das Verschwinden eines Stammes und sogar die Zerstörung eines ganzen Ökosystems sind die häufigsten Ereignisse in der Geschichte der Biologie – oder anders gesagt, die Dinge, die am ehesten mit den Naturgesetzen im Einklang stehen, und ihre Rettung verzögert lediglich das Aussterben. Zweitens ist das Artensterben eine starke Triebkraft der Evolution. Durch diesen Mechanismus eliminiert die natürliche Selektion Arten mit geringerer Anpassungsfähigkeit und ermöglicht es widerstandsfähigeren Organismen, zu gedeihen. Von der Antike bis zur Gegenwart ist die Last-in-First-out-Elimination ein Naturgesetz, das sich nie geändert hat. Einige Wissenschaftler sagen voraus, dass Europa aufgrund der Plattenverschiebung in 50 Millionen Jahren mit Afrika kollidieren und dabei ein neuer Superkontinent entstehen wird, und dass durch diese Veränderung eine große Zahl von Arten unwiderruflich zerstört wird. Andererseits werden aber auch nach und nach neue Arten entstehen. Nur durch die Eliminierung jener Arten, die nicht länger überlebensfähig sind und in einer evolutionären Sackgasse stecken, können wir Ressourcen freisetzen, die die Entstehung weiterer potenzieller neuer Arten ermöglichen. Das Fossil eines Trilobiten, der vor 430 Millionen Jahren lebte, soll die ersten Augen aller Lebewesen gehabt haben. © vistaalmar Darüber hinaus ist Artenschutz ein zeit- und arbeitsintensives sowie extrem teures Projekt. Einer Berechnung zufolge könnten die Kosten für die Rettung gefährdeter Arten bei nur 145.000 US-Dollar für die Weißfluss-Stachelschildkröte und bei bis zu 153,8 Millionen US-Dollar für die Unechte Karettschildkröte und die Grüne Meeresschildkröte liegen. Einer Studie aus dem Jahr 2012 zufolge werden weltweit jährlich allein für den Schutz gefährdeter Landtiere 76,1 Milliarden Dollar ausgegeben (einschließlich der Ausgaben für die Einschränkung der Jagd und die Einrichtung von Schutzgebieten). Die weltweiten Investitionen in den Vogelschutz belaufen sich auf über 65 Milliarden Dollar. Die Ausgaben für den Schutz der Meereslebewesen dürften sogar noch höher ausfallen. (science.sciencemag.org/content/338/6109/946) Der Weltbiodiversitätsrat IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) der Vereinten Nationen schätzte im Jahr 2019, dass in den nächsten Jahrzehnten fast eine Million Arten auf der Erde vom Aussterben bedroht sein werden und dass die Kosten für die Rettung dieser Arten astronomisch sein werden. Wie viele Leben könnten gerettet werden, wenn diese Ressourcen zur Lösung von Wasser- und Hungerproblemen eingesetzt würden? (ipbes.net/global-assessment) Trotz der enormen Kosten für den Artenschutz wissen wir nicht einmal, wie viele Arten jedes Jahr aussterben. Die Biologen sind sich noch nicht einmal darüber einig, wie viele Arten es auf dem Planeten gibt – selbst jetzt, da wir die Zahl der Sterne in der Milchstraße schätzen können. Bis heute sind in der wissenschaftlichen Literatur offiziell etwa 1,5 Millionen Organismenarten auf der Erde verzeichnet (die meisten davon sind Insekten). Einer Studie aus dem Jahr 2017 zufolge warten weltweit vermutlich bis zu zwei Milliarden Arten darauf, entdeckt zu werden. Eine andere Studie aus dem Jahr 2016 kam auf Grundlage von Datenmodellen zu einer noch übertriebeneren Schätzung von 100 Milliarden bis 1 Billion. (phys.org/news/2017-08-biodiversity-earth.html) (www.livescience.com/54660-1-trillion-species-on-earth.html) Dies bedeutet, dass wir Menschen selbst dann nichts von dem Aussterben einer großen Zahl von Lebewesen erfahren werden, weil diese im Rahmen des menschlichen Wissens nie existiert haben. Nur sehr selten kommt es vor, dass das letzte verbliebene Mitglied einer Art in einem Zoo oder einer ähnlichen Einrichtung stirbt, also in Sichtweite der Menschen, wie es beispielsweise bei der letzten Wandertaube Martha oder dem letzten Panama-Stummelfrosch der Fall war. Panamaischer Goldfrosch. © Brian Gratwicke In den meisten Fällen wissen wir nicht, ob eine Art im strengen Sinne wirklich ausgestorben ist. Selbst wenn ein Baby in der Öffentlichkeit stirbt, können wir nur schwer mit Sicherheit sagen, ob es wirklich das einzige Baby ist. Daher sind Wissenschaftler immer sehr vorsichtig, wenn sie bekannt geben, ob eine Art ausgestorben ist. Wird dies zu früh bekannt gegeben, werden alle Rettungsbemühungen eingestellt, was zum tatsächlichen Aussterben der Art führt, was anschaulich als „Verbotene-Frucht-Effekt“ bezeichnet wird. Leider können wir trotz aller Vorsicht nicht verhindern, dass seltene Arten an Orten, die weit entfernt von der Menschheit liegen, nach und nach aussterben, ohne dass es Berichte oder Zeugen gibt. Es ist schwer zu sagen, ob ein umfallender Baum in einem verlassenen Wald ein Geräusch verursacht, aber wir können sicher sein, dass es irgendwann wieder totenstill wird. Die Zahl der uns bekannten Arten stellt im Vergleich zur Gesamtbiomasse bereits eine Minderheit dar, und die Zahl der gefährdeten Arten ist unter den kleineren Arten sogar noch geringer. Dies wirft zwangsläufig die Frage auf, ob eine derart umfangreiche Investition in den Naturschutz überhaupt einen ausreichenden und sinnvollen Ertrag bringen kann. EO Wilson, der Harvard-Entomologe, der 1985 den Begriff „Biodiversität“ prägte, bezeichnete das Aussterben von Arten als eine „gewaltige und heimtückische“ Tragödie. Als Zeugen dieser Tragödie können die Menschen nicht anders, als Mitgefühl für diese gefährdeten oder bereits ausgestorbenen Arten zu empfinden, insbesondere für jene, die aufgrund menschlicher Einflüsse ausgestorben sind. Das letzte männliche Nördliche Breitmaulnashorn, fotografiert im Jahr 2015. © Make/Stuart Price Aber selbst dann ist die Befolgung moralischer Grundsätze wahrscheinlich kein unbedingter Grund, die Artenvielfalt zu schützen. Schließlich hoffen diejenigen, die jeden Tag rufen: „Alle Lebewesen haben das Recht zu überleben“, wahrscheinlich nicht auf eine Rückkehr des Pockenvirus. Müssen wir also wirklich jedes Jahr Hunderte von Milliarden Dollar dafür ausgeben, Arten zu retten, die vom Aussterben bedroht sind, während wir gleichzeitig unser eigenes Mitgefühl (oder unsere Schuldgefühle, weil wir von anderen Arten nur profitieren, um deren Aussterben voranzutreiben) befriedigen? Wenn das kein gutes Geschäft ist, warum sollten wir dann gefährdete Arten retten? Glücklicherweise sind die Argumente für den Schutz bedrohter Arten überzeugender als dafür, sie dem Aussterben zu überlassen – selbst wenn wir Argumente wie „Befriedigung des Mitgefühls“ außer Acht lassen. * * * Für den Menschen ist die natürliche Ökologie in erster Linie eine natürliche Apotheke. Mehr als die Hälfte der Wirkstoffe der 150 am häufigsten von Menschen verwendeten verschreibungspflichtigen Medikamente stammen ursprünglich aus Pflanzen oder anderen Naturprodukten. Das am häufigsten vorkommende Amoxicillin stammt beispielsweise vom Penicillin in Penicillium ab. Das Krebsmedikament Paclitaxel weist eine äußerst komplexe chemische Struktur auf (einige Forscher haben zugegeben, dass es durch künstliche Herstellung schwierig ist), doch bevor seine einzigartigen Wirkungen entdeckt wurden, wurde die Eibe (Brevifolia), die Paclitaxel enthält, gefällt und zu Holz verarbeitet. Wenn diese Organismen verschwinden, bevor ihre einzigartige Chemie entdeckt wird, gehen auch ihre Geheimnisse verloren. Paclitaxel ist ein Wirkstoff eines Krebsmedikaments, der aus der Rinde der Eibe gewonnen wird. © Walter Siegmund/wiki Antibiotika, Krebsmedikamente, Schmerzmittel, Antikoagulanzien … die Natur liefert viele der Medikamente, die wir zum Überleben brauchen. Jeder Organismus stellt einen einzigartigen Vorrat an genetischem Material dar, der in Milliarden von Jahren der Evolution entstanden ist. Dennoch haben wir nur etwa 5 % der bekannten Pflanzen für medizinische Zwecke untersucht. Es ist absehbar, dass die weitere Erforschung dieser noch zu entdeckenden Arten einen großen Nutzen für die Humanmedizin bringen wird. Eine ähnliche Situation gibt es auch in der Lebensmittelindustrie. Der ehemalige US-Präsident Thomas Jefferson sagte einmal: „Es gibt keinen größeren Beitrag für eine Nation, als ihrer Kultur eine nützliche Pflanze hinzuzufügen, insbesondere ein Brotgetreide.“ Schätzungsweise gibt es etwa 80.000 essbare Pflanzen für den Menschen, und weniger als 20 davon ernähren 90 % der Weltbevölkerung. Wir leben quasi in einer riesigen „natürlichen Kornkammer“. Da uns ihr unbestreitbarer medizinischer und essbarer Wert direkt vor Augen steht, werden diese für den Menschen „nützlichen“ Arten natürlich auch die Aufmerksamkeit und den Schutz der Menschen erhalten. Aber wozu sind Pandas gut? Wenn sie weder gegessen noch als Medizin verwendet werden können, warum sollten wir sie dann schützen? Liegt es nur daran, dass sie süß sind? Aus einer bestimmten Perspektive ist dies wahr. © giphy Im Jahr 2018 führten Wissenschaftler ihre erste quantitative Bewertung des Naturschutzwerts der Großen Pandas als Chinas wichtigste gefährdete Tierart durch. Jährliche Ausgaben von 255 Millionen US-Dollar für Große Pandas können einen großzügigen Ertrag von 2,5 Milliarden US-Dollar einbringen. (www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982218306821) Hierzu gehört die Wertschätzung der Boden- und Wasserressourcen, die sich aus dem Schutz der Lebensräume des Großen Pandas ergibt, sowie die Förderung kultureller Werte in den Bereichen Tourismus, Ästhetik, Markenbildung und Bildung. Darüber hinaus lag laut Daten des China Statistical Yearbook die jährliche Wachstumsrate des Einkommens von Bauern, die in der Nähe von Panda-Reservaten in Sichuan, Shaanxi und Gansu lebten, zwischen 2000 und 2010 um 8 Prozent über dem Durchschnitt ihrer jeweiligen Provinzen. Der Schutz der Großen Pandas bedeutet nicht nur den Schutz anderer durch die Art geschützter Lebewesen und des Landes, in dem sie leben, sondern bringt auch beträchtliche Einnahmen aus kulturellen Produkten wie Tourismus und Rohstoffen mit sich, die wiederum in die Naturschutzarbeit zurückfließen können. Die runden Tiere bringen handfeste wirtschaftliche Vorteile mit sich und es ist nicht unmöglich, dass sowohl der Mensch als auch andere Arten eine Win-Win-Situation erreichen. Bereits 1997 schätzte der renommierte Ökoökonom Robert Costanza gemeinsam mit 13 Wissenschaftlern den Wert, der durch den weltweiten Umweltschutz geschaffen wird. Sie gingen davon aus, dass sich die Erträge aus der weltweiten Umweltschutzarbeit in diesem Jahr auf 33 Billionen US-Dollar beliefen, also fast das Doppelte des weltweiten BIP in diesem Jahr. Zwanzig Jahre später, im Jahr 2017, berechnete Costanza die Summe auf 12,5 Milliarden Dollar. Im Gegensatz dazu ist es eine sehr schlechte Idee, Arten sich selbst zu überlassen. Einer Studie der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2010 zufolge könnte der anhaltende Artenschwund, sofern er nicht eingedämmt wird, die globale Wirtschaftsleistung bis 2050 um 18 % reduzieren. Der Schutz der Ökologie bedeutet nicht länger eine Einschränkung der wirtschaftlichen Entwicklung, sondern kann im Gegenteil Einkommen generieren. (www.bbc.com/news/business-11606228) © giphy Auch aus utilitaristischer Sicht sollten wir gefährdete Arten schützen, da sie vom Menschen genutzt werden können. Bedeutet das, dass wir diese „schädlichen Arten“ ausrotten können? Wie Fliegen, Mücken, Kakerlaken … Oder sollten wir sie zumindest sich selbst überlassen? Tatsächlich kann jedoch selbst das Aussterben „schädlicher Arten“ wiederum den Menschen selbst schaden. Hirten in Westafrika beispielsweise hassen Löwen, weil diese nicht nur ihr Vieh fressen, sondern manchmal auch ihre eigene Sicherheit bedrohen. Dies führte dazu, dass ihr Alltag um eine traditionelle Sportveranstaltung ergänzt wurde: das Löwenfangen. Andererseits sind Löwen wichtige Feinde der Paviane und können die lokale Pavianpopulation auf natürliche und wirksame Weise kontrollieren. Wenn die Löwen zu stark ausgerottet werden, wird die Pavianpopulation aufgrund der geringeren Gefahr durch Raubtiere dramatisch ansteigen und schließlich mit einer großen Zahl von Parasiten in ihrem Darm in menschliche Dörfer eindringen, um Wasser und Nahrung zu stehlen und den örtlichen Hirten verschiedene parasitäre Infektionen zuzuführen. Auf die Frage, ob Löwen oder Parasiten furchterregender sind, wird es nie eine einseitige Antwort geben. Die einzige Lösung besteht darin, ein ökologisches Umfeld zu schaffen, in dem Menschen und Löwen sicher koexistieren können. Das auf den Visayas-Inseln auf den Philippinen lebende Visayas-Warzenschwein ist zwar nicht so auffällig wie der Panda, braucht aber dennoch dringend Schutz. © Wiki Heißt das, wir sollten Parasiten einfach ausrotten? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Wenn die Parasiten erst einmal ausgerottet sind, wird die Pavianpopulation unweigerlich rapide ansteigen. Und auch die Löwenpopulation wird sprunghaft ansteigen, da Nahrung leichter zu beschaffen sein wird, was eine zusätzliche Belastung für die Menschen darstellt. Dies ist ein einfaches „Pool gleichzeitig füllen und entleeren“-Problem, mit dem Unterschied, dass unser Ziel nicht mehr darin besteht, den Pool zu leeren oder zu füllen, sondern ihn mit Wasser gefüllt zu halten, ohne dass er überläuft. Bei den Millionen von Arten, die denselben Planeten bevölkern, hat jede Art im Lauf der Zeit ihre eigene, einzigartige funktionale Rolle entwickelt und alle Arten stammen aus demselben Pool. Es stimmt, dass sich die Ökologie schon immer in einem Zustand dynamischer Stabilität befunden hat. Selbst wenn morgen die Hälfte aller Arten ausstirbt, wird das bestehende Ökosystem einfach in einen anderen Zustand dynamischer Stabilität übergehen – der Preis, den wir in diesem Prozess zahlen müssen, lässt sich nur schwer beziffern – und die Prämisse ist, dass die Menschen nicht zu der Hälfte gehören, die ausstirbt. Auf lange Sicht wird jede Art zwangsläufig Auswirkungen auf die Ökologie haben, und eine gute Ökologie wird zwangsläufig allen Arten, einschließlich dem Menschen, zugute kommen. * * * © theofy In den 1980er Jahren zäunten die Amerikaner in der kargen Wüste Arizonas eine Fläche von 1,27 Hektar (weniger als die Größe von zwei Fußballfeldern) ein, um ein romantisches und radikales Experiment durchzuführen – Biosphäre 2. Das Experiment zielt darauf ab, zu erforschen, ob der Mensch in der Lage ist, auf begrenztem Raum ein autarkes Leben in einem unabhängigen, geschlossenen Ökosystem zu führen. Biosphäre 2 besteht aus sieben Biombereichen: künstlicher Ozean, Feuchtgebiete, Wüste, Miniatur-Regenwald ... Temperaturgeregeltes Wasser zirkuliert durch ein unabhängiges Rohrsystem, Paneele, die die meisten Anlagen bedecken, absorbieren Sonnenenergie und das Erdgasenergiezentrum kann zentral Strom erzeugen. Wenn das Experiment erfolgreich ist, verfügen die Menschen über die technische Unterstützung und das nötige Selbstvertrauen, um ein unabhängiges Ökosystem in der interstellaren Umgebung aufzubauen. Der Mond, der Mars und sogar treibende Raumstationen können alle in für Menschen geeignete Orte verwandelt werden. Dadurch wird die Menschheit ihre Abhängigkeit von der „Biosphäre 1“ – der Erde – los und bewegt sich in Richtung der Sterne und des Meeres. Carl Hodges, ein Wissenschaftler an der Universität von Arizona, sagte, es werde „das bedeutendste wissenschaftliche Projekt der Geschichte“ sein, während ABC meinte, es könne „die Welt retten“. Am Morgen des 26. September 1991 winkten acht Experimentatoren den Kameras der Medien zum Abschied, betraten Biosphäre 2 und schlossen das Gasventil. Die acht am Experiment beteiligten Mitarbeiter und das dahinterliegende Modul. © Tim Roberts/AFP/Getty Images Ursprünglich war geplant, bis zum 26. September zwei Jahre später dort zu bleiben. Es ist schade, dass die meisten der hehren Ideale letztlich in der harten Realität enden. Schon in den ersten Monaten behinderten ständig bewölkte Tage das Wachstum der Feldfrüchte erheblich und zwangen die Menschen dazu, Notspeicher zu öffnen, um Nahrungsmittel zu beschaffen. Später sank die Sauerstoffkonzentration im Kreis aufgrund der Vermehrung sauerstofffressender Bakterien im Boden auf 14,5 %, was so dünn war wie ein Plateau auf 4.080 Metern Höhe. Aufgrund der mangelhaften Entwässerung war die Wüste feucht und Ameisen und Kakerlaken vermehrten sich massenhaft. Kolibris und Bienen starben einer nach dem anderen und die Nutzpflanzen konnten nicht bestäubt werden … Aufgrund der geringen Größe der Biosphäre 2 sind die unerwarteten Ereignisse und Umweltvariablen, mit denen sie umgehen kann, äußerst begrenzt und ökologische Schwankungen treten schneller und dramatischer auf als in der Außenwelt. Nach 6 Monaten musste das Experiment mit einem Misserfolg enden. Nach umfangreichen Untersuchungen und Optimierungen des Systems wurde der zweite Versuch der Experimentatoren am 6. März 1994 wieder aufgenommen – doch weniger als einen Monat später wurde das Projekt aufgrund von Streitigkeiten innerhalb des Managementteams unter Konkursverwaltung gestellt. Biosphäre 2 erlag letztlich der menschlichen Natur. Dieses Projekt, das zu Beginn seiner Gründung als „das aufregendste wissenschaftliche Projekt der Vereinigten Staaten seit der Mondlandung“ gepriesen wurde, wurde letztendlich als „pseudowissenschaftlicher New-Age-Unsinn“ bewertet. Das Innere der Biosphäre 2. © Jasper Nance Der moderne Mensch ist mächtiger als alle anderen Menschen in der Geschichte. Tief in den Meeresboden vordringen, in den Weltraum fliegen, Leben klonen, Verbindungen über Radiowellen herstellen ... es ist keine Übertreibung zu sagen, dass die menschliche Zivilisation auf dem Weg ist, ein „Gott“ zu werden. Was jedoch äußerst unverhältnismäßig ist, ist die Tatsache, dass sich unser Körper kaum verändert. Der hohe Entwicklungsstand der modernen Zivilisation ist nicht darauf zurückzuführen, dass wir intelligenter geworden sind, sondern er ist das Ergebnis der Ansammlung menschlicher intellektueller Leistungen mehrerer Generationen. Unsere Gehirnkapazität unterscheidet sich nicht wesentlich von der unserer Vorfahren, die rohes Fleisch aßen und Blut tranken. Wie sie müssen wir Wasser und Nahrung aufnehmen, Luft atmen, den Kreislauf von Geburt, Alter, Krankheit und Tod wiederholen und mit allen anderen Arten in der Biosphäre Nr. 1 leben. Medizinische, essbare, touristische und kulturelle Entwicklung... Wir können das ökologische Gleichgewicht für jeden praktischen Zweck aufrechterhalten, aber wir können niemals die Tatsache ignorieren oder leugnen, dass die Menschheit jederzeit auf die Ökologie dieses Planeten angewiesen ist. Das Scheitern der Biosphäre 2 hat diese Realität erneut bestätigt: Bislang ist es dem Menschen nicht gelungen, eine ökologische Umgebung zu simulieren, die der Erde ähnelt, und er kann auch nicht unabhängig vom bestehenden Ökosystem überleben. Vielleicht sollten wir nicht darüber nachdenken, wie wir uns von der bestehenden Ökologie lösen können, sondern darüber, wie wir vom blauen Planeten profitieren und gleichzeitig im Einklang mit der Ökologie leben können, in der wir uns befinden. Von Tesoro Korrekturlesen/Rabbits leichte Schritte Dieser Artikel basiert auf der Creative Commons License (BY-NC) und wird von Tesoro auf Leviathan veröffentlicht Der Artikel spiegelt nur die Ansichten des Autors wider und stellt nicht unbedingt die Position von Leviathan dar |
<<: Gegrillte Garnelen zum chinesischen Neujahr! Welche Garnelenart ist Ihr Favorit?
>>: Nach ein paar Mal Skifahren war ich süchtig!
Artikel empfehlen
Acea: EU-Neuzulassungen von Pkw im Januar 2025 um 2,6 % gesunken
Im Januar 2025 gingen die Neuzulassungen von Pers...
Überkritischer Dampf? Versteckter vierter Stern? Kepler-Teleskop entdeckt Wasserwelt außerhalb unseres Sonnensystems
Nach jahrelanger Beobachtung sind Exoplaneten vol...
In einem Artikel verstehen: Ist Nvidias Übernahme von ARM eine Katastrophe oder eine Chance für Chinas Chipindustrie?
Ich dachte, die NVIDIA RTX 3090-Grafikkarte wäre ...
Welche Wirkungen hat Ba Duan Jin?
Ba Duan Jin ist einfach und praktischer, weshalb ...
So trainieren Sie zu Hause
Viele Menschen denken oft darüber nach, Sport zu ...
Wie trainiert man, um das Gesäß anzuheben?
Jede von uns Frauen legt großen Wert auf ihre Fig...
Honor Magic im Praxistest: Faszinierender als der achtfach gekrümmte Bildschirm ist die künstliche Intelligenz
Honor war im Jahr 2016 zweifellos eine sehr produ...
So trainieren Sie schnell Ihren großen Brustmuskel
Beim Abnehmen wissen viele Menschen nicht, welche...
Das Spiel ist so klein, dass es weniger als 1 KB groß ist
Die Grafikqualität der Spiele wird immer besser u...
So machen Sie Sit-ups, um Bauchfett zu reduzieren. Achten Sie auf die Häufigkeit!
Jeder weiß, dass Sit-ups sehr effektiv dabei helf...
Warum schmerzen die Muskeln nach dem Training?
Oftmals verspüren Menschen Muskelkater, wenn sie ...
Accenture: Umfrage zum Weihnachtseinkauf 2022
Die Ergebnisse der 16. jährlichen Weihnachtseinka...
Jack Ma, mit dem Wang Jianlin nicht klarkam, kam zu Alibaba Pictures, um die globale Unterhaltungsindustrie mit Spielberg zu integrieren
Im internationalen Wirtschaftsleben fungiert Chin...
Was sind die Vor- und Nachteile des Schwimmens?
Jeden Sommer wird das Meer oder Flussufer zum Par...
Die freigesprochene Leopardkatze, ist es ein Leopard oder eine Katze?
In den Lokalnachrichten tauchte ein katzengroßer ...