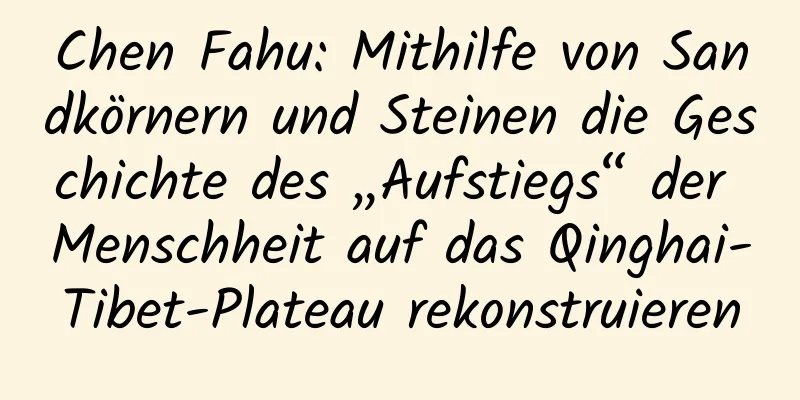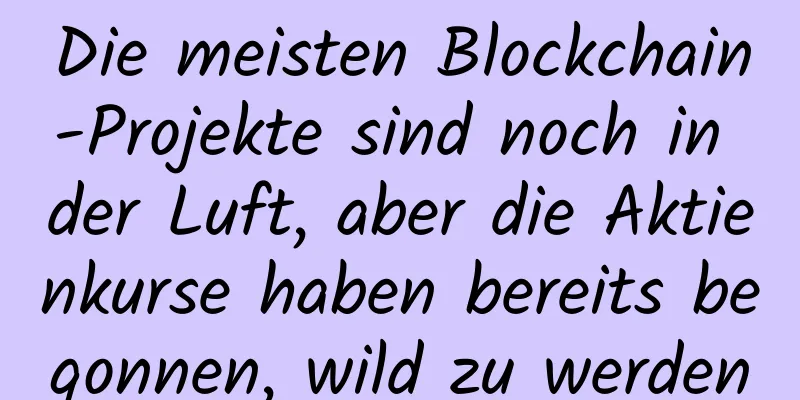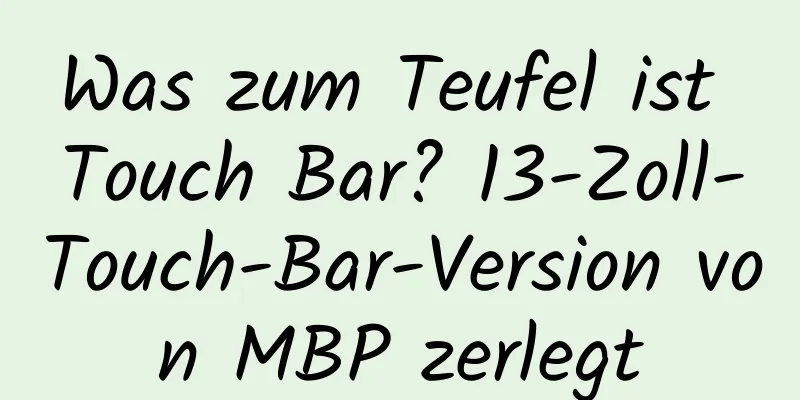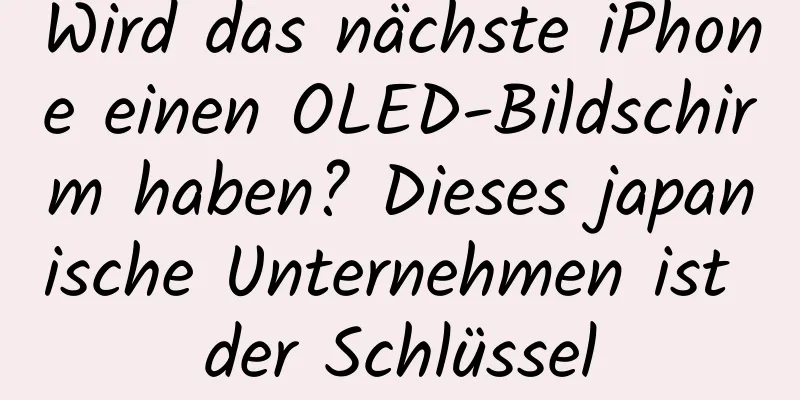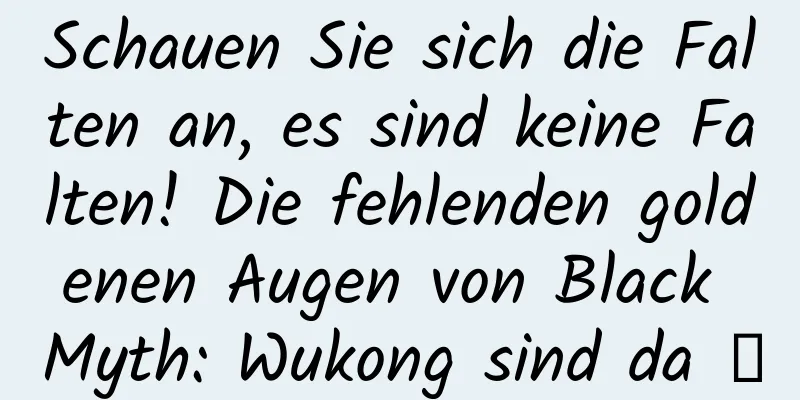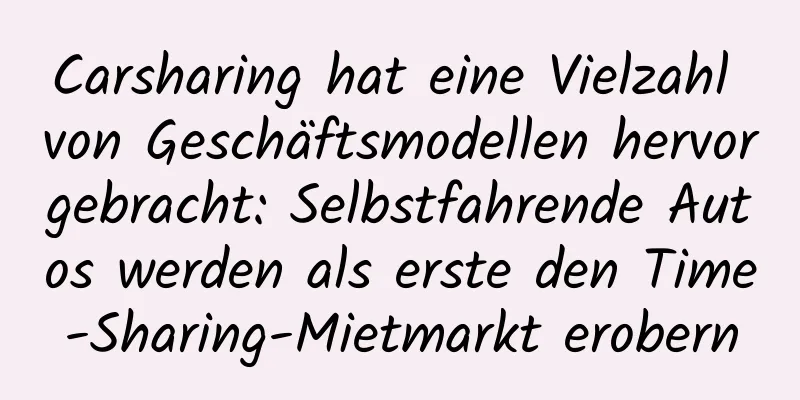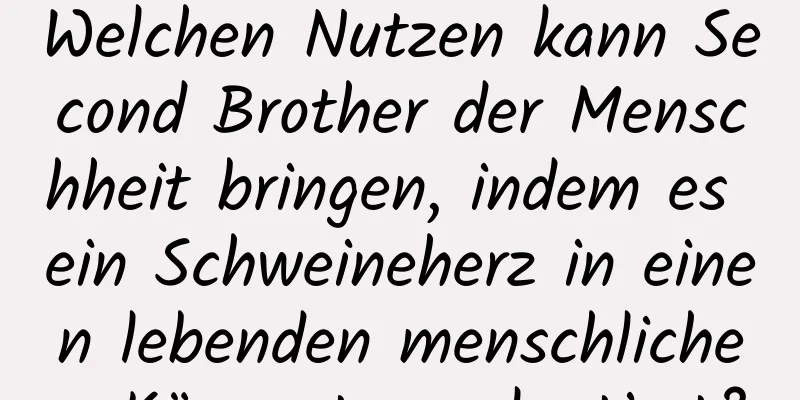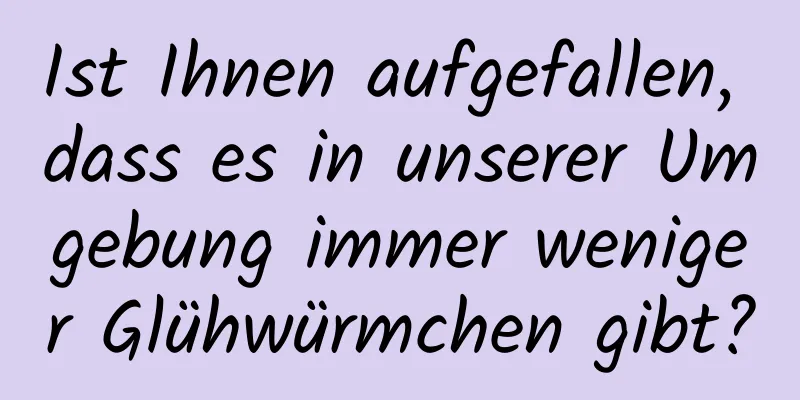China sucht nach „Erde 2.0“, um eine neue Ära der Exoplaneten-Erkundung einzuläuten
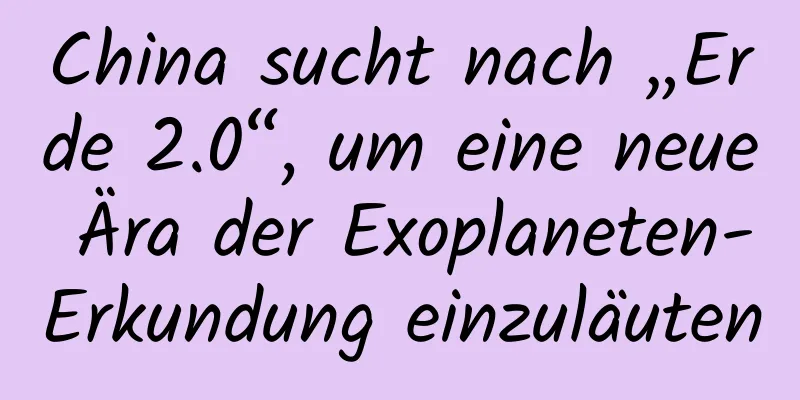
|
Geschrieben von Reporter Duan Ran (Praktikum) Bearbeitet von Ding Lin Redakteur für Neue Medien/Li Yunfeng Interviewexperten Gu Shenghong (Chefforscher, Yunnan Astronomical Observatory, Chinesische Akademie der Wissenschaften) Sind Menschen im riesigen Universum die einzigen intelligenten Lebewesen? Ist das Zuhause, von dem unser Überleben abhängt, ein einsames Dasein? Diese philosophischen Fragen entstanden wahrscheinlich schon, als die Menschen zum ersten Mal in den Sternenhimmel blickten, und haben bis heute den Wunsch und die Begeisterung zukünftiger Generationen geweckt, das Universum zu erforschen. Nach Tausenden von Jahren der Ansammlung wissenschaftlicher Erkenntnisse, der Konstruktion theoretischer Systeme und der iterativen Aktualisierung von Konzepten hat unser Verständnis des Weltraums ein beispielloses Niveau erreicht. Insbesondere in den letzten beiden Jahrzehnten hat die Erforschung extrasolarer Planeten durch die astronomische Gemeinschaft der Menschheit immer wieder gezeigt, dass wir im riesigen Universum möglicherweise nicht allein sind. Kürzlich enthüllte das britische Magazin Nature Chinas Plan „Earth 2.0“. Das Projekt wurde vom Shanghai Astronomical Observatory der Chinesischen Akademie der Wissenschaften initiiert. Das Unternehmen plant, in den nächsten fünf Jahren einen neuen Ortungssatelliten ins All zu schicken, um eine detaillierte „Planetenzählung“ der Exoplaneten in den riesigen Tiefen des Weltraums durchzuführen und so Chinas Stärke bei der Erforschung der außerirdischen Heimat der Menschheit einzubringen. ▲Das Kepler-Weltraumteleskop ist zur Beobachtung auf die Schwan-Lier-Richtung in der Milchstraße ausgerichtet (jedes Rechteck im Bild stellt einen 2,25 Millionen Pixel großen CCD-Sensor dar). Das Projekt „Earth 2.0“ meines Landes plant eine eingehendere Erforschung desselben Gebiets (Originalbild der NASA). Nach den bisher veröffentlichten Informationen handelt es sich bei „Earth 2.0“ definitiv um einen ehrgeizigen Plan: Wir müssen nicht nur den Anschluss an das fortgeschrittene Niveau der internationalen Exoplanetenforschung finden, sondern auch eine chinesische Version des Verbesserungsplans für die Probleme und Mängel vorschlagen, die bei fortgeschrittenen Weltraumprojekten zur Exoplanetenforschung wie Kepler aufgedeckt wurden. Gu Shenghong, leitender Forscher am Yunnan Astronomical Observatory der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, der sich seit langem der Erforschung extrasolarer Planetensysteme widmet und viele damit verbundene nationale wissenschaftliche Forschungsprojekte geleitet hat, sagte gegenüber Reportern: „Das Projekt ‚Earth 2.0‘ ist ziemlich spannend. Es baut auf den Daten der ersten vier Jahre des Kepler-Projekts auf. Mit seinem eigenen Design kann es weitere vier Jahre Beobachtungen durchführen und dabei acht Jahre Daten abdecken, was die Erkennungsfähigkeit von Exoplaneten erheblich verbessert.“ ○ ○ ○ Exoplaneten: Der lange Weg liegt vor uns Wie der Name schon sagt, handelt es sich bei einem Exoplaneten um einen Planeten, der sich außerhalb des Sonnensystems befindet und andere Sterne umkreist. Nach groben Schätzungen von Wissenschaftlern gibt es allein in der Milchstraße mindestens 400 Milliarden Exoplaneten, davon sind bis zu 17 Milliarden erdähnliche Gesteinsplaneten. Unter dieser großen Zahl von Exoplaneten haben wir Grund zu der Annahme, dass es „eine andere Erde“ gibt, die in der „bewohnbaren Zone“ kreist und für die Entstehung von Leben geeignet ist. Damit ein Planet als „andere Erde“ bezeichnet werden kann, muss er relativ strenge Bedingungen erfüllen. Gu Shenghong erklärte Reportern: „Erstens muss der Hauptstern des Exoplaneten ein sonnenähnlicher Stern sein, genau wie der Hauptstern unseres Sonnensystems die Sonne ist. Zweitens muss sich der Planet in der bewohnbaren Zone des Planetensystems befinden, das heißt, er muss einen gewissen Abstand zum Hauptstern haben, um die Existenz von flüssigem Wasser sicherzustellen. Drittens muss der Planet eine felsige, feste Oberfläche ähnlich der der Erde haben. Nur wenn diese Bedingungen erfüllt sind, kann erdähnliches Leben existieren.“ Das menschliche Verständnis der Planeten hat einen langen Weg der Erforschung hinter sich. Seit der Beobachtung der Planeten in unserem Sonnensystem hat die moderne Himmelsmechanik die Astronomen dazu veranlasst, die Grenzen der Planeten kontinuierlich zu erweitern – von der Betrachtung der Saturnbahn als Grenze des Sonnensystems im 18. Jahrhundert bis hin zur Streichung Plutos von der Planetenliste im Jahr 2006. Allein das Verständnis dieser Planeten „vor unserer Haustür“ hat die Menschheit Hunderte von Jahren der Anstrengung gekostet. Die technischen Schwierigkeiten bei der Erforschung von Exoplaneten sind unvergleichlich. ▲Draufsicht auf die Milchstraße, wobei der gelbe Pfeil von unserem Sonnensystem in Richtung Schwan zeigt (Originalbild von Sky & Telescope) Vor etwas mehr als zwanzig Jahren war die Frage, ob es außerhalb des Sonnensystems ein Planetensystem gibt, unter Wissenschaftlern noch Gegenstand von Spekulationen. Da Planeten selbst kein Licht aussenden und ihr Volumen auf einer räumlichen Skala von Lichtjahren viel kleiner ist als das ihrer Muttersterne, ist es äußerst schwierig, die „Sternspuren“ von Planeten zu finden, die durch das Licht der Sterne verdeckt werden. Die Aufgabe, nach ihnen zu suchen, hat selbst die besten Astronomen ratlos zurückgelassen. Bis in die 1980er Jahre konnten Astronomen nur indirekt über die Staubwolken, die um einige Sterne herum zu finden sind, auf die mögliche Existenz von Exoplaneten schließen. Im Jahr 1992 entdeckten Astronomen die ersten Planeten außerhalb unseres Sonnensystems: zwei Gasriesen, die einen Pulsar 980 Lichtjahre von der Erde entfernt umkreisen. Da diese beiden Planeten aus schnell rotierenden Pulsaren bestehen, kann man sich die raue Umgebung vorstellen, in der sie leben. Doch diese Entdeckung hat den Vorhang für die menschliche Erforschung von Exoplaneten geöffnet. ▲Die Geschichte der menschlichen Erforschung von Exoplaneten ist noch nicht lang (Originalbild der Europäischen Weltraumorganisation) ○ ○ ○ Mit dem Nobelpreis ausgezeichnete „Lineare Geschwindigkeitsmethode“ Die überwiegende Mehrheit der Exoplaneten ist zu weit von uns entfernt, und es ist vorstellbar, wie schwierig es ist, diese selbstleuchtenden Himmelskörper durch das riesige Sternenmeer zu entdecken. Daher verlassen sich Astronomen bei der Suche nach Exoplaneten derzeit vor allem auf indirekte Nachweismethoden, das heißt, sie analysieren die leuchtkräftigen Sterne und können daraus indirekt Rückschlüsse darauf ziehen, ob es sich bei den Sternen um Planetensysteme handelt. Unter den verschiedenen derzeit verwendeten indirekten Nachweismethoden sind die „Radialgeschwindigkeitsmethode“ und die „Transitmethode“ die gebräuchlichsten. Das Grundprinzip der „Radialgeschwindigkeitsmethode“ (auch bekannt als Radialgeschwindigkeitsmethode oder Dopplerspektroskopiemethode) besteht darin, dass bei der Bewegung eines Planeten um einen Stern der Stern von der schwachen Schwerkraft des Planeten beeinflusst wird, wodurch winzige periodische Schwingungen entstehen. Astronomen erkennen und erfassen diese periodische Schwingung durch Beobachtung des Dopplereffekts des Sternspektrums und können indirekt auf die Existenz eines Planetensystems in der Nähe des Sterns schließen. ▲Die Schwerkraft von Exoplaneten bringt Sterne zu leichten Schwingungen, sodass wir auf der Erde die periodische Rot- und Blauverschiebung der Sternspektren beobachten können (Bildquelle: The Planetary Society) Im Jahr 1995 entdeckten die Schweizer Astronomen Michel Mayor und Didier Queloz mithilfe eines hochpräzisen Spektrometers und der „Radialgeschwindigkeitsmethode“ einen Gasplaneten namens 51 Pegasus b in der Nähe des Sterns 51 Pegasus. Dies ist das erste Mal, dass Menschen einen Exoplaneten entdeckt haben, der einen Hauptreihenstern (einen Sterntyp, zu dem auch die Sonne gehört) umkreist. Für diese Entdeckung erhielten die beiden auch den Nobelpreis für Physik 2019. Nach der Entdeckung von 51 Pegasus b wurde die Radialgeschwindigkeitsmethode häufig bei der Erkennung und Entdeckung von Exoplaneten eingesetzt. Allerdings weist auch diese Messmethode offensichtliche Mängel auf: Die Planeten, auf die diese Methode anwendbar ist, unterliegen Beschränkungen hinsichtlich der Bahnneigung und es kommt wahrscheinlich zu großen Fehlern bei der Bestimmung der Masse der beobachteten Planeten. Da mit dieser Methode nur einige massereiche Planeten genau erkannt werden können, ist der Umfang der Planetenerkennung erheblich eingeschränkt. Daher hat bei den Planetenerkundungsaktivitäten der letzten Jahre ein anderes Verfahren, die „Transitmethode“, allmählich an Aufmerksamkeit gewonnen. ○ ○ ○ Kepler-Mission: Die „feurigen Augen“ des Himmels Die sogenannte „Transitmethode“ (auch Transitmethode genannt) dient der Feststellung der Existenz eines Planetensystems anhand der periodischen Änderungen der Sternhelligkeit, die durch das Transitphänomen beim Vorbeiflug eines Planeten an seinem Hauptstern entstehen. Im Vergleich zur Radialgeschwindigkeitsmethode stellt die Transitmethode höhere Anforderungen an stabile Beobachtungsbedingungen. Daher ist der Start eines Weltraumteleskops in die Weltraumumlaufbahn die einzige Möglichkeit für Wissenschaftler, die die „Transitmethode“ bevorzugen. ▲Wenn ein Exoplanet einen Stern umkreist, ändert sich die Helligkeit des Sterns aufgrund des Planeten periodisch (Bildquelle: Astronomy Magazine) Im Jahr 2009 brachte die NASA das Kepler-Weltraumteleskop in seine geplante Umlaufbahn um die Sonne. Dies ist ein bahnbrechendes Projekt in der Geschichte der Exoplanetenerkundung. Kepler ist mit einem Schmidt-Teleskop mit einem Durchmesser von 0,95 Metern und einer Masse von über 1 Tonne ausgestattet. Das Zielgebiet liegt in den Sternbildern Schwan und Leier. Während seines Betriebs nutzte das Kepler-Teleskop die „Transitmethode“, um die Zahl der bekannten Exoplaneten zu vervielfachen. Bis zum Projektende im Jahr 2018 hatte das Kepler-Projekt bereits 2.325 Exoplaneten entdeckt (bis zum 27. April dieses Jahres wurden insgesamt 5.014 Exoplaneten bestätigt). ▲Bis zu diesem Jahr haben Astronomen mehr als 5.000 Exoplaneten bestätigt (Originalbild der NASA) Das Kepler-Projekt hat nicht nur die Vorstellung der Menschheit vom außerirdischen Raum erheblich erweitert, sondern auch das Verständnis der astronomischen Gemeinschaft für den Begriff „Planet“ aufgefrischt. Mithilfe verschiedener Daten des Kepler-Projekts haben Astronomen zahlreiche Phänomene entdeckt, die dem traditionellen astrophysikalischen Wissen widersprechen: etwa Planeten, die zwei Sterne umkreisen, oder Planeten, die in einem Vierfachsternsystem kreisen. Angesichts dieser bizarren Phänomene verwendete der Astronom Michael Summers in seinem Buch „Exoplanets“ den Monarchfalter als metaphorische Darstellung der Erde: Angenommen, die Menschen hätten in ihrem Leben nur den Monarchfalter gesehen, würden sie natürlich annehmen, dass die Merkmale des Monarchfalters denen von Schmetterlingen entsprechen. Sobald sie einem Schmetterling mit anderen Merkmalen begegnen, erleiden sie einen kognitiven Schock und müssen ihre ursprünglichen Vorstellungen überdenken. ○ ○ ○ Wangshu entdecken: Die Reise meines Landes in die Exoplaneten-Erkundung In den letzten Jahren haben die erd- und weltraumgestützten Planetenbeobachtungssysteme der Vereinigten Staaten einen Aufschwung erlebt. Im Vergleich dazu hat mein Land im Bereich der Exoplanetenforschung insgesamt relativ spät begonnen. Aufgrund von Mängeln in der Detektortechnologie und der Genauigkeit der Verarbeitung von Beobachtungsdaten waren die bei der Exoplanetenerkundung meines Landes verwendeten Forschungsproben schon immer stark von Beobachtungsdaten ausländischer Detektoren abhängig. Diese Situation hielt viele Jahre an, bis meinem Land im Jahr 2008 ein „Null-Durchbruch“ bei der Erforschung von Exoplaneten gelang: Ein Team unter der Leitung von Liu Yujuan und Zhao Gang, Forscher am Nationalen Astronomischen Observatorium der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, nutzte das 2,16-Meter-Teleskop an der Xinglong-Station des Nationalen Astronomischen Observatoriums und das 1,88-Meter-Teleskop am Okayama-Observatorium in Japan, um mithilfe der Radialgeschwindigkeitsmethode einen Planeten in Richtung des Sternbilds Leier zu entdecken. Dies ist ein Gasplanet, der einen Roten Riesen umkreist, 440 Lichtjahre von der Erde entfernt, mit der 2,7-fachen Masse des Jupiters. ▲Dieser Exoplanet (HD173416 b) befindet sich in Richtung des Sternbilds Leier. Die Matrix aus dichten grünen Punkten im Bild ist das Sichtfeld des Kepler-Teleskops (Bildnachweis: Universität Kyoto) Obwohl auf diesem Planeten keine lebensfreundlichen Umweltbedingungen herrschen, ist er als erster von chinesischen Astronomen entdeckter Exoplanet ein wichtiger Meilenstein in der Weltraumforschung meines Landes. Zunächst wurde dem Planeten von den Astronomen nur ein monotoner Code zugewiesen: HD173416 b. Doch mehr als zehn Jahre nach seiner Entdeckung erhielt es eine stärkere „chinesische Farbe“. Im Jahr 2019 wurde das von der Internationalen Astronomischen Union (IAU) organisierte globale Aktivitätsprojekt „Benennung von Exoplaneten“ ins Leben gerufen. Im Rahmen des Projekts werden den einzelnen Ländern 112 unbenannte Exoplaneten zugewiesen und in jedem zugewiesenen Land werden Nominierungs- und Abstimmungsaktivitäten durchgeführt, um diesen Planeten offizielle Namen zu geben. HD173416 b wurde seinem Entdecker China zugewiesen. Eine Zeit lang löste die Benennung von Exoplaneten in der heimischen astronomischen Gemeinschaft und bei Enthusiasten einen wahren Hype aus, und aus dem ganzen Land flogen den Gutachtern wie Schneeflocken die Benennungspläne in die Hände. Nach mehreren Runden der Expertenbegutachtung und Online-Abstimmung erhielten dieser Exoplanet und sein Mutterstern schließlich die beiden poetischen mythologischen Namen „Wangshu“ bzw. „Xihe“ und wurden in die Geschichte der Weltraumforschung auf eine Weise aufgenommen, die durchaus repräsentativ für die traditionelle chinesische Kultur ist. ▲ Im Dezember 2019 stellte Xu Yipeng, der damalige Präsident des Astronomieclubs der Mittelschule Nr. 6 in Guangzhou, der „Xihe“ und „Wangshu“ nannte, die Namensgeschichte im Pekinger Planetarium vor (Fotoquelle: Kunde der People's Daily). Im selben Jahr wurden bei der Erforschung von Exoplaneten in meinem Land erneut bahnbrechende Fortschritte erzielt. Das Team von Zhang Hui und Zhou Jilin von der Universität Nanjing gab bekannt, dass es mit Hilfe des von meinem Land an der Kunlun-Station in der Antarktis errichteten „Antarctic Survey Telescope Array“ (AST3) die „Transitmethode“ verwendet habe, um insgesamt 222 Exoplanetenkandidaten zu entdecken, von denen 116 Kandidaten mit hoher Wahrscheinlichkeit seien. Dies ist das erste Mal, dass mein Land seine eigene Beobachtungsausrüstung verwendet hat, um gruppenweise Exoplanetenkandidaten zu entdecken. Eine derart große Zahl an Entdeckungen hat nicht nur die Bibliothek planetarischer Proben aus der menschlichen extraterritorialen Erkundung erheblich bereichert, sondern auch die Stimme meines Landes auf dem Gebiet der Exoplaneten gestärkt. Derzeit besteht noch eine große Lücke zwischen der Erforschung von Exoplaneten in meinem Land und der der fortschrittlichen europäischen und amerikanischen Länder. Gu Shenghong glaubt, dass sich diese Lücke hauptsächlich in zwei Aspekten manifestiert. Erstens ist die Zahl der entdeckten und bestätigten Exoplaneten zu gering. Bislang hat mein Land die Existenz von insgesamt weniger als 20 Exoplaneten bestätigt. Zweitens ist die Forschung zu entdeckten Exoplaneten aufgrund des Mangels an großen optischen Teleskopen nicht sehr gründlich. ○ ○ ○ Erde 2.0: Auf Keplers Schultern Derzeit verlässt sich die astronomische Gemeinschaft meines Landes hauptsächlich auf erdgebundene Geräte, um die Exoplanetenforschung voranzutreiben. Beim Blick vom Boden in den Sternenhimmel sind das Sichtfeld und die Beobachtungsgenauigkeit jedoch durch die komplexen klimatischen Bedingungen in der Atmosphäre stark eingeschränkt. Um künftig nicht mehr von ausländischen, weltraumgestützten Erkennungsmethoden abhängig zu sein, muss mein Land seine eigenen „Augen und Ohren“ im Weltraum stationieren und seine Erkundungsvision auf den Weltraum ausweiten. Aus diesem praktischen Bedürfnis heraus ist das geplante Projekt „Erde 2.0“ entstanden. Darüber hinaus wirken sich auch die Mängel der Transitbeobachtungsmethode selbst auf die Beobachtungsergebnisse aus. Gu Shenghong erklärte Reportern: „Transitbeobachtungen erfordern einen relativ langen Zeitraum und Keplers eigene Betriebszeit ist relativ kurz, was zu einem unzureichenden Zeitfenster für Transitbeobachtungen führt.“ Darüber hinaus ist das Auftreten des Transitphänomens selbst ein Ereignis mit geringer Wahrscheinlichkeit und das erzeugte Signal ist sehr schwach – diese Umstände haben die Beobachtungsergebnisse von Kepler stark eingeschränkt. ▲Folmalagh b (auch bekannt als „Dagon“), etwa 25 Lichtjahre von der Erde entfernt, ist einer der frühesten Exoplaneten, der direkt durch Bilder bestätigt wurde. Neuere Erkenntnisse lassen jedoch darauf schließen, dass es sich lediglich um eine Staubwolke handeln könnte (Quelle: NASA) Obwohl das Kepler-Projekt bemerkenswerte Ergebnisse erzielt hat, konnte die Mission bis zum Ende ihr Kernziel – die Suche nach einem weiteren erdähnlichen Planeten, auf dem Leben möglich ist – leider nicht erreichen. Dies hängt eng mit den Hardware-Mängeln des Kepler-Teleskops zusammen: So ist beispielsweise das Sichtfeld des Teleskops selbst zu klein und das Instrumentenrauschen zu hoch. Aufgrund der enormen Kosten von Projekten zur Erforschung des extrasolaren Weltraums und der Auswirkungen des unzureichenden Budgets der NASA wurde das Kepler-Projekt schließlich vom Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS)-Projekt übernommen, das von SpaceX in Auftrag gegeben wurde. Im Vergleich zur Kepler-Sonde, die nur mit einem Schmidt-Teleskop ausgestattet ist, verfügt die TESS-Sonde über vier Weitwinkelteleskope, wodurch sie über ein größeres Beobachtungsfeld als das Kepler-Teleskop verfügt. ▲Imaginäres Bild der Raumsonde TESS (Bildquelle: NASA) Im Rahmen des Projekts „Erde 2.0“ meines Landes könnten künftige im Inland produzierte Sonden mit bis zu sieben Teleskopen ausgestattet werden, die durch eine beispiellose Kombination der „Transitmethode“ und der „Mikrolinsenmethode“ eine umfassende „Volkszählung“ der Exoplaneten durchführen werden. Darunter werden sechs Teleskope mit einer Öffnung von 30 cm und einem Beobachtungsfeld von 500 Quadratgrad die „Transitmethode“ für Beobachtungen verwenden, und der Erfassungsbereich wird ebenfalls im Bereich von Schwan bis Leier gesperrt. Im Vergleich zu seinen „Vorgängern“ wie Kepler und TESS werden seine Erkennungstiefe und -klarheit jedoch erheblich verbessert. Ein weiteres 4 Quadratgrad großes Teleskop wird seinen Erfassungswinkel auf die zentrale Region der Milchstraße richten und mithilfe einer neuen Mikrolinsen-Beobachtungsmethode „wandernde Planeten“ erkennen und erfassen, die nicht zum Planetensystem des Hauptsterns gehören. Leiter des „Earth 2.0“-Teams ist der Forscher Ge Jian vom Shanghai Astronomical Observatory der Chinesischen Akademie der Wissenschaften. Im Jahr 2006 leitete er während seiner Lehrtätigkeit am Institut für Astronomie der University of Florida ein Forschungsteam, das in 100 Lichtjahren Entfernung einen gasförmigen Exoplaneten entdeckte. Im Jahr 2018 leitete er das Projekt „Dharma Exoplanet Survey“ an der University of Florida und entdeckte erfolgreich einen massiven erdähnlichen Planeten in 16 Lichtjahren Entfernung, der den Stern 40 Eridanus umkreist. Im Jahr 2020 kehrte Ge Jian nach China zurück und trat dem Shanghai Astronomical Observatory bei. Das von ihm geleitete Projekt „Earth 2.0“ brachte über 200 Astronomen von über 30 Universitäten und Forschungseinrichtungen im In- und Ausland zusammen. In Zukunft werden die durch dieses Projekt gewonnenen Beobachtungsdaten auch weltweit geteilt – Chinas „Erde 2.0“ hat von Anfang an nationale Grenzen überschritten und wurde ins Leben gerufen, um die menschliche Erforschung des Universums zu fördern. Dem Plan zufolge soll „Earth 2.0“ den Bau und Start des Satelliten bis Ende 2026 abschließen und im Sommer des folgenden Jahres mit wissenschaftlichen Beobachtungen beginnen. Wissenschaftler schätzen, dass das Projekt nach Abschluss eines Zyklus von Beobachtungsmissionen (vier Jahre) voraussichtlich 5.000 Exoplaneten finden wird, darunter auch Planeten, die wirklich für Leben geeignet sind. Mit der starken Unterstützung des Landes und den konzertierten Anstrengungen der astronomischen Gemeinschaft wird das Projekt „Earth 2.0“ voraussichtlich einen leuchtenden chinesischen Akzent bei der Erforschung von Exoplaneten setzen. Produziert von: Science Central Kitchen Produziert von: Beijing Science and Technology News | Pekinger Wissenschafts- und Technologiemedien Willkommen zum Teilen mit Ihrem Freundeskreis Die Vervielfältigung ohne Genehmigung ist verboten |
>>: Sie waren in diesem Jahr in ihrer Blütezeit ... Ein Hoch auf ihre Jugend!
Artikel empfehlen
Ein Erdbeben der Stärke 5,5 erschütterte Shandong am frühen Morgen mit mehr als 50 Nachbeben! Wie kann man bei einem Erdbeben effektiv entkommen und sich auf wissenschaftlich fundierte Weise in Sicherheit bringen?
Das China Earthquake Networks Center stellte offi...
Was sind die Vorteile von Sit-ups?
Heutzutage wollen nicht nur Freundinnen einen per...
Wassermelone oder Weintrauben? Weder noch, es ist Stachelbeere!
„Er konnte sich ein Herrenhaus, einen Ort der Poe...
Leiden Sie unter „Schlafenszeit-Aufschieberitis“? Ich habe gehört, dass es bei Frauen schlimmer ist als bei Männern!
„Ich schaue noch mal bei Weibo vorbei, ob es da s...
Wie kann man am besten den Po straffen und die Brüste vergrößern?
Viele Menschen, insbesondere Frauen, legen Wert a...
Sie können den Unterschied zwischen DNA, Genen und Chromosomen nicht erkennen? Ein Bild hilft Ihnen beim Verständnis
Mit der rasanten Entwicklung der Biowissenschafte...
Was kann Kohlendioxid außer der Umwandlung in Stärke noch werden? Es stellte sich heraus, dass es ein Stein war!
Popular Science Times (Praktikant Wang Yuke) Mikr...
Welche Übungen gibt es zum Schultertraining?
Normalerweise machen viele unserer Freunde Fitnes...
Die Schnittlauchknödel, die Gu Ailing während der Spielpause aß, wurden beliebt! Schnittlauch: Ich bevorzuge gebratenen Speck, gefolgt von gebratenem getrocknetem Tofu
Am Morgen des 14. Februar nahm Gu Ailing am Quali...
Von der Berühmtheit über Nacht bis zur Euthanasie: Was hat das Walross Freya in ihrem Leben erlebt?
Im Meer schwimmen, tauchen, um Meeresfrüchte zu e...
Bewertung von 500 Millionen auf 79 Millionen: Wie kam es zum Rückgang von 56.com?
Den neuesten Nachrichten zufolge wird Sohu 56.com...
Wann sollten Sie Schlankheits-Yoga praktizieren?
Unsere Freundinnen von heute legen alle großen We...
Dringende Erinnerung! Es nähern sich „Doppeltaifune“ und ihre Intensität könnte die Erwartungen übertreffen! Wie kann man wissenschaftlich reagieren und vorbeugen?
Das Zentrale Meteorologische Observatorium gab ei...
Warum versetzt das rosa Muhly Grass, eine beliebte Internetberühmtheit aus dem Ausland, die Welt in Erstaunen?
Seit Kurzem ist die beste Zeit, um das rosa Muhly...