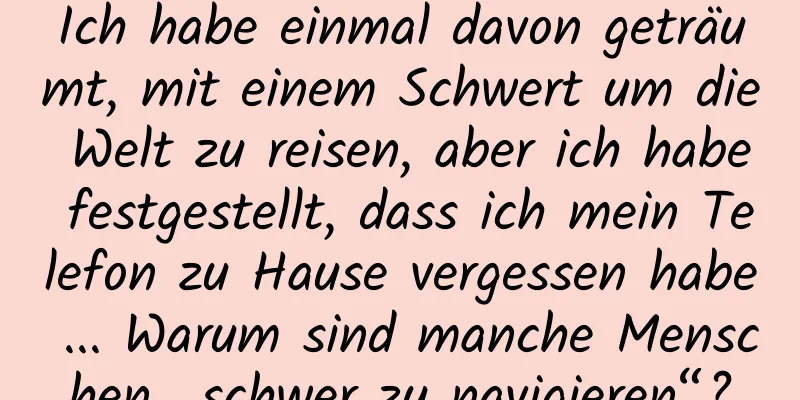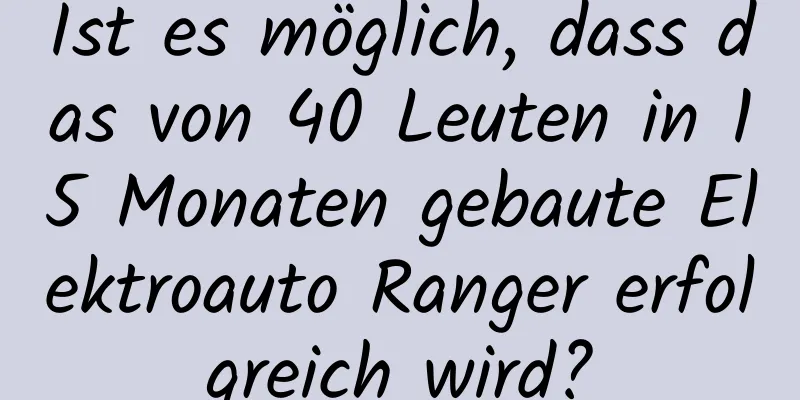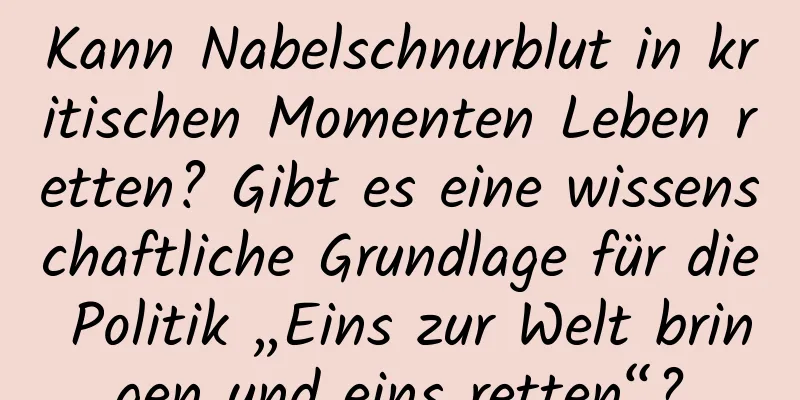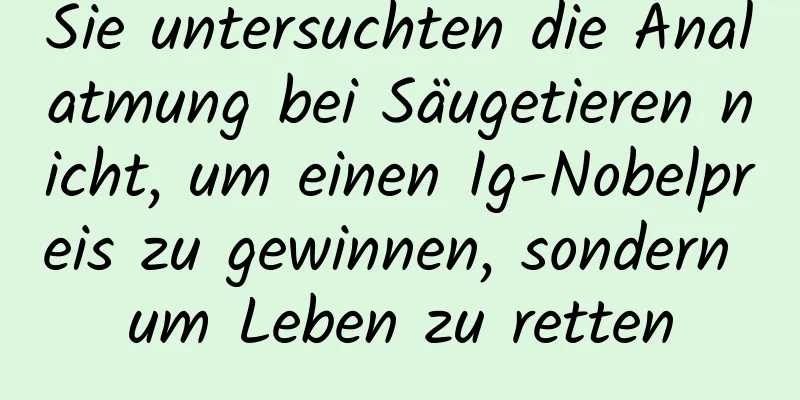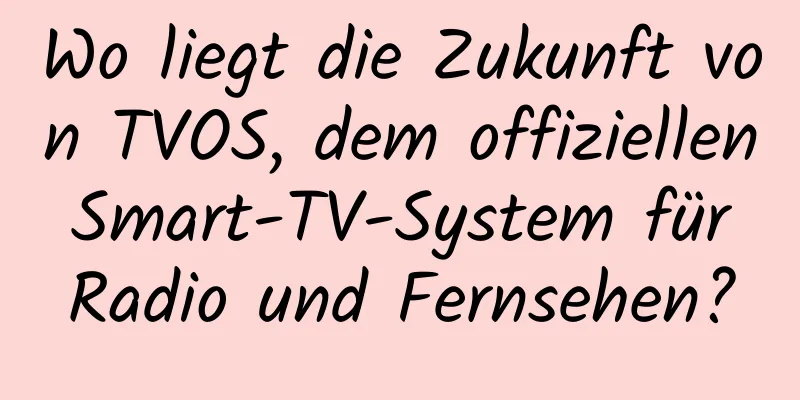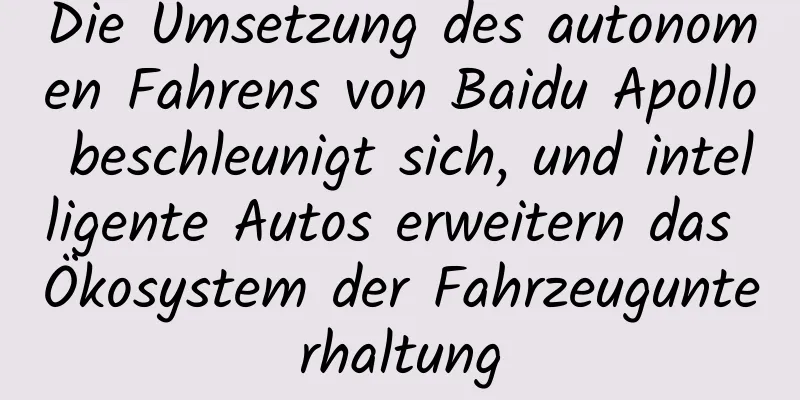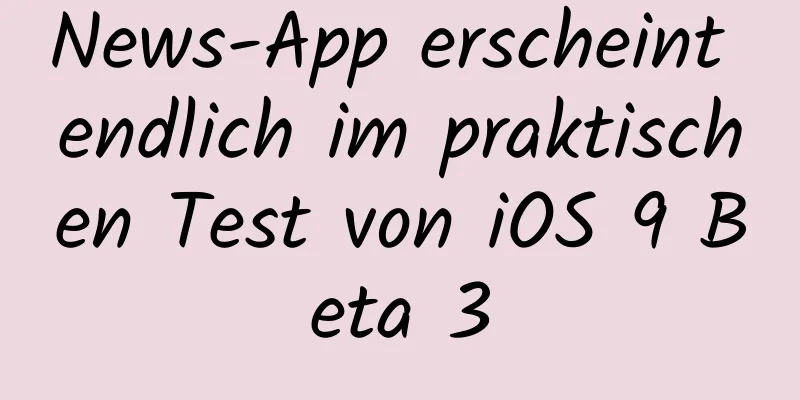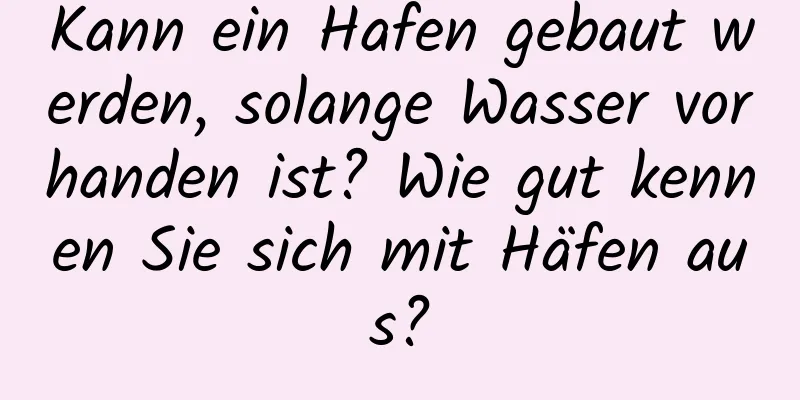Sind Viren wirklich lebendig?
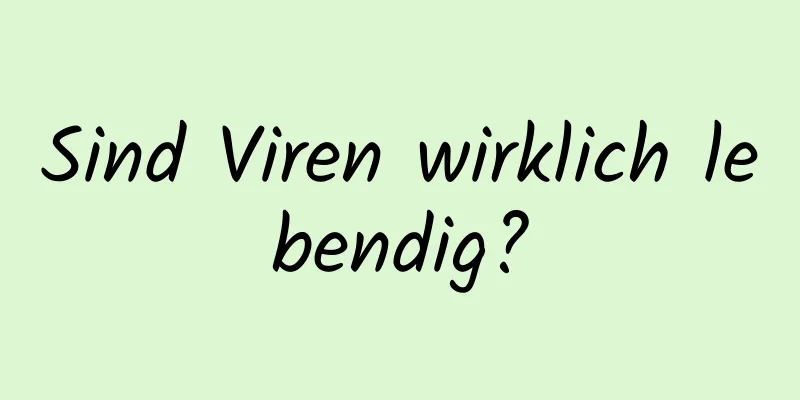
|
© Vox Leviathan Press: Angesichts der kurzen Geschichte der menschlichen Zivilisation kann unser Verständnis von Viren als eine sehr junge Sache angesehen werden. Doch auch heute noch wird darüber diskutiert, ob Viren Leben bedeuten. Darüber hinaus haben Menschen, die sich ein wenig mit Viren auskennen, wahrscheinlich äußerst unterschiedliche Gefühle gegenüber diesen seltsamen Dingen, die mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind: Obwohl die meisten Viren relativ harmlos sind, gibt es immer welche, die sehr tödlich sind … Lassen Sie mich Ihnen etwas Lustiges erzählen. Das Bild unten zeigt kein Virus, sondern das Flagellum eines Bakteriums. Das stimmt, wie auf dem Bild zu sehen ist, entspricht die Funktion der Flagellen der eines Schiffspropellers, der sich in der Umgebung mit hoher Geschwindigkeit drehen kann und so die Bakterien vorwärts treibt. Vergrößert man die innere Struktur von Bakterien um das 50.000-fache, stellt man fest, dass sich hinter ihrer Rotation ein äußerst komplexes System verbirgt, das dem Motor eines Schiffes ähnelt und aus exquisiten Maschinenteilen wie rotierenden Wellen und Propellern besteht. Diese Komponenten werden für die Gesamtfunktion in geordneter Weise zusammengebaut und jede Komponente erfüllt ihre jeweilige funktionale Rolle. Diese Kombination ist kein blindes, zufälliges Flickwerk, sondern eine exquisite Mikrotechnik. Die Rolle dieser Komponenten übernehmen 40 verschiedene Arten von Protein-Molekülmaschinen. Einige dieser Moleküle beziehen ihre Energie aus der Umgebung, andere sind für die Sensorik zuständig und wieder andere sind wie Lager für die Rotation verantwortlich, wobei jedes Molekül seine eigene Funktion erfüllt. Manche Leute glauben, dass der Betrieb dieses gesamten Systems offensichtlich ein hochintelligentes und hochentwickeltes Mikrotechnikprojekt ist. Es lässt sich nicht durch einfache darwinistische Evolutionsmechanismen erklären. In den letzten zwei Jahren hat SARS-COV2, besser bekannt als COVID-19, die Welt verwüstet, mehr als 346 Millionen Menschen infiziert und 5,58 Millionen Menschen getötet. Alle Industrien warten darauf, entwickelt zu werden, viele Länder schließen ihre Grenzen und unser Leben hat sich völlig verändert. Es ist demütigend, wenn man darüber nachdenkt, wie schwer es für den Menschen ist, diesen Erreger zu bekämpfen, der kleiner ist als die meisten Bakterien. Noch peinlicher ist, dass der Erreger möglicherweise gar nicht lebendig ist. Anders als andere Krankheitserreger wie Bakterien, Protozoen und Pilze befinden sich Viren in einer Grauzone zwischen Lebewesen und Nicht-Lebewesen und es gibt unterschiedliche Meinungen darüber, auf welcher Seite sie einzuordnen sind. Es handelt sich um eine heftige und langwierige Debatte, die eine der grundlegendsten Fragen der Biologie aufwirft: Was genau ist „Leben“? Sind Viren also eine Lebensform? Lass es uns herausfinden! Um zu verstehen, ob Viren Lebewesen sind, müssen wir zunächst verstehen, was Viren sind. Viruserkrankungen wie Pocken, Tollwut, Kinderlähmung und Grippe gibt es seit Anbeginn der Menschheit, doch erst in den letzten Jahren haben Wissenschaftler die spezifischen Erreger, die diese Krankheiten verursachen, wirklich verstanden. Als Mitte des 19. Jahrhunderts die Keimtheorie, vorgeschlagen von Robert Koch, Louis Pasteur und anderen, Fortschritte machte, machten sich Wissenschaftler daran, den Erreger aller bekannten Krankheiten zu suchen und zu isolieren. Hierzu zählt das Tabakmosaik, eine Krankheit, die das Wachstum der Tabakpflanzen hemmt und dazu führt, dass ihre Blätter ein fleckiges „Mosaikmuster“ entwickeln. Im Jahr 1892 zermahlte der russische Botaniker Dmitri Ivanovsky infizierte Tabakpflanzen, filterte den Saft durch einen Keramikfilter, dessen Poren zu klein waren, als dass Bakterien hindurchgelangen konnten, und impfte den gefilterten Saft auf nicht infizierte Pflanzen. Zu seinem Schock waren auch diese Pflanzen anfällig für die Krankheit. Ivanovsky vermutete, dass die Krankheit durch ein chemisches Gift verursacht werden könnte, das den Filter passieren könnte, ging der Ursache jedoch nicht näher nach. Martinus Beijerinck (1851-1931). © Wikimedia Commons Sechs Jahre später wiederholte der niederländische Mikrobiologe Martinus Beijerinck das Experiment und bestätigte das gleiche rätselhafte Ergebnis. Er ging bei dem Experiment jedoch noch einen Schritt weiter. Nachdem er eine Pflanze infiziert hatte, zerdrückte Beijerinck ihre Blätter, filterte den Saft und infizierte die nächste Pflanze, und der Zyklus wiederholte sich. Er schlussfolgerte, dass die Wirksamkeit des Erregers, wenn es sich um ein Toxin handele, mit zunehmender Verbreitung von Pflanze zu Pflanze nachlassen würde. Doch egal, wie oft er die Krankheit verbreitete, ihre Wirksamkeit bliebe unverändert. Zunächst dachte er, der Krankheitserreger sei lediglich ein überraschend kleines Bakterium, doch so sehr er es auch versuchte, es gelang ihm nicht, es in einer Kultur – der Standardmethode zur Züchtung von Bakterien im Labor – zum Wachsen zu bringen. Es ist auch unempfindlich gegenüber Alkohol, der fast alle bekannten Bakterien abtötet. Noch seltsamer ist, dass dieser rätselhafte Erreger anscheinend nur in Gegenwart lebender, sich teilender Zellen wächst und vermehrt. Da der pathogene Faktor noch nicht klar war, nannte Beijerinck es „ansteckende lebende Flüssigkeit“ und später „filtrierbares Virus“. Das Wort „Virus“ bedeutet auf Lateinisch Gift. In den folgenden Jahrzehnten entdeckten Wissenschaftler mithilfe von Keramikfiltern immer mehr Viren. Sie entdeckten 1898 das Maul- und Klauenseuchevirus, das die Maul- und Klauenseuche verursacht, 1932 das Gelbfiebervirus und das Tollwutvirus. Der erste wirkliche Durchbruch im Verständnis der Natur von Viren kam erst 1935. Wendell Stanley (1904–1971) glaubte, dass das Tabakmosaikvirus eine körnige Substanz sei, die vollständig aus Protein bestehe. © Sutori Der amerikanische Chemiker Wendell Stanley glaubte damals, das Tabakmosaikvirus sei eine körnige Substanz, die vollständig aus Proteinen bestehe, und nicht die Flüssigkeit, die Beijerinck vermutet hatte. Stanley gelang es sogar, die Viruspartikel zu nadelförmigen Kristallen aufzureinigen, sodass sie im Labor über einen langen Zeitraum gelagert werden konnten, ohne dass ihre infektiöse Wirksamkeit nachließ. Wie die New York Times 1940 berichtete, löste die Entdeckung Schockwellen in der wissenschaftlichen Gemeinschaft aus: Dr. Wendell Stanley vom Rockefeller Institute for Medical Research hat das Tabakmosaikvirus kristallisiert und damit die Biologen in Aufruhr versetzt. Und das zu Recht. Sind diese Kristalle lebendig? Offensichtlich nichts Besonderes als Diamanten, Glas, Sand oder andere uns bekannte Kristalle. Und doch verbreitet sich die Mosaikkrankheit, wenn diese Viruskristalle auf Tabakblätter gelegt werden, wie ein Funke, der sich über ein Präriefeuer ausbreitet, ganz so, als ob sie von einem lebenden Bakterium infiziert worden wären. Stanleys Entdeckung, die ihm 1946 den Nobelpreis für Chemie einbrachte, schien das Ende der jahrhundertealten Theorie des Vitalismus zu bedeuten. Diese besagte, dass Organismen eine Art Lebensessenz oder „göttliches Licht“ enthielten, aus dem Leben entsteht. Im Gegensatz dazu ging die chemische Hypothese des Lebens davon aus, dass es sich lediglich um einen chemischen Prozess handelte, und Stanleys Entdeckung, dass sich scheinbar inerte Proteinpartikel wie lebende Organismen vermehren und ausbreiten konnten, schien diese Hypothese zu bestätigen. © PLOS Es gibt jedoch noch viele ungelöste Rätsel. Mit der Erfindung des Elektronenmikroskops, die im selben Jahr wie Stanleys Entdeckung erfolgte, war es erstmals möglich, Viren visuell zu beobachten. Damit wurde klar, warum sich Mikrobiologen ihnen so lange entzogen hatten. Der Durchmesser der meisten Viruspartikel beträgt etwa 100 nm, also 1/100 bis 1/10 des Durchmessers von Bakterien, was die Beobachtung durch ein gewöhnliches optisches Mikroskop erschwert. Dies erklärt jedoch nicht, warum ein gewöhnliches Proteinpartikel, obwohl es über Vitalität verfügt, unter Laborbedingungen nicht wachsen kann. Im Jahr 1926 schlug der amerikanische Mikrobiologe Thomas Rivers in einem Bericht an die American Bacteriological Society eine Erklärung vor: „Das Virus scheint ein obligater Parasit zu sein, der für seine Reproduktion auf lebende Zellen angewiesen ist.“ Mit anderen Worten: Viren vermehren sich nicht durch Zellteilung wie Bakterien, Protozoen, Pilze und andere Mikroorganismen, sondern sie kapern die molekulare Maschinerie anderer lebender Zellen, um mehr Viruspartikel zu produzieren. Aber wie gelingt dem Virus diese Entführung? Es stellt sich heraus, dass das größte Puzzleteil noch immer fehlt. Wendell Stanleys nachfolgende Forschungen ergaben, dass das Tabakmosaikvirus nicht nur aus Proteinen besteht, sondern tatsächlich auch Ribonukleinsäure oder RNA enthält. In den 1930er und 1940er Jahren gab es in der wissenschaftlichen Gemeinschaft eine große Debatte darüber, wie genetische Merkmale in Organismen von Generation zu Generation weitergegeben werden. Obwohl die Gesetze der Vererbung in den 1860er Jahren vom tschechischen Priester Gregor Mendel entdeckt und im frühen 20. Jahrhundert von den amerikanischen Biologen Thomas Hunt Morgan und Hermann Muller verfeinert wurden, waren die spezifischen Moleküle, die spezifische genetische Informationen kodieren und weitergeben, noch immer unbekannt. Einige Wissenschaftler spekulieren, dass RNA und ihre Schwester DNA genetisches Material sein könnten. Die meisten Menschen glauben jedoch, dass es sich bei genetischem Material eher um Proteine handelt, da diese eine komplexere Struktur aufweisen und daher mehr genetische Informationen speichern können. Viren spielen eine wichtige Rolle bei der Bestimmung, welche Hypothese richtig ist. Martha Chase (links) und Alfred Hershey im Jahr 1953. © PaulingBlog/Karl Maramorosch Im Jahr 1952 führten die amerikanischen Bakteriologen Alfred Hershey und Martha Chase eine Reihe von Experimenten mit dem Bakteriophagen T2 durch, einem Virus, das Escherichia coli infiziert. Diese Experimente gelten heute als Klassiker. Damals wussten die Wissenschaftler, dass das Virus einen Teil seines eigenen Materials in die Wirtszelle injizieren und den Rest außerhalb des Körpers zurücklassen würde. Die Frage ist jedoch: Handelt es sich bei dem injizierten Teil um Nukleinsäure oder Protein? Um dies herauszufinden, markierten Hershey und Chase ein Kulturmedium von Zellen mit radioaktivem Schwefel, sodass nur die Proteine in der Virencharge radioaktiv markiert wurden. Eine weitere Virencharge wurde in Gegenwart von radioaktivem Phosphor kultiviert, was dazu führte, dass nur der Nukleinsäureanteil der Viren markiert wurde. Die beiden Viruschargen wurden dann verwendet, um unmarkierte E. coli zu infizieren. Die Forscher schleuderten die anschließende Kultur durch eine Zentrifuge, um die infizierten Bakterien und die verworfenen nicht-kodierenden Teile des Virus zu trennen. Als die beiden Wissenschaftler die infizierten Zellen auf Radioaktivität testeten, stellten sie fest, dass die Bakterien in den mit Phosphor markierten Gruppen radioaktiv waren, während die Bakterien in den mit Schwefel markierten Gruppen nicht radioaktiv waren. Dies bestätigt auch, dass es sich bei dem, was das Virus in die Bakterien injiziert, eher um Nukleinsäure als um Protein handelt. Später erklärten Wissenschaftler wie Rosalind Franklin, James Watson und Francis Crick die Struktur und Funktion von DNA und RNA und leiteten damit eine genetische Revolution ein, die die Welt noch heute beeinflusst. Eine Computersimulation der Struktur des Coronavirus (SARS-CoV-2). © Janet Iwasa/Universität von Utah Heute ist bekannt, dass alle Viren aus zwei Grundbestandteilen bestehen: einer Sequenz, die der DNA oder RNA ähnelt, und einer Proteinhülle, dem Kapsid. Der britische Biologe Sir Peter Medawar drückte es prägnant aus: „(Ein Virus) ist nur eine in Protein verpackte Fehlinformation.“ Die Formen und Größen von Viren variieren stark, vom porcinen Circovirus mit einem Durchmesser von etwa 27 nm bis zum breitmäuligen Potvirus mit einer Länge von etwa 1,5 μm; vom langröhrenförmigen Tabakmosaikvirus bis zum kugelförmigen Coronavirus. Zusätzlich zu einer Proteinhülle besitzen viele Viren eine Lipidhülle, die sie von Wirtszellen übernehmen. Der Lebenszyklus von Viren beginnt in dem Moment, in dem sie in eine Wirtszelle eindringen und mit ihrer Zellmembran in Kontakt kommen. Wenn eine Zelle für das Virus anfällig ist, heftet sich das Virus an ihre Oberfläche, injiziert genetisches Material und einige Enzyme wie eine Mikrospritze in das Zytoplasma der Zelle und verlässt ihre Kapsid. Sobald das genetische Material des Virus in eine Zelle eingedrungen ist, beginnt es, seine bösartigen Zähne zu zeigen, indem es den Stoffwechselapparat der Zelle kapert und sie von einem unabhängigen Organismus in eine kleine biologische Fabrik verwandelt, die nur einem Zweck dient: der Produktion weiterer Viruspartikel. Viren können diesen Entführungsprozess auf verschiedene Weise durchführen. Animation der Verschmelzung von Coronaviren mit Zellen. © Janet Iwasa/Universität von Utah Im Fall eines DNA-Virus ersetzt sein genetisches Material die zelleigene DNA und verwendet zelleigene Enzyme, um das eindringende Genom in Messenger-RNA oder mRNA zu transkribieren. Die mRNA wird dann von zellulären Organellen, den sogenannten Ribosomen, gelesen, die die genetischen Anweisungen verwenden, um Aminosäuren zu Proteinen zusammenzusetzen. Die Ribosomen produzieren nicht mehr die normalen Proteine, die für die ordnungsgemäße Funktion der Zellen erforderlich sind, und werden zu Initiatoren neuer Viren. RNA-Viren hingegen enthalten mRNA, die direkt vom Ribosom gelesen werden kann, wodurch der DNA-Transkriptionsschritt vollständig übersprungen wird. Dann gibt es noch das Retrovirus, das über einen noch raffinierteren genetischen Trick verfügt. Retroviren, darunter auch HIV, enthalten ein spezielles Enzym, die Reverse Transkriptase, das die virale RNA in die DNA der Wirtszelle integrieren kann. Dieses eingebettete virale Genom wird als Provirus bezeichnet. Es kann lange Zeit im Genom des Wirts inaktiv bleiben, der Überwachung durch das Immunsystem entgehen und sich unbemerkt zwischen Zellen ausbreiten, während sich die Zellen teilen und vermehren. Sie können auch spontan aktiviert werden, wodurch die Zelle erneut mit der Virenproduktion beginnt. Dadurch sind die Menschen einer Infektion mit Retroviren hilflos ausgeliefert. Hautausschlag ist ein häufiges Symptom einer HIV-Infektion. © WebMD Die Bedeutung der Retroviren für den Menschen geht jedoch weit über die von ihnen verursachten Krankheiten hinaus. In der langen Geschichte der menschlichen Evolution wurden bis zu 8 % der menschlichen Gene von Protoviren übernommen. Offensichtlich hatten diese genetischen Anhalter einen wichtigen und nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf die Entwicklung des Lebens auf der Erde. (www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7093845/) Sobald die neuen Viruspartikel zusammengesetzt sind, müssen sie als nächstes die Wirtszelle verlassen. Viele Viren, die Bakterien oder andere einzellige Organismen infizieren, erreichen dies durch einen lytischen Zyklus. Bei diesem Vorgang reißt oder löst sich die Zellmembran auf, die Wirtszelle stirbt ab und setzt eine neue Virengeneration in die Umwelt frei. Tötet ein Virus jedoch eine Zelle, auf die es trifft, führt dies schnell zum Tod des Wirtes und des darin befindlichen Virus. Daher verlassen die meisten Viren die Zelle durch Exozytose oder „Knospung“ und passieren die Zellmembran, ohne sie zu zerstören. Doch so oder so ist das Endergebnis dasselbe: Neu zusammengesetzte Viren werden in die Umwelt freigesetzt, bereit, neue Zellen zu infizieren und den Prozess von vorne zu beginnen. ﹡﹡﹡ Nachdem wir nun wissen, was Viren sind und wie sie sich vermehren, kommen wir zurück zur ursprünglichen Frage: Sind Viren tatsächlich lebendig? Wie bei vielen Fragen in der Biologie hängt die Antwort davon ab, wie genau wir Leben definieren. Die Besonderheit der Biologen liegt darin, dass in der wissenschaftlichen Gemeinschaft kein Konsens darüber besteht, was sie eigentlich untersuchen. Auf den ersten Blick erscheint die Frage, ob etwas lebendig ist, ziemlich intuitiv. Doch selbst die größten Wissenschaftler und Philosophen waren im Laufe der Geschichte nicht in der Lage, eine strenge und überprüfbare Definition des Lebens zu geben. Der Konsens, zu dem wir gelangen können, lässt sich im Wesentlichen mit „Sehen ist Glauben“ zusammenfassen. Das Fehlen dieser Definition hinderte die Biologen jedoch nicht daran, ihre Forschung fortzusetzen, und viele Jahre lang blieb die Diskussion über die Definition kaum mehr als eine philosophische Kuriosität. Als die Menschen jedoch begannen, das Universum zu erforschen und nach Leben auf anderen Planeten zu suchen, stellte sich die Frage: „Was ist Leben?“ wurde plötzlich wichtig. © Baamboozle Im Laufe der Jahre haben verschiedene Wissenschaftler versucht, eine Liste der einzigartigen Eigenschaften des Lebens zu erstellen. Hier ist eines von der NASA: [Lebewesen] besitzen die Fähigkeit, Energie aus ihrer Umgebung aufzunehmen und in Energie für ihr eigenes Wachstum und ihre Fortpflanzung umzuwandeln. Lebewesen tendieren zur Homöostase: einem Gleichgewicht zwischen den vielen Elementen, die ihre innere Umgebung bestimmen. Lebewesen können auf Reize reagieren, indem sie reaktionsähnliche Handlungen wie Rückzug oder sogar fortgeschrittenere Formen wie Lernen ausführen. Lebewesen sind reproduktiv, und die Evolution erfordert aufgrund von Mutationen in Populationen und natürlicher Selektion ein gewisses Maß an Replikation. Um zu überleben und zu gedeihen, müssen Lebewesen zunächst zu „Konsumenten“ werden, Biomasse austauschen, neue Individuen erschaffen und Abfallprodukte ausscheiden.“ Allerdings weisen auch viele nicht lebende Systeme viele der oben genannten Eigenschaften auf. Beispielsweise können Kristalle spontan erstaunlich komplexe und geordnete Formen annehmen, sich selbst replizieren, die gleiche innere Struktur von einem Kristall auf einen anderen übertragen und sich sogar als Reaktion auf äußere Reize bewegen. Ebenso kann ein schwarzer Stein Sonnenenergie in Wärme umwandeln, die er durch Erwärmung der umgebenden Luft in kinetische Energie umwandeln kann, während seine radioaktiven Bestandteile auch spontan Kernenergie in Wärme umwandeln können. Horta, das Felswesen aus Star Trek. © Tumblr Die obige Definition wird noch anfälliger, wenn sie auf die biologische Welt angewendet wird. Prionen sind beispielsweise der Erreger der bovinen spongiformen Enzephalopathie (besser bekannt als Rinderwahnsinn). Sie sind sogar noch einfacher aufgebaut als gewöhnliche Viren, da sie nur aus einem fehlgefalteten Protein bestehen und kein genetisches Material enthalten. Prionen können jedoch mutieren und zwischen Arten übertragen und reproduziert werden – allerdings nicht durch genetische Informationen, sondern indem sie eine Fehlfaltung benachbarter Proteine verursachen und so eine tödliche Kettenreaktion auslösen. Erwin Schrödinger (1887-1961). © Times Literary Supplement Und Erwin Schrödinger, der österreichische Physiker, der für die Idee bekannt ist, eine imaginäre Katze in eine imaginäre Kiste zu stecken, schlug eine Reihe von Eigenschaften vor, die nur komplexeren Lebensformen eigen sind. In seinem 1944 erschienenen Buch „Was ist Leben?“ In seinem Buch „Was ist Leben?“ stellt Schrödinger fest: „Organismen haben die erstaunliche Gabe, ihren eigenen ‚Fluss der Ordnung‘ zu kontrollieren und so zu verhindern, dass Atome im Chaos verfallen.“ Mit anderen Worten: Lebewesen scheinen den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik zu verletzen, der besagt, dass in einem geschlossenen System die Entropie – unterschiedlich definiert als Unordnung oder Energie, die nicht zur Verrichtung nützlicher Arbeit genutzt werden kann – immer zunimmt. Angesichts der ständig zur Unordnung tendierenden Naturkräfte gelingt es Organismen nicht nur, ein hohes Maß an innerer Ordnung und Komplexität aufrechtzuerhalten, sondern diese Ordnung auch über Generationen hinweg mit geringem Verlust an Genauigkeit aufrechtzuerhalten. Ebola-Virus. © Nationales Institut für Humangenomforschung Natürlich verstoßen Lebewesen nicht wirklich gegen den zweiten Hauptsatz, da es sich bei ihnen nicht um geschlossene Systeme handelt. Es handelt sich um halbgeschlossene Systeme, die geschlossen genug sind, um die innere Ordnung aufrechtzuerhalten, aber dennoch offen genug, um sicherzustellen, dass jede Zunahme der Ordnung im Körper durch eine Abnahme der Ordnung in der äußeren Umgebung ausgeglichen wird – beispielsweise durch die Ableitung überschüssiger Wärme (um die Entropie im Organismus zu verringern und die Entropie in der Umgebung zu erhöhen). Diese Beobachtungen führten Schrödinger jedoch zu der Vermutung, dass halbgeschlossene Strukturen für das Funktionieren lebender Organismen von entscheidender Bedeutung seien. Noch wichtiger ist jedoch, dass er darüber hinaus spekulierte, dass Organismen, um ihre innere Struktur und Komplexität präzise an ihre Nachkommen weitergeben zu können, eine Art „Codeskript“ konstruieren müssen, das die Anweisungen zum Aufbau dieses spezifischen Organismus enthält. Später erfüllte sich diese vorausschauende Vorhersage in weniger als einem Jahrzehnt mit der Bestätigung der Struktur und Funktion der DNA. Herpes-simplex-Virus Typ 1 (HSV-1). © Pharmazeutische Technologie Der britische Biologe John Maynard-Smith vertrat in Anlehnung an Schrödinger die Ansicht, dass eine wesentliche Eigenschaft des Lebens darin bestehe, dass es der Prüfung der darwinistischen natürlichen Selektion standhält. Dabei werden bevorzugt genetische Merkmale ausgewählt und an die Nachkommen weitergegeben, die die Fortpflanzungsfähigkeit eines Organismus steigern. Dadurch wird sichergestellt, dass sich die Arten im Laufe der Zeit weiterentwickeln können. Dieses Konzept wurde schließlich mit früheren Definitionen kombiniert, um die sogenannte „NASA-Definition von Leben“ zu erstellen, die sich auf Folgendes bezieht: „Das Leben ist ein sich selbst erhaltendes chemisches System, das sich an die darwinistische Evolution anpassen kann.“ Viren erfüllen zweifellos die Auffassung, dass Leben auf der Grundlage adaptiver Evolution definiert wird. Die schnelle Mutation des neuen Coronavirus und die Entstehung mehrerer Varianten sind ein klarer Beweis dafür. Allerdings ist die Ansicht, dass „Viren Lebewesen sind“, hinsichtlich des ersten Punkts der Definition umstritten. Im Gegensatz zu anderen Lebensformen können sich Viren ohne andere lebende Zellen nicht vermehren. Ohne die Fähigkeit, die molekulare Maschinerie einer Wirtszelle zu kapern, ist ein Virus lediglich eine inerte Masse aus Proteinen und genetischem Material. So argumentiert Gerald Joyce vom Salk Institute: „Nach dieser grundlegenden Definition erfüllt das Virus die Kriterien nicht.“ Unabhängig davon, ob sie als Lebewesen klassifiziert werden können, ist klar, dass Viren in der natürlichen Umwelt eine wichtige Rolle spielen. Obwohl eine genaue Messung unmöglich ist, gehen Biologen davon aus, dass es weltweit etwa 10^31 Virustypen gibt. Würde man alle Viren einzeln miteinander verbinden, ergäbe sich eine Entfernung von 200 Millionen Lichtjahren. Diese Zahl ist erstaunlich – sie übersteigt die am weitesten entfernte bekannte Galaxie bei weitem. Viren kommen in allen Umgebungen der Erde vor und können alle bekannten Organismen infizieren. Allerdings ist die überwiegende Mehrheit der Viren relativ harmlos und verursacht keine bösartigen Erkrankungen. © BioCosmos Afrika Trotzdem haben sie noch immer einen erheblichen Einfluss auf die Evolution des Lebens auf der Erde, insbesondere ihre Fähigkeit, virale Gene durch reverse Transkription in die DNA des Wirtes einzufügen. Blutorangen beispielsweise verdanken ihre Existenz einem viralen Gen namens Tcs2, das auf kaltes Wetter reagiert und sich in ein Gen namens Ruby verwandelt, das der Frucht ihre charakteristische tiefrote Farbe verleiht. Näher mit uns Menschen verwandt ist ein altes Gen namens ERVW-1, das für die Bildung einer verschmolzenen Zellstruktur in der menschlichen Plazenta, dem Synzytiotrophoblasten, verantwortlich ist, der für die Übertragung von Nährstoffen auf den sich entwickelnden Embryo von entscheidender Bedeutung ist. Wir alle verdanken unsere Existenz einem Virus, das vor Millionen von Jahren afrikanische Affen infizierte. © Timo Lenzen Aus verschiedenen Gründen sind einige Wissenschaftler der Ansicht, dass die Definition des Lebens durch die NASA zu eng ist und erweitert werden sollte, um Randfälle wie Viren einzuschließen. Patrick Forterre, Mikrobiologe am Pasteur-Institut in Frankreich, ist einer von ihnen. Er glaubt: „Leben und Lebensprozesse sind lediglich Namen für die komplexen, entwickelten Formen der Materie, die derzeit auf unserem Planeten existieren.“ Fortel glaubt, dass Viren nicht nur eine Ansammlung von Proteinen und Nukleinsäuren sind, sondern vielmehr ein Organismus, der in seinem Lebenszyklus zwei verschiedene Zustände durchläuft: Viruspartikel und „Virozellen“, lebende Zellen, die von Viruspartikeln angegriffen werden und sich in lebende Zellen verwandeln, die weitere Viruspartikel produzieren. In Fortels Theorie unterscheiden sich Viruszellen völlig von normalen, gesunden Wirtszellen, den „Ribozellen“. Der Unterschied zwischen den beiden ist: „Der Traum einer normalen Zelle ist es, sich zu teilen und zwei Zellen zu produzieren, aber der Traum einer Viruszelle ist es, 100 oder sogar mehr Viruszellen zu produzieren.“ Daher verhält sich das Viruspartikel gemäß Fortelles Theorie zur Viruszelle wie der Samen zur Eiche. Viren unterscheiden sich insofern nicht von anderen Parasiten, als dass sie für ihr Wachstum und ihre Vermehrung auf Wirtszellen angewiesen sind. Das Virus ist einfach abhängiger. Andere Wissenschaftler sind der Ansicht, dass jeder Versuch, eine strenge Definition des Lebens zu finden, vergeblich sei, weil er uns daran hindern würde, die exotischen Lebensformen zu verstehen, die es bislang weder auf der Erde noch auf anderen Planeten zu entdecken gilt. Carol Cleland, Wissenschaftsphilosophin an der University of Colorado, drückt es so aus: Definitionen sagen uns lediglich, was ein Wort in unserer Sprache bedeutet, aber sie sagen uns nichts über die Natur der Welt. Im Fall des Lebens interessieren sich Wissenschaftler eher für die Natur des Lebens als für die Bedeutung des Wortes „Leben“ in unserer Sprache. Was wir wirklich tun müssen, ist eine allgemein anwendbare Theorie lebender Systeme zu entwickeln, nicht eine präzise Definition des Wortes „Leben“. Trotz seiner unzähligen Formen stellt das Leben auf der Erde nur einen Aspekt dar. Der Schlüssel zur Entwicklung einer allgemeinen Theorie lebender Systeme liegt in der Erforschung anderer Lebensmöglichkeiten. Ich bin daran interessiert, eine Strategie für die Suche nach außerirdischem Leben zu entwickeln, die es den Menschen ermöglicht, die Grenzen unseres erdzentrierten Lebenskonzepts zu erweitern. © Shira Inbar Andererseits halte ich es für sinnlos, dass Wissenschaftler unermüdlich daran arbeiten, „Leben“ zu definieren, denn es sagt uns nicht, was wir wirklich wissen wollen – „was Leben ist“. Eine wissenschaftliche Theorie des Lebens wird diese Fragen zufriedenstellend beantworten und auch in einigen Randfällen funktionieren. Es ist für die Entwicklung der Biowissenschaften nicht von Vorteil, atypische „lebende Organismen“ nur zum persönlichen Vergnügen einiger Leute in die Kategorie „Leben“ einzuordnen. „ Die Debatte tobt und fast alle Biologen sind davon überzeugt, dass die Frage auf die eine oder andere Weise geklärt ist. Sicher ist jedoch, dass Viren – unabhängig davon, ob sie Lebewesen sind oder nicht – angesichts ihrer Auswirkungen auf das Leben auf der Erde in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unsere größte Bewunderung und unseren größten Respekt verdienen. Von Gilles Messier Übersetzt von Apotheker Korrekturlesen/Yord Originalartikel/www.todayifoundout.com/index.php/2022/06/are-viruses-actually-alive/ Dieser Artikel basiert auf der Creative Commons-Lizenz (BY-NC) und wird von Pharmacist auf Leviathan veröffentlicht Der Artikel spiegelt nur die Ansichten des Autors wider und stellt nicht unbedingt die Position von Leviathan dar |
>>: Wie einzigartig ist der Jadedrachenfarn, der erstmals in Qinghai entdeckt wurde?
Artikel empfehlen
Creative Sound BlasterX H5 Testbericht: Wecken Sie Ihren Schlaf
Mit der rasanten Entwicklung der Software- und Ha...
Können nur männliche Affen König sein? Sie wurde zum beispiellosen „Wu Zetian unter den Affen“!
Im Juli 2021 fand im Yamazaki Natural Zoo im japa...
Ist Hololens das nächste Google Glass?
Bei der gestrigen Einführungsveranstaltung zu Win...
Im Internet heißt es, dass das Ansehen von Horrorfilmen beim Abnehmen helfen kann, aber ich rate Ihnen, vorsichtig zu sein! !
Ich habe vor einiger Zeit ein kurzes Video gesehe...
Google: Android TV-Spiele werden Sony, Microsoft und Nintendo stören
In den Anfängen der Videospielbranche machten Unt...
Ein Mann bekam Angst, als ihm bei einer körperlichen Untersuchung zwei Liter Öl aus dem Blut entnommen wurden
Kürzlich hatte Herr Wang aus Hankou ein sehr tief...
Das Paradies der „Pilze“ ist da! Wie viele Arten von Wildpilzen gibt es in Yunnan? Die Antwort übersteigt jede Vorstellungskraft!
Vor kurzem haben das Ministerium für Ökologie und...
Welchen Sinn hat es für Video-Websites nach mehreren Versuchen, Verluste in Gewinne umzuwandeln?
Von der exklusiven Ausstrahlung über die kostenpf...
Welches Bankdrücken ist besser?
Ich glaube, viele Freunde werden feststellen, das...
Kann die Aurora auslösen! Was genau ist der Ursprung geomagnetischer Stürme?
Vor einiger Zeit wurde in den Nachrichten bericht...
Sun Yingsha und Liang Jingkun gewannen die Meisterschaft. Hat die Qualität des Tischtennisspiels etwas mit dem Schläger zu tun?
Tischtennis ist als Nationalsport meines Landes n...
Ist Sauerstoff erfrischender als Kaffee? Jemand hat es verwendet und festgestellt, dass …
Im Internet kursiert derzeit ein beliebtes Sprich...
Rehabilitationsgerät für die unteren Gliedmaßen
In der heutigen Gesellschaft gibt es viele chroni...
Gibt es eine andere Version der Benutzeroberfläche für iOS 8?
Apple ist der Ansicht, dass das Unternehmen den Ve...