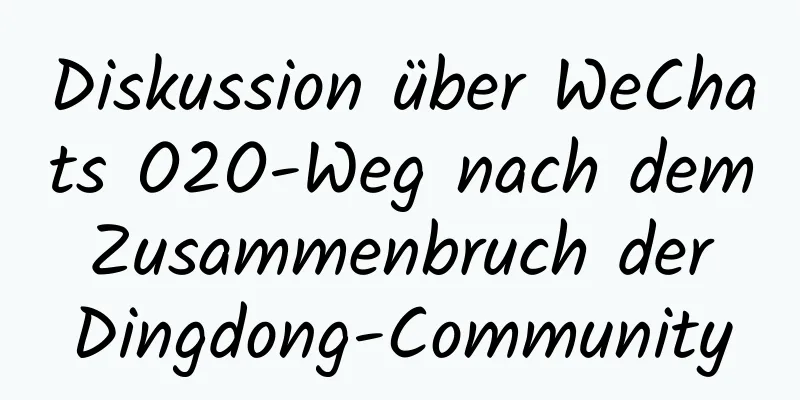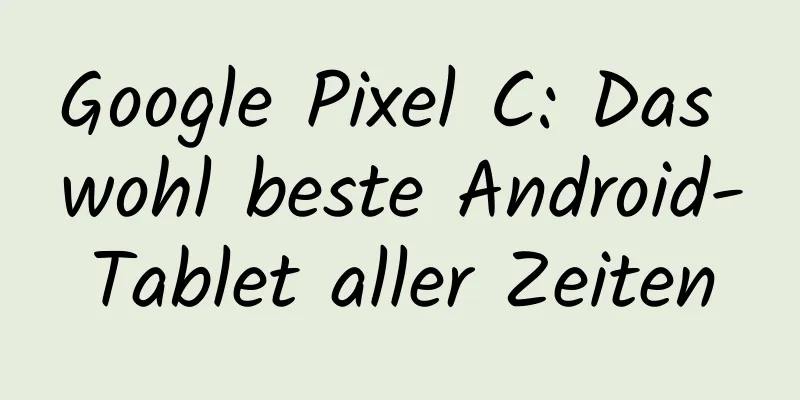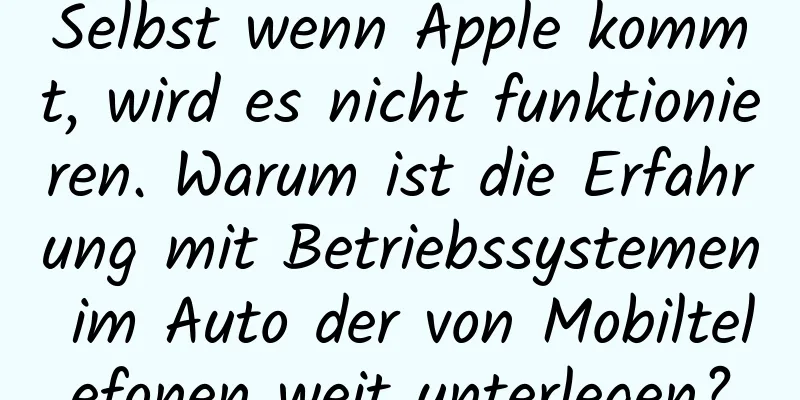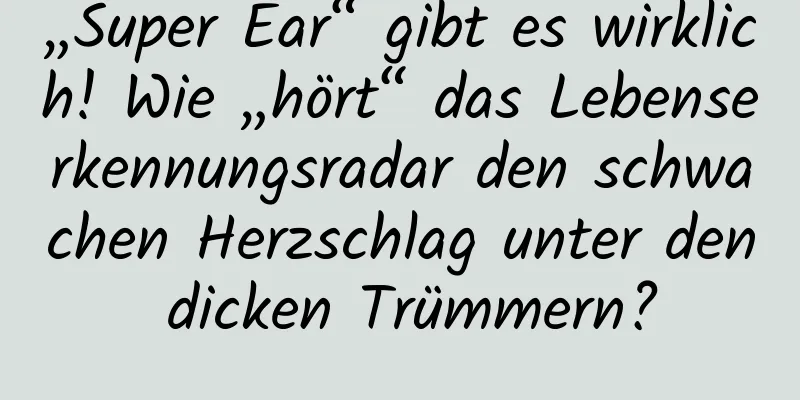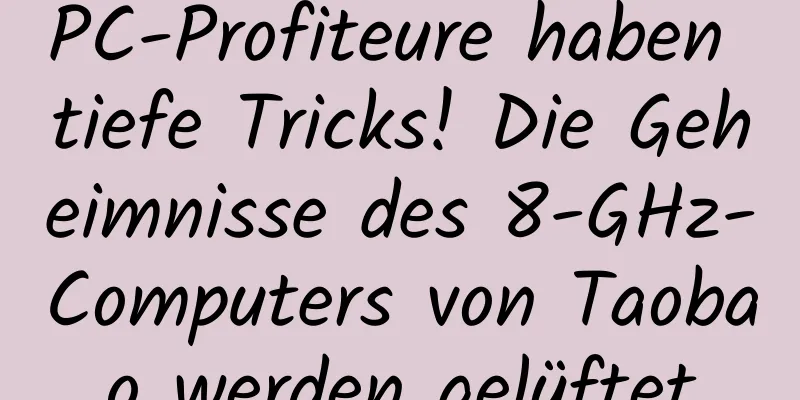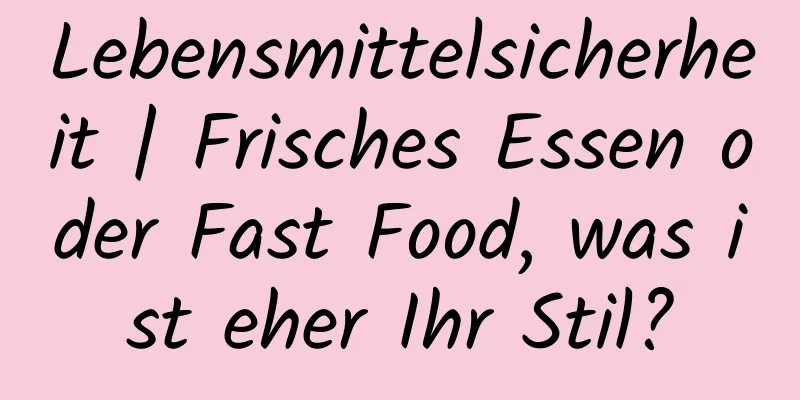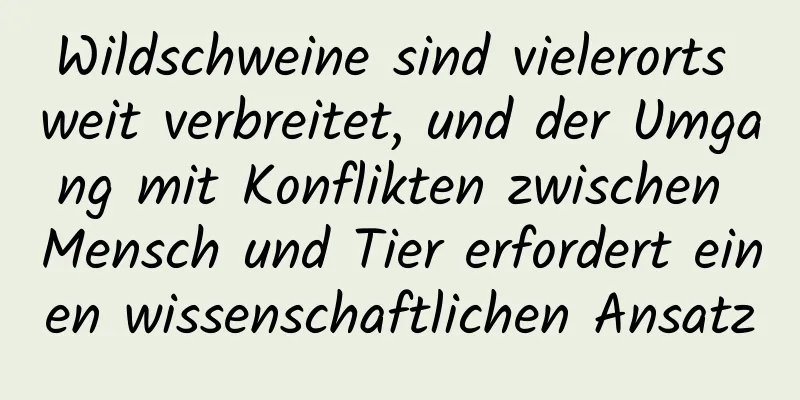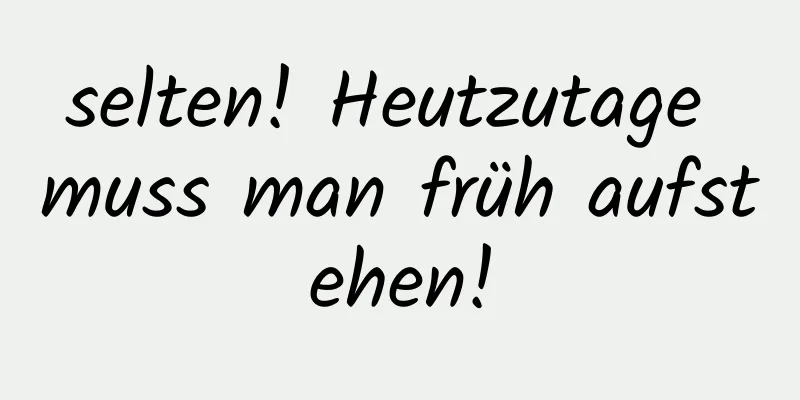Die Geschichte des Kampfes zwischen Elefantengeistern und Maschinen
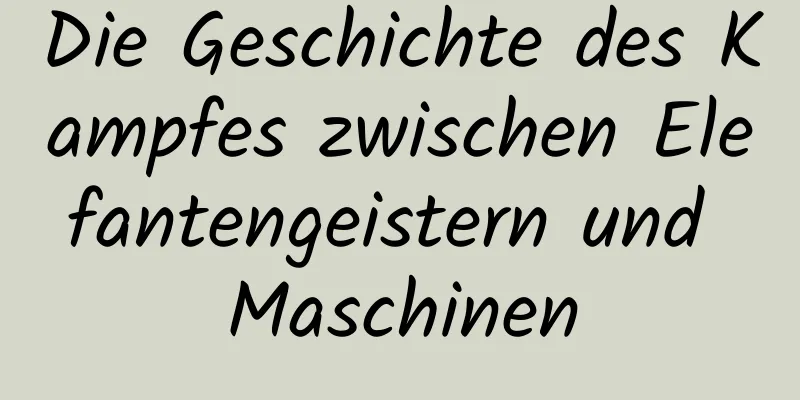
|
© wikimedia Leviathan Press: Ich persönlich war schon immer von riesigen Lebewesen fasziniert, seien es Wale im Meer oder Elefanten an Land. Vielleicht liegt es daran, dass ihre Entwicklung so lange gedauert hat, dass ich sie immer als seltene und geheimnisvolle Lebewesen auf diesem Planeten empfinde. Selten: Elefanten wurden im Ersten Weltkrieg zum Transport schwerer Waffen eingesetzt. Aufgrund der Größe dürfte es sich um einen jungen Asiatischen Elefanten handeln. © Alamy Es gibt historische Aufzeichnungen über den Einsatz von Elefanten in der Kriegsführung in der Antike. Das persische Achämenidenreich setzte in mehreren Feldzügen aus Indien stammende Kriegselefanten ein. Die Schlacht von Gaugamela zwischen dem Persischen Reich und Alexander dem Großen war wahrscheinlich das erste Mal, dass die Europäer mit Kriegselefanten konfrontiert wurden: Die 15 Kriegselefanten, die im Zentrum der persischen Armee aufgestellt waren, versetzten der makedonischen Armee einen schweren Schock. So sehr, dass Alexander sich am Vorabend der Schlacht gezwungen sah, dem Gott der Angst ein Opfer darzubringen. Spätere Generationen glaubten jedoch, dass Kriegselefanten in Wirklichkeit unzuverlässige Waffen seien, die den Feind lediglich erschrecken oder einschüchtern könnten. Da Kriegselefanten im Allgemeinen sehr empfindlich sind, können sie leicht durch seltsame Geräusche oder andere Ursachen in eine Wahnsinnssituation geraten, verrückt werden und dann in alle Richtungen fliehen. Auf jeden Fall scheinen wir Menschen Elefanten gegenüber schon immer sehr komplizierte Gefühle gehabt zu haben: Bewunderung für ihre Größe, Anbetung ihrer Stärke und Sympathie und Mitleid für ihre miserable Lage, als sie sich in die menschliche Gesellschaft verirrten. Doch anstatt Mitgefühl für die Elefanten zu haben, projizieren viele Menschen nicht einfach ihre eigene Situation auf die Elefanten? Am 15. September 1885 kam der Elefant Jumbo bei einem Zusammenstoß mit einem Güterzug ums Leben, 25 Jahre nachdem er im Sudan gefangen genommen worden war. In diesem Artikel nimmt uns der Autor Ross Bullen mit auf eine gespenstische Reise, um die Geschichten der „Kollisionen“ anderer Elefanten mit Maschinen zu erkunden. Ob sie nun in Abenteuerromanen, verlassenen Gasthäusern am Straßenrand oder in der Wissenschaft des Geistes spielen, diese Geschichten offenbaren die Ängste, die an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert in den Herzen der Menschen schlummerten. „Lucy der Elefant“, eine Skulptur von James V. Lafferty, in Margate, New Jersey. Das Foto wurde vermutlich nach 1933 aufgenommen. © www.loc.gov In seinem 1886 erschienenen Buch „Der Elfenbeinkönig“ beschrieb der amerikanische Naturforscher Charles Fredrick Holder den aktuellen Zustand der Elefanten aus konservativer Sicht. Er räumte zwar ein, dass die Elefanten „die wahren Könige aller Tiere, die größten und mächtigsten Landtiere überhaupt und eine nie versiegende Quelle der Verwunderung und des Erstaunens für alle Menschen“ seien, glaubte aber auch, dass sie „am Ende ihrer Kräfte“ seien. Holder glaubt, dass die prähistorische Jagd und der moderne Elfenbeinhandel die Hauptfaktoren für das allmähliche Aussterben der Elefanten sind. Er erwähnte auch, dass „die Briten rasch in den Osten vordringen. Sie bauen Eisenbahnen in Indien und führen verschiedene fortschrittliche Einrichtungen ein, die eine fortgeschrittene Zivilisation symbolisieren. Früher verließen sich die Menschen bei der Durchführung verschiedener Großprojekte auf Elefanten, doch heute sind sie unbedeutend geworden. Das Aussterben der Elefanten ist nur eine Frage der Zeit.“ Trotz seiner Sympathie für Elefanten lobte Holder die Technologie, die sie ersetzte, und argumentierte, dass sie „eine Form des Fortschritts“ sei und „den Vormarsch der Zivilisation“ markiere. Vielleicht sind Elefanten tatsächlich die „Könige der Tiere“, doch im Vergleich zu Dampflokomotiven und anderen westlichen Technologien sind sie zum Scheitern verurteilt. In der Konsumgesellschaft des 21. Jahrhunderts sind Analogien zwischen Elefanten und Maschinen weit verbreitet und Wörter, die mit Elefanten in Verbindung stehen, darunter „Mammut“ (und natürlich „Campbell“), werden oft verwendet, um für Motoren und zahllose andere Produkte zu werben. Doch erst im 19. Jahrhundert wurde die Analogie richtig populär. Dies war die Zeit, als Autos und Motorräder erstmals auf den Markt kamen und die europäischen Kolonisten nach Afrika, Südasien, Südostasien und in andere Regionen vordrangen, die die Heimat der Elefanten waren. Aus westlicher Sicht sind Elefanten kraftvoll und beeindruckend und sie verrichten Arbeiten, die in Europa und Nordamerika von Maschinen erledigt werden. Gleichzeitig zweifelten die Kolonisten jedoch nicht daran, dass die moderne Technologie der tierischen Arbeitskraft der Elefanten überlegen war. Darüber hinaus glauben sie auch, dass Maschinen Elefanten irgendwann ersetzen werden und diese Art möglicherweise irgendwann vom Aussterben bedroht ist. In seinem 1854 erschienenen Roman „Harte Zeiten“ verglich Charles Dickens die „monotone Auf- und Abbewegung des Kolbens einer Dampfmaschine“ mit der „traurigen und rasenden Bewegung des Elefantenkopfes“, eine Metapher, die er in diesem relativ kurzen Roman noch vier weitere Male wiederholte. Für Menschen im Westen sind Elefanten wie eine „Technologie“, die den Kolonien als „Andere“ gehört, und deshalb können sie leicht zu Fantasieobjekten westlicher Macht und Herrschaft werden. Gleichzeitig werden die Wörter „traurig“ und „verrückt“ oft zusammen verwendet, um von Menschen gefangene Elefanten zu beschreiben, was auch die Angst der viktorianischen Menschen vor mächtigen, unkontrollierbaren und zerstörerischen Industriemaschinen widerspiegelt. Diese Illustration aus einer nicht genannten Zeitung zeigt, wie Jimbo – „der Ruhm und Stolz Englands“ – an einen von P.T. geleiteten Zirkus verkauft wird. Barnum im Jahr 1882. © collections.ctdigitalarchive.org Neben der von Holder beschriebenen symbolischen „Kollision“ kommt es häufig zu realen Kollisionen zwischen Elefanten und Eisenbahnen. Das bekannteste Beispiel ist der Tod des Elefanten Jimbo im Jahr 1885. Als Jinbao vier Jahre alt war, wurde er von einer Gruppe Jäger aus den afrikanischen Graslandschaften verschleppt. Sie töteten seine Mutter und verschleppten ihn dann nach Europa. © Kult des Unheimlichen Holder widmet der Beschreibung von Jimbo ein ganzes Kapitel. Er beschreibt unter anderem, wie er in Afrika gefangen und nach Europa verkauft wurde, wie er viele Jahre im Londoner Zoo verbrachte, wie er an Barnums Zirkus verkauft wurde, wie dieser Deal in der britischen Öffentlichkeit für Empörung sorgte und wie er schließlich in St. Thomas in der kanadischen Provinz Ontario starb. Zu dieser Zeit absolvierte Jimbo seinen letzten Auftritt in Barnums Zirkus. Als er zu dem Waggon geführt wurde, in dem er sich befand, raste plötzlich und unerwartet ein Güterzug auf ihn zu. Trotz aller Bremsbemühungen des Schaffners erfasste der Zug Jimbo. Sein sechs Tonnen schwerer Körper brachte die Lokomotive und zwei Waggons zum Entgleisen, und er selbst starb 15 Minuten später. In einer Neuauflage seiner Autobiografie aus dem Jahr 1889 bezeichnete Barnum Jimbos Tod als eine „von allen bekannte und geteilte Tragödie“ und sagte, er habe „Hunderte von Telegrammen und Beileidsbriefen“ erhalten. Am 15. September 1885 kollidierte Jimbo, der Elefant, in St. Thomas, Ontario, mit einem Zug. Auf dem Foto machen Menschen Fotos mit dem verstorbenen Jinbao. ©collections.ctdigitalarchive.org Jimbos Tod löst eine Reihe seltsamer physischer (und möglicherweise immaterieller) Überreste aus. Im Jahr 1985 errichtete die Stadt St. Thomas zum Gedenken an Campbells hundertsten Todestag eine lebensgroße Skulptur des Elefanten. Die Skulptur besteht aus Stahl als Skelett und Zement als Hauptmaterial. Der Bildhauer ist Winston Bronnum, ein kanadischer Autodidakt, der für seine riesigen Tierskulpturen bekannt ist, die Passanten bewundern können. 1985 wurde die von Winston Brennom geschaffene Jimbo-Statue enthüllt. © Laurence Grant Darüber hinaus wurde Jimbos Elefantenhaut nach seinem Tod ausgestopft und reiste weiterhin mit Barnums Zirkus umher. Schließlich endete die jahrelange Wanderschaft des Exemplars, es wurde in dem von F. T. Barnum an der Tufts University eröffneten Naturkundemuseum gesammelt und wurde zum Maskottchen der Universität. Eine kleine Flasche mit Resten, die Jinbao hinterlassen hat. © dl.tufts.edu Das Exemplar wurde 1975 durch einen Brand zerstört und alles, was von Jumbles massivem Körper übrig blieb, war ein Schwanz (der aufgrund einer versehentlichen Beschädigung im Sammlungsraum der Universität aufbewahrt wurde) und ein kleiner Aschehaufen. Die Asche wurde in einem „Peter Pan Crunchy Peanut Butter“-Glas aufbewahrt, das sich noch immer im Büro des Sportdirektors der Tufts University befindet. Kimbos materielles „Erbe“ besteht aus zwei entgegengesetzten Extremformen: einer schweren Statue an einem Ende und einer Handvoll Asche am anderen. Diese Spannung zwischen dem Physischen und dem Nicht-Physischen ist auch zum Zeitpunkt von Jinbaos Tod sehr deutlich. Damals nutzte Barnums Zirkus Jimbos Skelett als Ausstellungsstück und hoffte, mit seinem Körper Profit zu machen. Mehr als ein Autor hat die Vorstellung zum Ausdruck gebracht, dass der Tod den Schatz in gewisser Weise aus seinem massigen Körper befreien könnte. In der Chicagoer Zeitung The Current vom 26. September 1885 fand sich ein Witz: „ Man könnte sagen, dass seine Seele weniger Mühe hat, in dieser Welt zu wandeln als Jimbo selbst. “ Tatsächlich schien sein Geist in den Jahrzehnten seit seinem Tod die Medien heimzusuchen. Im weiteren Verlauf dieses Artikels nehme ich Sie mit auf eine erstaunliche Reise mit dem Geist von Jimbo, durch Abenteuerromane für Kinder, verlassene Gasthäuser am Straßenrand, seltsame elektrische Experimente und spirituelle Wissenschaft ... und verfolge die „Kollision“ zwischen Elefanten und Technologie im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Das aus Campbells Elefantenhaut gefertigte Exemplar wurde 1889 dem Barnum Museum of Natural History der Tufts University übergeben. © wikimedia Ein buntes Zirkusplakat lockt die Besucher zu „Jimbos Riesenskelett“. Das Gemälde entstand zwischen 1885 und 1890. Auf dem Plakat steht folgender gelber Text: „Dieses riesige und majestätische Skelett stammt vom größten und edelsten Tier der Welt. Dies ist die weltweit erste öffentliche Ausstellung von Elefantenskeletten.“ © wikimedia Wir kommen zum ersten Mal im Jahr 1867 nach Indien, genau zehn Jahre nach dem berühmten indischen Nationalaufstand. Zu dieser Zeit befand sich eine Gruppe europäischer Forscher in Kalkutta und versuchte, die Region Nordindien zu durchqueren. Zu dem Team gehörte ein Ingenieur namens Banks, der ein neuartiges Reisehilfsmittel erfand: einen riesigen, dampfbetriebenen Elefanten. Der riesige Elefant, Steam House oder Behemoth genannt, konnte zwei Wagen (einen für die Entdecker und einen für ihre Diener) über jedes Gelände ziehen und jede Menge frisches Wasser transportieren. Ein besonders interessantes Beispiel für die Elefanten-Maschinen-Analogie bietet Jules Vernes relativ unbekannter Roman „Das Dampfhaus“ aus dem Jahr 1880. Im Indien von Steam House haben Dampfmaschinen die Elefanten und sogar die Spezies selbst ersetzt: Die stählernen „Behemoths“ sind größer und höher als echte Elefanten und schillernder als diese. Maucler, der Erzähler des Romans, beschreibt den Schock der Eingeborenen, als sie Behemoth zum ersten Mal sahen: Zuerst erschien ein riesiger Elefant, der offensichtlich die Kutsche hinter sich herzog. Dieses monströse Geschöpf war sechs Meter hoch und neun Meter lang. Seine Bewegung war stetig, bewusst und geheimnisvoll und erfüllte diejenigen, die es betrachteten, mit Ehrfurcht. Seine riesigen Füße hoben und senkten sich mit mechanischer Regelmäßigkeit, und als es sein Tempo von langsamem zu schnellem Gehen änderte, war kein Laut oder keine Geste des Reiters zu erkennen. Die Eingeborenen waren zunächst so schockiert von dem riesigen Elefanten, dass sie sich nicht einmal trauten, sich ihm zu nähern, sondern ausreichend Abstand hielten. Doch als sie sich schließlich näher trauten, verwandelte sich ihre Überraschung in Bewunderung. Sie hörten ein Brüllen, das dem dieser Kreatur ähnelte, die in den Dschungeln Indiens lebt. Außerdem strömte gelegentlich Dampf aus dem Rüssel des riesigen Elefanten. Es ist ein Elefant, der Dampf atmen kann! „ Illustration aus der englischen Übersetzung von Jules Vernes „Das Dampfhaus“ aus dem Jahr 1881. © archive.org Für die Einheimischen von Kalkutta sah das Dampfhaus wie ein echter Elefant aus, abgesehen von seinem massiven Körper (doppelt so groß wie ein durchschnittlicher indischer Elefant), seinen „mechanischen“ Bewegungen und dem verdächtigen Dampf, der aus seinem unbeweglichen Rüssel strömte (was ein wenig ungewöhnlich schien). Obwohl Mauclair erklärte, dass sie sich alle sehr gut bewegen könnten, gab er auch zu, dass es sich bei dem „Dampfhaus“ offensichtlich um eine Maschine handelte, „ein erstaunliches Stück Schwindel ... in Stahl gehüllt“, eine Tatsache, die jeder, der es wagte, genauer hinzusehen, schnell entdecken würde. Das Dampfhaus, eine Mischung aus westlicher Technologie und östlicher Biologie, schien auf die Inder, die es sahen, eine unheimliche Wirkung zu haben, da sie sich nicht entscheiden konnten, ob es sich um einen vertrauten, nützlichen Elefanten handelte. Die Szene ist Teil einer abgedroschenen Formel, nach der westliche Technologie leichtgläubige Einheimische mit Schock und Ehrfurcht erfüllt. Tatsächlich ist Vernes Roman fast vollständig von dieser Kolonialfantasie geprägt: Europäer und ihre riesigen mechanischen Elefanten galoppieren über indischen Boden und erobern schließlich das Land, seien es nun die wilden Tiere (einschließlich echter Elefanten), der lokale König oder sogar Nana Sahib (auch bekannt als Nana Saheb Peshwa II), der Anführer der Rebellen bei der Belagerung von Cawnpore. In Vernes Vorstellung hatte er zehn Jahre lang in Anonymität gelebt. Mehr als 20 Jahre später, im Jahr 1903, schrieb Frances Trego Montgomery einen Kinderroman mit dem Titel „The Wonderful Electric Elephant“ und veröffentlichte im folgenden Jahr die Fortsetzung „On a Lark to the Planets“. Er stellte sich eine elefantenartige Maschine vor, die dem „Dampfhaus“ ähnelte, aber dem neuesten Stand der Technik entsprach und mit Strom betrieben werden sollte. Cover von „Der magische elektrische Elefant“. © archive.org Darüber hinaus spiegelt sich „Upgrade“ in Montgomerys Geschichte auch in der Ausweitung der Reichweite dieses „Elefanten“ wider: Die Kinder reisten zunächst mit diesem magischen elektrischen Tier um die Welt und dann durch das Sonnensystem. Obwohl Montgomerys Geschichte phantasievoller ist als die von Verne, basieren beide auf derselben Grundformel: Man will die verblüfften Nicht-Westler täuschen und ihnen durch Technologie überlegen sein. Am Ende von „The Amazing Electric Elephant“ lässt Montgomery seine beiden Kinderprotagonisten (Harold und Iona) den elektrischen Elefanten bemalen, um die Menschen in Siam (dem heutigen Thailand) glauben zu machen, es handele sich um einen farbenfrohen, glückverheißenden Elefanten (auf Siamesisch „Chang Pheuak“). Montgomery schrieb: „Jeder von ihnen nahm einen Aquarellpinsel zur Hand, begann zu arbeiten, und nach wenigen Stunden war das Werk vollendet. Nun stand vor ihnen ein wunderschöner Elefant. Der schlichte, gewöhnliche, mausgraue Elefant war verschwunden, und an seiner Stelle stand ein wunderschöner rosa Elefant.“ Anschließend ließen die Kinder den Elefanten vom „Oberjäger des Prinzen von Siam“ „fangen“ und zum Palast des Prinzen bringen. Hier baden und füttern „zwei Reihen von Jungen mit ebenholzschwarzer Haut und silbernen Tabletts auf dem Kopf“ den „Elefanten“ und schmücken ihn mit verschiedenen Geschenken und luxuriösem Schmuck. Montgomery hat diese Szene aus zwei Gründen geschaffen: Erstens würde die großzügige Behandlung des sogenannten „glückverheißenden Elefanten“ durch den siamesischen Monarchen die Leser zum Lachen bringen; zweitens war es auch ein Schauspiel, das die Leser schon oft gesehen hatten: die Verehrung westlicher Technologie durch die Ureinwohner aus einer kolonialen Perspektive. Buchcover für „On a Lark to the Planets“ von Frances Trego Montgomery, die Fortsetzung von „The Wonderful Electric Elephant“. © archive.org Im Jahr 1903 waren Elektrizität und Elefanten nicht die einzigen Dinge, die in Montgomerys Romanen auftauchten. Im Januar desselben Jahres kam der berüchtigte Film „Electrocuting an Elephant“ der Edison Studios in die Kinos. Der 74-sekündige Film dokumentiert den Stromschlag eines Elefanten namens Topsy auf Coney Island. Der Name „Topsy“ stammt von einer Figur aus Harriet Beecher Stowes Roman „Onkel Toms Hütte“. Topsy wurde in Südostasien gefangen und an Adam Forepaughs Zirkus und dann an den Sea Lion Park verkauft, wo ihr neuer Besitzer entschied, dass sie nicht länger nützlich sei und nicht weiterverkauft werden könne, und plante daher, sie zur öffentlichen Unterhaltung aufzuhängen. Nach Protesten der American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) wurde dieser grausame Plan verworfen und stattdessen darauf verzichtet, ihr mit Zyanid versetzte Karotten zu geben, sie zu erwürgen, ihr Schuhe aus Kupferdraht anzuziehen und sie einer Spannung von 6.600 Volt auszusetzen. Nachrichtenfoto vom Stromschlag des Elefanten Topsy, 4. Januar 1903. Hinter Topsy ist ein im Bau befindlicher „Strommast“ zu sehen. Ich frage mich, welcher Architekt es für Luna Park gebaut hat. © wikimedia „Electric Shock to the Elephant“ beginnt mit einer Szene, in der ein Elefantentrainer Topsy zum „Hinrichtungsplatz“ führt. Dann wechselt die Kamera und zeigt Topsy, der in der Mitte des Bildschirms erscheint. Sie kämpft einmal und versucht, die Kupferdrahtschuhe von ihren Füßen zu befreien. Den Rest der Zeit stand sie still da, bis sie plötzlich erstarrte und Funken aus ihren Fußsohlen sprühten. Ein paar Sekunden später war Topsy steif, von Rauch umgeben und fiel dann hin. Dies geschah etwa 45 Sekunden nach Beginn des Films. Für den Rest des Films – fast 40 Prozent seiner Laufzeit – bleibt die Kamera auf Topsys seltsam starren Körper gerichtet, während sich der Rauch langsam um sie herum auflöst. Am Ende des Films gibt es einen weiteren scheinbar unaufdringlichen Übergang und eine Person erscheint auf dem Bildschirm. Er stand neben Topsy und beobachtete sie, als wolle er der Todesszene etwas Spektakuläres hinzufügen. Als nächstes verlässt der Mann das Bild und der Film endet. In „Der fantastische elektrische Elefant“ hauchte Montgomery einem mechanischen Elefanten mit Hilfe von Elektrizität Leben ein. In „The Electric Elephant“ töteten Menschen einen echten Elefanten mit Elektrizität. Und die Kollision zwischen Topsy und 6.600 Volt hinterließ tatsächlich etwas Mechanisches: eine 21 Meter lange Filmrolle in einem münzbetriebenen Kinetoskop – einem frühen Gerät, das Kurzfilme zeigte, die Kunden gegen Gebühr ansehen konnten. Wer bereit war, ein paar Münzen auszugeben, konnte diesen perforierten Film wie einen Zug über Schienen durch die Mechanik des Projektors gleiten lassen und sich dabei „Electric Elephant“ vorspielen lassen. Jedes Mal wurde Topsy „wieder lebendig“ und „starb“ am Ende des Films. Der Ort, an dem Topsy einen Stromschlag erlitt, wurde später von 1903 bis 1944 zum Luna Park, war aber bereits damals ein Elefantenfriedhof. Früher stand hier ein Gebäude namens „Elephantine Colossus“, das 7 Stockwerke hoch war und insgesamt 31 Räume hatte. Der Elefant wurde gebaut, um Touristen anzulocken und beherbergt ein Hotel, einen Konzertsaal und ein umstrittenes Bordell. Altes Foto des „Elephant“-Gebäudes. © urbanarchive.org Der Elefant wurde von James V. Rafferty entworfen und der Bau begann 1885. Es war eine vergrößerte Version von Raffertys Lucy dem Elefanten. „Lucy the Elephant“ wurde 1881 erbaut und befindet sich in der Nähe der Stadt Atlanta. Es existiert noch heute . Das Ende des Gebäudes bestand darin, dass es in Flammen aufging, was auf unglaubliche Weise das Schicksal des Elefantenhautexemplars an der Tufts University fast 80 Jahre später vorherzusagen schien. Hat jemand die Asche des brennenden Elefanten in einem Erdnussbutterglas aufbewahrt? Da es keine Aufzeichnungen gibt, wissen wir es nicht. Doch wie der Geist von Jimbo scheint auch dieses elefantenförmige Hotel eine eigene Seele zu haben und hat mit mehr als einem Zeugen „Kontakt“ aufgenommen. Illustration des „Kolossalen Elefanten von Coney Island“ aus einer Ausgabe von Science American aus dem Jahr 1885. © digitalcollections.nypl.org Im April 1897 veröffentlichte die Abteilung „Department of Psychic Experiences“ des Metaphysical Magazine eine Geschichte mit dem Titel „Strange Visions“, in der die außergewöhnlichen Erlebnisse eines „Mr. M.“ geschildert wurden. Er kam im September 1896 zum Urlaub nach Long Island und eines Abends, nachdem er mit mehreren Nachbarn über einige „übersinnliche und übernatürliche Dinge“ gesprochen hatte, gingen er und seine Frau am Strand entlang nach Hause. Zu diesem Zeitpunkt stellten sie plötzlich „zu ihrer Überraschung fest, dass der westliche Himmel sehr hell wurde. Zweifellos war ein großes Feuer ausgebrochen.“ Als Herr M. nach Hause zurückkehrte, beschloss er, das Feuer noch einmal von seinem Balkon aus zu beobachten, als er die folgende bizarre Vision hatte: Ich blickte zufällig in den Himmel, und in einer Höhe von etwa sechzig bis siebzig Grad fiel mir eine kleine weiße Wolke ins Auge. Sie hatte eine etwas eigenartige Form, und ihre weißen und rosa Farben waren ungewöhnlich. Plötzlich verwandelte sich die Wolke in einen perfekten Elefanten. Weil sie so eigenartig war, rief ich andere herbei, um sie mir zu zeigen, und obwohl ich ihnen meine Gedanken vorher nicht mitgeteilt hatte, stimmten sie alle darin überein, dass die Form der Wolke tatsächlich einem Elefanten ähnelte. Das Feuer verschwand bald, und mit ihm (oder vor dem Feuer) verschwand auch die elefantenförmige Wolke. Danach dachte ich nicht mehr daran. Unerwartet las Herr M am nächsten Morgen im New York Herald einen Bericht mit dem Titel „Der Elefantenbrand auf Coney Island“. Offenbar bot dieser Nachrichtenbericht eine weitere mögliche Erklärung für die Elefantenvision der letzten Nacht, also kontaktierte Herr M den Herausgeber des Metaphysical Magazine. Unter der Geschichte „Seltsame Visionen“ stellte der Herausgeber der Zeitschrift die folgende Hypothese auf: „Viele Menschen in der Nähe des Feuers waren in großer Aufregung. Ob sie es in Worte gefasst haben oder nicht, sie dachten nur an einen Satz: ‚Der Elefant! Der Elefant brennt!‘ Nachdem Herr M. den roten Himmel gesehen hatte, kommunizierte er mit diesen Menschen und empfing ihre Gedanken. Schließlich sind die Formen der Wolken vage, und nur der Geist des Betrachters kann ihnen einzigartige Formen verleihen. Es besteht kein Zweifel, dass die Wolken die Form eines Elefanten annahmen, weil die Idee in Herrn M.s Geist übertragen wurde. Seitenansicht des „Elephant“-Gebäudes auf Coney Island, Fotograf unbekannt. © wikimedia Wie der Geist von Jimbo erhielt das unbewegliche Gebäude „Der Elefant“ durch seinen „Tod“ eine neue Wirkungsmacht und wurde zu so etwas wie einem Telegramm, das aus den Köpfen derer gesendet wurde, die seine Zerstörung miterlebt hatten, und schließlich von Herrn M. empfangen wurde. Einige Jahre später ereilte Topsy, der Elefant, am selben Ort ein ähnliches Schicksal, nur dass ihr Tod von den Mitarbeitern von Edisons Studio auf Zelluloidfilm übertragen wurde. Charles Frederick Holder, Autor von „The Ivory King“, dürfte es nicht überraschen, dass die Elefantenpopulation weltweit zwischen dem 19. und dem frühen 21. Jahrhundert dramatisch zurückgegangen ist. Vielleicht ist das verständlich: Während diese bemerkenswerten Tiere verschwinden, erfinden die Menschen neue Wege, ihrer zu gedenken: Statuen, Gebäude, Motorräder, Fotos, Filme und mehr. Die Ironie dieses Gedenkens liegt jedoch darin, dass sie einerseits den Tod der Elefanten betrauern, andererseits aber auch die Technologie bejubeln, die Elefanten zur Migration zwingt oder zu ihrer Ausrottung führt. Am 22. Juni 2022 wurde etwa 200 Kilometer nordöstlich von St. Thomas die erste öffentliche Kunstausstellung der Art Gallery of Ontario eröffnet. Das Ausstellungsstück war die Skulptur eines Elefanten, der auf einer Zirkusbühne steht und vom zeitgenössischen kanadischen Künstler Brian Jungen geschaffen wurde. Brian Jungens Elefantenskulptur. © The Globe and Mail Jungen sagte, er sei bei der Skulptur teilweise von der Geschichte von Kim Bo inspiriert worden. Die Skulptur besteht aus ausrangierten Ledersofas und Kupfermetall und trägt den Namen „Sofamonster: Zerrissenes Herz“ [Anmerkung des Übersetzers: „Zerrissenes Herz“ ist ursprünglich Dane-zaa, eine Minderheitensprache der Aborigines in Kanada]. „Sofa Monster“ lädt den Betrachter ein, über den Gegensatz und Widerspruch zwischen seinem Motiv und seiner Form nachzudenken: Ein lebender Elefant, der auf einer Zirkusbühne steht, scheint sich im Begriff zu bewegen; Gleichzeitig besteht dieser Elefant aus ausrangierten Sofas und massivem Kupfer, was die Menschen an einen Zustand der Stille erinnert. Die Bedeutung von Jungens Sofa Monster liegt darin, dass es durch die Verwendung einzigartiger Materialien und den Danza-Untertitel „Torn Heart“ offen die Haltung der Menschen gegenüber Elefanten verurteilt, die mit der Behandlung weggeworfener Waren vergleichbar ist. Die Skulptur, oder vielmehr der Geist von Kimball, scheint uns sagen zu wollen: „Mein Herz ist zerrissen.“ Von Ross Bullen Übersetzt von Jiang Yi Korrekturlesen/Sesam Zahnlücken füllen Originaltext/publicdomainreview.org/essay/jumbos-ghost Dieser Artikel basiert auf der Creative Commons License (BY-NC) und wird von Jiang Yi auf Leviathan veröffentlicht Der Artikel spiegelt nur die Ansichten des Autors wider und stellt nicht unbedingt die Position von Leviathan dar Anmerkung des Herausgebers: Tatsächlich waren es nicht nur die eingeborenen Indianer, die im späten 19. Jahrhundert von der westlichen Dampf- und Maschinentechnik schockiert waren. Es kam zu dieser Zeit auch zu zahlreichen „Kollisionen“ zwischen der Qing-Regierung und der westlichen Kultur. Den Aufzeichnungen von Guo Songtao (1818–1891), dem ersten Botschafter der Qing-Dynastie im Vereinigten Königreich, und dem Übersetzer Zhang Deyi (1847–1918) zufolge sahen sie am 20. Mai 1878 bei einer Teeparty in London zum ersten Mal in ihrem Leben einen Phonographen und Schallplatten. Sie überprüften nicht nur die Struktur des Phonographen, sondern waren auch Zeugen des von Edison selbst durchgeführten Aufnahmevorgangs. Ist es nicht unglaublich, dass sich eine Person aus der Qing-Dynastie mit Zopf im selben Raum wie Edison befand, der gerade dabei war, den Elefanten „Topsy“ durch einen Stromschlag zu töten? Oh, übrigens, wenn wir schon von Elefanten sprechen, der coolste ist meiner Meinung nach der mechanische Riesenelefant im französischen Nantes: Dieser Elefant im Steampunk-Stil ist 12 Meter hoch, 21 Meter lang und wiegt 50 Tonnen. Die Elefanten können bis zu 49 Touristen auf einer Tour entlang der Ufer der Loire tragen. Es kann auch als Hommage an Jules Verne angesehen werden, einen Science-Fiction-Autor, der in Nantes geboren wurde. |
<<: Worauf freuen sich die Teilchenphysiker nach der Entdeckung des Higgs-Bosons noch?
Artikel empfehlen
Kampf der Pflanzen: Von der Einzelzelle zur Weltherrschaft
Kürzlich erhielt das neueste Meisterwerk der BBC,...
Während des Frühlingsfestes essen wir zu viel fettiges Essen. Können diese Lebensmittel den Fettgehalt entfernen? Es ist Zeit, die Wahrheit zu erfahren ...
Dieser Artikel wurde von Li Lin, PhD in Lebensmit...
Schwindel und Übelkeit beim Kopfstand
Handstände sind eine sehr beliebte Übungsform. Si...
Kann Samsung TV seinen Erfolg fortsetzen, obwohl weiterhin Bedenken und Zweifel bestehen?
Die Explosion des Samsung Note7 könnte für Samsun...
So trainieren Sie Ihren Po schlanker
Für viele Freunde ist ein großer Hintern immer ei...
Welche Übungen eignen sich für das Morgengymnastik?
Die Luft am Morgen ist relativ frisch und das Tra...
Welche Dehnübungen gibt es im Fitnessstudio?
Wir alle wissen, dass wir vor dem Training Aufwär...
Ist Waschpulver oder Waschmittel besser? Es gibt also diese Details
Wenn es um den Kauf von Waschmitteln geht, kann d...
Ist ein Spaziergang nach dem Essen gesund?
Viele Freunde haben die Angewohnheit, nach dem Es...
Wie schnell ist das Joggen?
Wir alle wissen, dass Joggen eine sehr gute körpe...
Wenn Supraleitung auf Quanten trifft (Teil 1): Die Freude an der doppelten Buff-Superposition
Produziert von: Science Popularization China Auto...
Nationaler Tag der Kinderimpfung – Empfohlene Sammlung! Einen vollständigen Leitfaden zu Kinderimpfungen finden Sie hier
Am 25. April 2023 ist der 37. „Nationale Kinderim...
Wie viele Schritte sind nötig, um ein Raumschiff im Universum „weder heiß noch kalt“ zu halten?
Wenn wir uns Raum vorstellen Sie denken vielleich...
Welche Übungen gibt es vor dem Schwimmen?
Es lässt sich nicht genau feststellen, wann der M...
Die Übernahme von Vizio durch LeEco zeigt, dass chinesische Unternehmen auf neue Weise internationale Türen öffnen
China war schon immer eine Marktregion, der große...