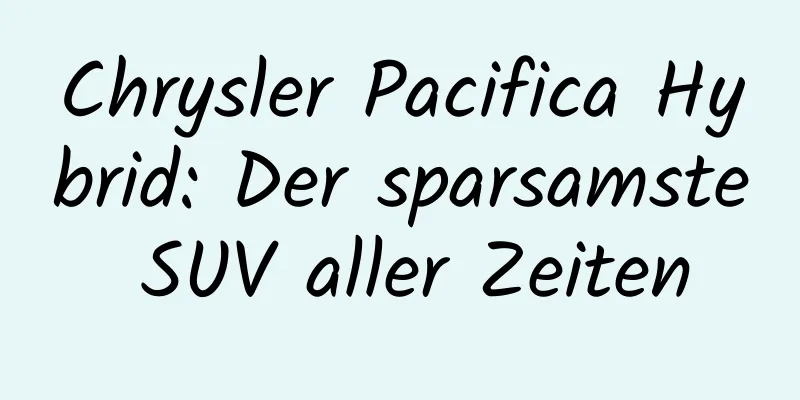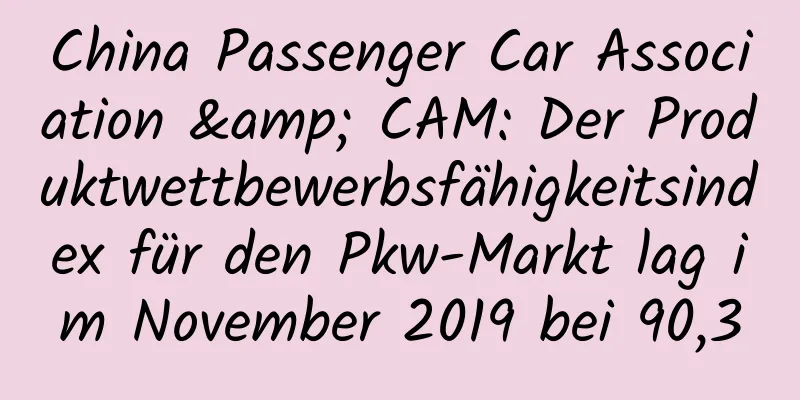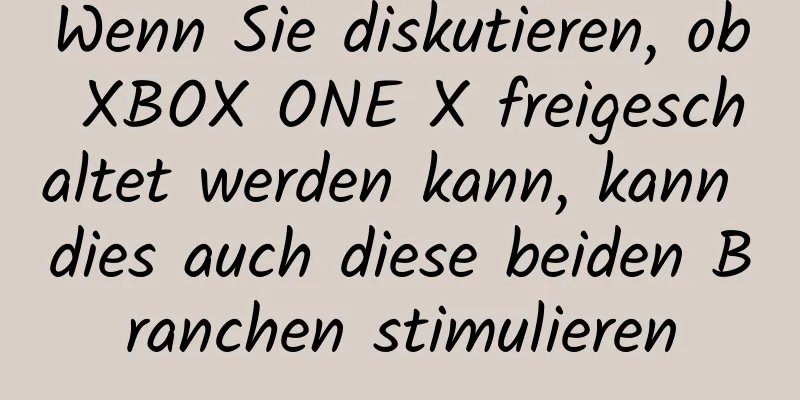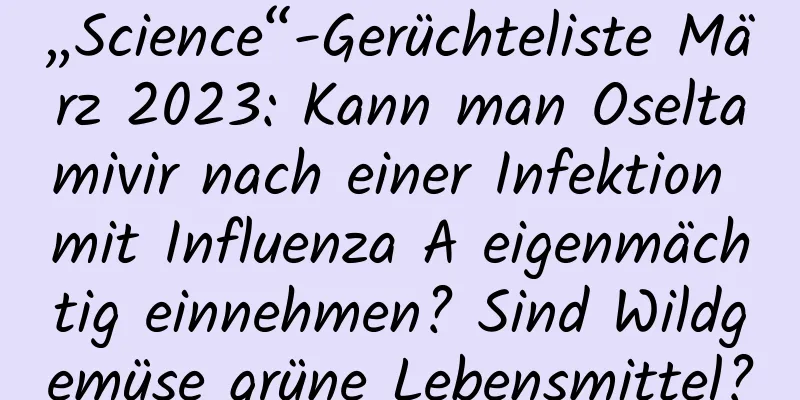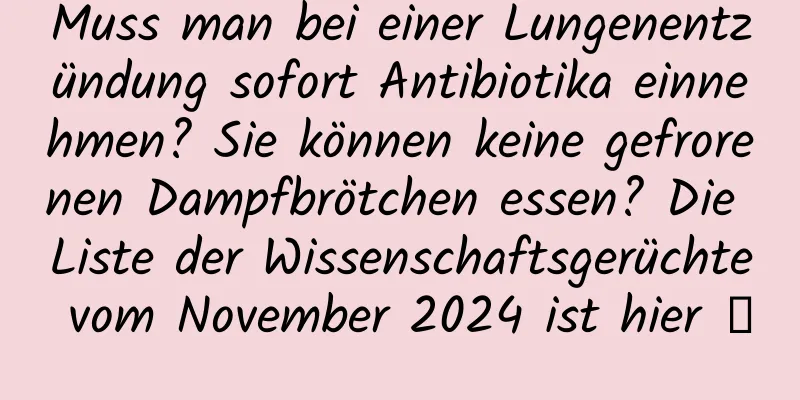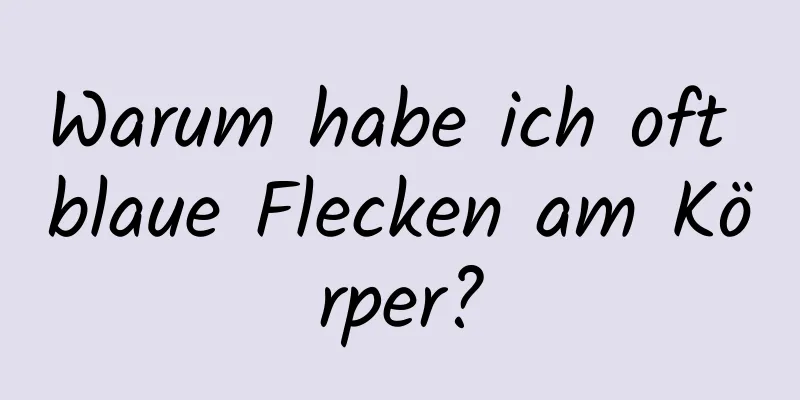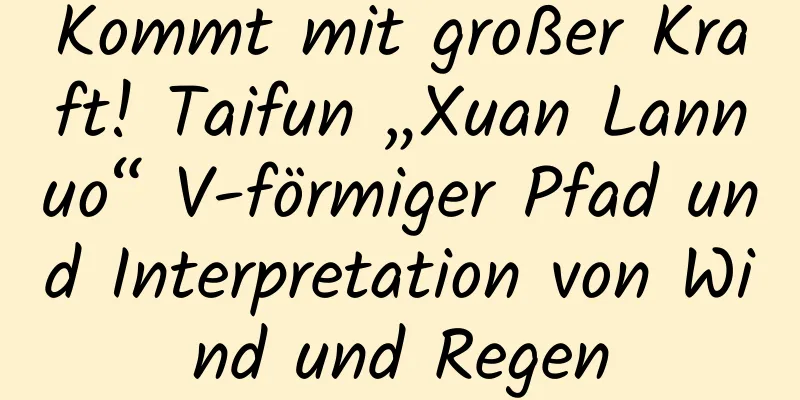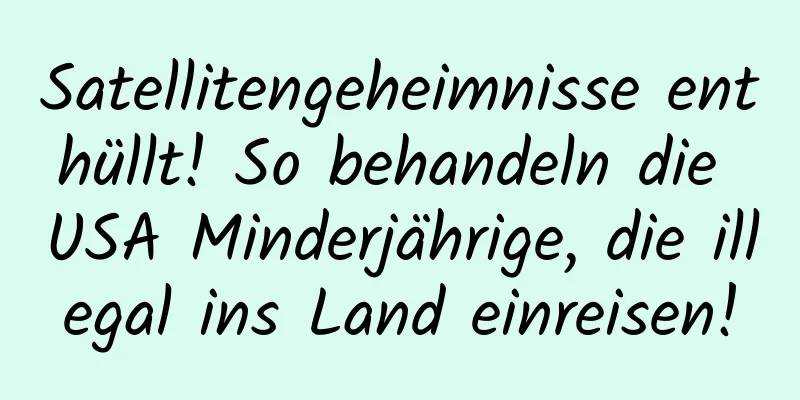[Kreatives Kultivierungsprogramm] Das Geheimnis des Ursprungs der Mitochondrien: Wie wurde die Energiefabrik eukaryotischer Zellen gebaut?
![[Kreatives Kultivierungsprogramm] Das Geheimnis des Ursprungs der Mitochondrien: Wie wurde die Energiefabrik eukaryotischer Zellen gebaut?](/upload/images/67f25b3fb1889.webp)
|
In Bezug auf den Ursprung der Mitochondrien haben Wissenschaftler zwei verschiedene Hypothesen vorgeschlagen: den endosymbiotischen Ursprung und den nicht-symbiotischen Ursprung. Wie der Name schon sagt, handelt es sich bei der Endosymbiose um die symbiotische Evolution zwischen dem Vorfahren der eukaryotischen Zellen und den primitiven Bakterien, die er aufgenommen hat. Im Vergleich zum nicht-symbiotischen Ursprung gibt es mehr Ergebnisse, die einen endosymbiotischen Ursprung unterstützen. Über den Ursprung der Endosymbiose selbst besteht jedoch Uneinigkeit. Die Vorfahren der eukaryotischen Zellen benötigten viel Energie, um Bakterien zu verschlingen, aber die Energie erzeugenden Mitochondrien hatten sich noch nicht entwickelt. Dies wird zu einem Henne-Ei-Problem: Was war zuerst da, die Phagozytose oder die Mitochondrien? Geschrieben von Nanzhi. Wir haben im Biologieunterricht in der Mittelschule etwas über Mitochondrien gelernt. Es handelt sich um ein Zellorganell, das häufig in eukaryotischen Zellen vorkommt (es gibt auch sehr wenige eukaryotische Zellen, die keine Mitochondrien haben, wie etwa Parasiten wie Giardia und Trichomonas). Da es der Hauptort ist, an dem die Zellen ihre aerobe Atmung durchführen und die Energieproduktionsfabrik in den Zellen ist, nennen wir es auch die „Kraftfabrik“ der Zellen. Woher die Mitochondrien in eukaryotischen Zellen stammen, hängt mit dem Ursprung eukaryotischer Organismen zusammen und ist ein wichtiges Thema in der biologischen Evolutionsforschung. Derzeit gibt es zwei Hypothesen zum Ursprung der Mitochondrien: die Endosymbiontenhypothese und die nicht-symbiotische Entstehung. Jede dieser beiden Hypothesen kann einige mitochondriale Situationen erklären und hatte daher immer ihre eigenen Befürworter. Entdeckung der Mitochondrien Im Jahr 1850 beobachtete der schweizerisch-deutsche Biologe und Anatom Rudolph Kolliker in Experimenten Mitochondrien, isolierte und untersuchte sie und beschrieb ihre Form und Größe. Da er sich damals jedoch über ihre Funktion und ihren inneren Aufbau nicht im Klaren war, gab er ihnen keinen Namen. Mit der Entwicklung der Mikroskopietechnologie nahm in den 1880er Jahren die Vergrößerung von Mikroskopen deutlich zu. Als der deutsche Pathologe und Histologe Richard Altmann mithilfe eines Hochleistungsmikroskops die submikroskopische Struktur von Zellen untersuchte, entdeckte er eine große Anzahl von Partikeln in energiebedürftigen Zellen (wie etwa Muskelzellen). Im Jahr 1886 erfand er eine Färbemethode zur Identifizierung dieser Partikel und konnte ihre Verteilung in den Zellen unter dem Mikroskop deutlich erkennen. Er spekulierte, dass diese Partikel keine Bestandteile der Zellen selbst seien, sondern Bakterien, die mit den Zellen koexistierten, und nannte diese Partikel daher „Bioblasten“. Im Jahr 1897 entdeckte der deutsche Biologe Carl Benda eine große Zahl von Protozoen, die manchmal eine lineare, manchmal eine körnige Form hatten. Daher nannte er die Protozoen Mitochondrien. Seitdem verwendet die wissenschaftliche Gemeinschaft „Mitochondrien“ als offiziellen Namen für dieses Teilchen. Später entdeckten Wissenschaftler bei der Untersuchung der Mitochondrienfunktion, dass in den Mitochondrien der Säurezyklus, der Elektronentransfer und die oxidative Phosphorylierung in den Zellen stattfinden. Damit wurde festgestellt, dass in den Mitochondrien die Energieumwandlung in eukaryotischen Zellen stattfindet. Woher kommen Mitochondrien? Als Richard Altmann die Mitochondrien beobachtete, schlug er vor, dass diese Struktur in der Zelle Bakterien ähnelte und ein Organismus sei, der in der Zelle koexistiere und zu einem unabhängigen Leben fähig sei. Allerdings gab es damals keine stichhaltigen Beweise dafür. In den 1920er Jahren stellte der amerikanische Biologe Ivan E. Wallin die Hypothese auf, dass Mitochondrien aus einer Endosymbiose entstanden seien, das heißt, dass sich Mitochondrien aus von Zellen aufgenommenen Bakterien entwickelten. Seine Hypothese wurde damals von der wissenschaftlichen Gemeinschaft jedoch nicht anerkannt. Erst in den 1970er Jahren schlug die amerikanische Biologin Lynn Margulis eine umfassendere Theorie der Endosymbiose vor: Primitive Eukaryoten nahmen unter bestimmten Umständen gramnegative aerobe Bakterien auf. Diese aeroben Bakterien entwickelten sich allmählich und passten sich aneinander an, während sie mit den primitiven Eukaryoten koexistierten. Dabei entstand eine für beide Seiten vorteilhafte symbiotische Beziehung und es bildeten sich allmählich Mitochondrien. In diesem symbiotischen System erhält der Wirt (aerobe Bakterien) Nährstoffe vom Wirt (primitive eukaryotische Zellen), während der Wirt die vom Wirt produzierte Energie nutzen kann, wodurch die Wettbewerbsfähigkeit der Symbiose erhöht wird. Diese Hypothese hat in der wissenschaftlichen Gemeinschaft große Unterstützung erfahren und es gibt zahlreiche Beweise für die Wissenschaftlichkeit dieser Hypothese. Erstens verfügen Mitochondrien über eigenständiges genetisches Material – mitochondriale DNA und RNA –, das sich vom genetischen Material des Zellkerns von Eukaryoten unterscheidet und eher dem von Bakterien ähnelt. Zweitens vermehren und verteilen sich bei der Zellreproduktion gleichzeitig auch die Mitochondrien, und zwar unabhängig und kontinuierlich. Seine Teilung und Vermehrung erfolgt durch Kontraktion, ähnlich wie bei Bakterien. Drittens verfügen die Mitochondrien selbst über ein unabhängiges und vollständiges Proteinsynthesesystem. Die meisten Merkmale dieses Synthesesystems ähneln denen der bakteriellen Proteinsynthese, unterscheiden sich jedoch vom Proteinsynthesesystem der eukaryotischen Zellen. Viertens haben Mitochondrien eine innere und eine äußere Membran; Die innere Membran ähnelt der bakteriellen Plasmamembran und die äußere Membran ähnelt der inneren Membran eukaryotischer Zellen. Biologen spekulieren, dass sich bei der Bildung des symbiotischen Systems, wenn der Wirt die parasitären aeroben Bakterien aufnimmt, die innere Membran des Wirts um diesen wickelt und so die äußere Membran der Mitochondrien bildet. Fünftens weist die Hypothese darauf hin, dass während des Evolutionsprozesses der Großteil der ursprünglichen genetischen Informationen aerober Bakterien auf die Wirtszellen übertragen und mit ihnen verschmolzen wurde. Jüngste Studien haben ergeben, dass die genetische Information von Atemwegsbakterien oder Cyanobakterien im Zellkern eukaryotischer Zellen vorhanden ist, was die Hypothese bestätigt. Sechstens ähnelt der genetische Code der Mitochondrien stärker dem genetischen Code der Proteobakterien, und man geht davon aus, dass die Mitochondrien von α-Proteobakterien ( α -Proteobakterien) abstammen. Siebtens gibt es noch immer ähnliche symbiotische Phänomene in existierenden lebenden Organismen, wie etwa Paramecium, das Cyanobakterien verschlingt, um einen symbiotischen Körper zu bilden. Es gibt auch einige ungeklärte Probleme mit der Entstehung der Endosymbiose. Die aufgenommenen aeroben Bakterien verfügen über oxidative Stoffwechselwege und diese Fähigkeit verschafft ihnen im Kampf ums Überleben offenbar einen größeren Vorteil gegenüber dem Wirt, der sie aufnimmt. Warum befindet sich dieses aerobe Bakterium dann ganz unten, wird als Wirt aufgenommen und überträgt sein eigenes genetisches Material auf die Wirtszelle? Dies entspricht nicht den Gesetzen der Evolution. Darüber hinaus kann die Hypothese des endosymbiotischen Ursprungs nicht erklären, wie der Zellkern, das Kontrollzentrum der Zelle, entstanden ist. Hypothese des nicht-symbiotischen Ursprungs Nachdem die Hypothese des endosymbiotischen Ursprungs aufkam, traten auch Gegner der Hypothese des nicht-symbiotischen Ursprungs auf den Plan. Die nicht-symbiotische Hypothese geht davon aus, dass eukaryotische Zellen aus einem aeroben Bakterium entstanden sind. Während der Evolution dieses Bakteriums stülpten sich einige seiner Zellmembranen mit Atmungsfunktionen nach und nach nach innen ein und umhüllten einen Teil des genetischen Materials. Dadurch entstanden Mitochondrien, die sowohl über unabhängiges genetisches Material als auch über Atmungsfunktionen und eine Membranstruktur verfügen. Es gibt auch einige Hinweise auf die Hypothese des nicht-symbiotischen Ursprungs. Beispielsweise verfügen einige primitive aerobe Bakterien heute über eine pseudo-mitochondriale Struktur, die durch Einstülpung und Faltung der Plasmamembran entsteht und über eine Atmungsfunktion verfügt. Die Struktur mit Atmungsfunktion in prokaryotischen Zellen kann als Prototyp der heutigen Mitochondrien angesehen werden. Daher wird spekuliert, dass Mitochondrien eher durch Evolution entstanden sind als dass sie durch phagozytische Symbiose entstanden sind. Die Kernmembran und die Mitochondrienmembran eukaryotischer Zellen sind durchgehend, was darauf hindeutet, dass Mitochondrien eher aus der Einstülpung des inneren Membransystems der Zelle als aus symbiotischen Bakterien stammen. Kontroverse um die Hypothese des endosymbiotischen Ursprungs Obwohl die Hypothese des endosymbiotischen Ursprungs einige ungeklärte Probleme aufweist, liefert sie mehr Beweise als die Hypothese des nicht-endosymbiotischen Ursprungs und ist daher zur gängigsten Theorie über den Ursprung der Mitochondrien geworden. Innerhalb der Hypothese des endosymbiotischen Ursprungs haben sich zwei Denkschulen herausgebildet, die auf den unterschiedlichen Zeitpunkten basieren, zu denen die mitochondriale Endosymbiose stattfand. Eine Hypothese wird als „Mito-late“-Modell bezeichnet. Sie gehen davon aus, dass der Wirt, bevor er die aeroben α-Proteobakterien aufnahm (mittlerweile gibt es zahlreiche Belege dafür, dass sich daraus Mitochondrien entwickelt haben), bereits über verschiedene Wege einen Zellkern gebildet hatte und die Eigenschaften eukaryotischer Zellen besaß (er besaß bereits einen Zellkern, ein dynamisches Zytoskelett und ein Endomembransystem) und über eine primitive phagozytische Funktion verfügte. Das heißt, der mitochondriale Vorfahr (α-Proteobakterien) drang relativ spät in den Wirt (primitive eukaryotische Zellen) ein. Eine weitere vorgeschlagene Hypothese sind die sogenannten „Mito-Early“-Modelle. Sie gehen davon aus, dass der Wirt (prokaryotische Zelle) zunächst eine symbiotische Beziehung mit aeroben α-Proteobakterien einging, um eine prokaryotische Zelle mit Mitochondrien zu bilden. Nachdem es über dieses Kraftwerk verfügte, entwickelte es eukaryotische Eigenschaften wie den Zellkern und das Endomembransystem. Der Streitpunkt zwischen den beiden Fraktionen konzentriert sich auf den Zeitpunkt, als der mitochondriale Vorfahr (α-Proteobakterien) in den Wirt eindrang. Warum ist dieser Zeitpunkt so wichtig? Denn wie der mitochondriale Vorfahre in den Vorfahren der eukaryotischen Zellen gelangte, ist ein äußerst wichtiger Diskussionspunkt. Einige Wissenschaftler glauben, dass es durch Phagozytose in die Zelle gelangt, während andere Wissenschaftler glauben, dass Zellen erst dann phagozytieren können, wenn sie über Mitochondrien verfügen. Die Frage ist also die Phagozytose. Unter Phagozytose versteht man den Vorgang, bei dem bestimmte Zellen Mikroorganismen oder kleine Objekte durch Deformationsbewegungen verschlucken. Dieser scheinbar einfache Prozess erfordert tatsächlich viel Energie und erfordert, dass die Zellen über ein dynamisches Zytoskelett und Membrantransportfähigkeiten verfügen. Wenn eine Zelle viel Energie benötigt, um Bakterien zu verschlingen, wäre sie nicht in der Lage, die Vorfahren der Mitochondrien zu verschlingen, ohne dass die Mitochondrien, die Energiefabriken, sie mit Energie versorgen. Allerdings war der mitochondriale Vorfahre zu diesem Zeitpunkt noch nicht verschlungen worden. Wie konnten Mitochondrien also zur Energiefabrik der Zelle werden? Auf diese Weise ist es, als würde man in einen Zeitstrudel eintreten. Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Mit anderen Worten: Was war zuerst da, die Mitochondrien oder die Phagozytose? Wenn die Phagozytose zuerst da war, dann hatte der Vorfahr der eukaryotischen Zellen bereits ein bestimmtes Niveau erreicht, als er den Vorfahr der Mitochondrien verschlang. Die Entstehung der Mitochondrien war nur das Tüpfelchen auf dem i der Evolution eukaryotischer Zellen. Dies ist die späte mitochondriale Hypothese. Wenn jedoch zuerst Mitochondrien auftauchten und den Vorfahren der eukaryotischen Zellen große Mengen Energie lieferten, dann wurden die Vorfahren der eukaryotischen Zellen aufgrund dieser Energiefabrik zur Evolution angetrieben und bildeten die nachfolgenden eukaryotischen Zellen. In diesem Fall waren Mitochondrien eine rechtzeitige Hilfe für die Evolution eukaryotischer Zellen. Dies ist die frühe mitochondriale Hypothese. Die Debatte über die frühen und späten Modelle der mitochondrialen Endosymbiose ist noch nicht abgeschlossen. Beide Schulen verfügen jeweils über eigene Beweise und haben zahlreiche Hypothesen aufgestellt. So schlugen beispielsweise Bill Martin und Miklos Muller**[1]** im Jahr 1998 die „Wasserstoffhypothese“ vor: Ein wasserstoffbedürftiges, methanogenes Archaeon verschmolz mit einem wasserstoffproduzierenden α-Proteobakterium als Wirt, woraufhin die beiden voneinander abhängig wurden und eine stabile symbiotische Beziehung bildeten. Dieses Modell erklärt, dass nach der Endosymbiose des mitochondrialen Vorfahren der Besitz von Mitochondrien, die große Mengen Energie produzieren, das Auftreten von Eukaryoten auslöste, was darauf hindeutet, dass Mitochondrien vor eukaryotischen Zellen und der Phagozytose existierten. Diese Hypothese ist das bekannteste frühe Mitochondrienmodell. Wissenschaftler, die diese Hypothese in Frage stellen, glauben jedoch, dass der Prozess der Methanproduktion in diesem Modell sehr komplex ist und eine große Anzahl von Coenzymen erfordert, die in heutigen Eukaryoten nicht vorkommen. Die spätere mitochondriale Hypothese umfasst das phagozytierende Archaeon-Modell (PhAT), das 2011 von Anthony M. Poole und Nadja Neumann [2] sowie 2013 von Joran Martijn und Thijs JG Ettema [3] vorgeschlagen wurde , sowie die symbiotische Hypothese von Lopez Garcia et al. [4] im Jahr 2006 und das von Pittis Alexandros et al. vorgeschlagene Endosymbiontenmodell. [5] im Jahr 2016. In diesen Modellen gehen alle davon aus, dass Mitochondrien spät gebildet wurden, insbesondere das Modell der phagozytischen Archaeen, das davon ausgeht, dass der phagozytische Mechanismus eine Voraussetzung für die Fusion mitochondrialer Vorfahren und eukaryotischer Zellvorfahren ist. Insgesamt ist die Hypothese der frühen Mitochondrien heute populärer. Auf der Suche nach neuen Beweisen Im Februar dieses Jahres lieferte ein in Molecular Biology and Evolution**[6]** veröffentlichter Artikel durch Experimente zusätzliche Beweise für die Hypothese der späten Mitochondrien. Der Artikel wurde von Lionel Guy veröffentlicht, einem Evolutionsmikrobiologen an der Universität Uppsala in Schweden. Sein Team sequenzierte Bakterien der Ordnung Legionellales, bei denen es sich um intrazelluläre Parasiten handelt, die in eukaryotischen Zellen wachsen können. Durch die Analyse der Genome von 35 Legionellenarten rekonstruierten sie die Evolutionsgeschichte der Legionellen und ihre Beziehung zu ihren frühen Wirten. Guys Team verfolgte die Evolutionsgeschichte mithilfe des Biomarkers Okenon zurück und gelangte zu dem Schluss, dass der erste Legionella-Vorfahre, der sich an den Wirt anpasste, vor 1,89 Milliarden Jahren existierte. Mit anderen Worten: Zum Zeitpunkt vor 1,89 Milliarden Jahren hatten die Vorfahren der Legionellen bereits die Vorfahren der Eukaryoten infiziert. Diese Infektion erfolgte durch Phagozytose, was indirekt beweist, dass der Phagozytosemechanismus bereits damals existierte. Viele aktuelle Studien legen nahe, dass Zellen, die Mitochondrien enthalten, erstmals vor etwa 1,5 Milliarden Jahren auftraten, also später als die Zeit, in der der phagozytische Mechanismus existierte. Offenbar entstanden die Mitochondrien erst, nachdem die Vorfahren der eukaryotischen Zellen die Fähigkeit zur Phagozytose besaßen – zuerst kam die Phagozytose, dann die Mitochondrien, was die Hypothese der späten Mitochondrien bestätigt. Einige Wissenschaftler haben jedoch nachgewiesen, dass die mitochondriale Endosymbiose schon sehr früh auftrat. Sie gehen davon aus, dass dies vor 1,21 bis 2,053 Milliarden Jahren geschah. Manche gehen sogar davon aus, dass dies vor 2 bis 2,4 Milliarden Jahren geschah. Wenn die mitochondriale Endosymbiose so früh stattfand, können die Beweise von Professor Guy nicht beweisen, dass die Phagozytose der Bildung der Mitochondrien vorausging. Die Debatte über die frühen und späten Stadien der mitochondrialen Endosymbiose ist noch immer nicht abgeschlossen. Es gibt noch viele komplexe Details über den Ursprung der Mitochondrien, die untersucht und erklärt werden müssen, aber egal, wie die Schlussfolgerung ausfällt, die Fakten beweisen, dass die Kombination der Vorfahren eukaryotischer Zellen und Mitochondrien einen enormen Wettbewerbsvorteil für das Überleben geschaffen hat. Dieser starke Wettbewerb und die kontinuierliche Weiterentwicklung haben die bunte Welt geformt, in der wir heute leben, und uns in dieser Welt eingeschlossen. Hauptreferenzen [1] Martin W, Müller M. 1998. Die Wasserstoffhypothese für den ersten Eukaryoten. Nature 392(6671):37–41. [2] Poole AM, Neumann N. 2011. Die Vereinbarkeit eines archäischen Ursprungs von Eukaryoten mit der Verschlingung: eine biologisch plausible Aktualisierung der Eocytenhypothese. Res Mikrobiol. 162(1):71–76. [3] Martijn J, Ettema TJ. 2013. Vom Archäon zum Eukaryoten: die evolutionären dunklen Zeitalter der eukaryotischen Zelle. Biochem Soc Trans. 41(1):451–457. [4] Lopez-Garcia P, Moreira D. 2006. Selektive Kräfte für die Entstehung des eukaryotischen Zellkerns. Bioessays 28(5):525–533. [5] Pittis AA, Gabaldón T. 2016. Später Erwerb von Mitochondrien durch einen Wirt mit chimärischer prokaryotischer Abstammung. Nature 531(7592):101–104. [6] Hugoson E, Guliaev A, Ammunét T, Guy L. Die Wirtsanpassung bei Legionellen beträgt 1,9 Ga und fällt mit der Eukaryogenese zusammen [J]. Molekularbiologie Evol. 2022, 39(3):msac037. Quelle: Fanpu Wissenschaftspopularisierung China - Programm zur Förderung der Schöpfung |
Artikel empfehlen
Wie schnell breitet sich kalte Luft aus? Erfahren Sie in einem Artikel 8 Fakten über Kaltfronten, die Sie noch nicht kennen
Die kalte Luft kommt wieder! Das Zentrale Meteoro...
Vorsicht, die „elektronische Senfknolle“ macht dick und schadet dem Magen
In den letzten Jahren scheint sich ein Produkt de...
Wie viele Schritte sind nötig, um ein Raumschiff im Universum „weder heiß noch kalt“ zu halten?
Wenn wir uns Raum vorstellen Sie denken vielleich...
Warum zögert Präsident Xi über das selbstfahrende Auto von Baidu?
Auf der Weltinternetkonferenz in Wuzhen in den le...
Kann das Bauchmuskelrad Bauchfett reduzieren?
Das Fitnessstudio ist ein Ort, an dem viele moder...
Was soll ich tun, wenn meine Beine vom Wandern schmerzen?
Es ist unvermeidlich, dass wir im Leben kleinere ...
Es kommt selten vor, dass Spirituosen mit 51 % Alkoholgehalt auf dem Tisch stehen. Chemiker: Weil es etwas seltsam schmeckt
Im Jahr 1153 n. Chr. verlegte die Jin-Dynastie ih...
Wohin gingen die Kuahuqiao, die Surfer des Qiantang-Flusses vor 8.000 Jahren?
Die Gewinnerarbeiten des „China Science Populariz...
Warum gilt der Schmetterling als das perverseste und grausamste Geschöpf der Welt? Um seine Metamorphose zu verstehen
Was fällt Ihnen als Erstes ein, wenn Sie über die...
Was geschah in den letzten zwei Jahren, als sich der Aktienkurs von Twitter halbierte und der von Weibo verdoppelte?
Twitter steckt in einer schwierigen Lage, während...
Wer hat diese Farben in das Feuerwerk „gemalt“?
Wenn in der dunklen Nacht das bunte Feuerwerk erb...
Es ist wieder die Jahreszeit, in der blaue Tränen Ihren Bildschirm überfluten! Aber … ist das nicht eigentlich Meeresverschmutzung?
Es ist wieder die Jahreszeit, in der blaue Tränen...
Schwindel und Übelkeit beim Kopfstand
Handstände sind eine sehr beliebte Übungsform. Si...
Econsultancy: Einzelhändler sehen User-Showrooming nicht als Bedrohung für den Ladenumsatz
Einzelhändler verzeichnen zwar eine zunehmende Nu...
Ist der Turing-Test heute noch relevant?
Quelle: Dark Matter Artikel/Medium *Dieser Artike...