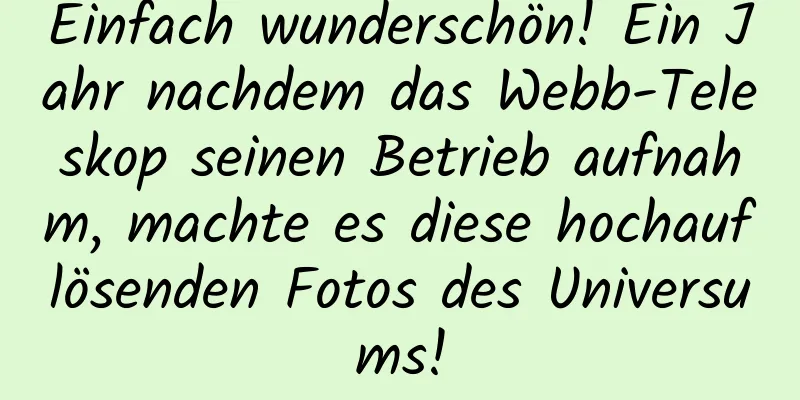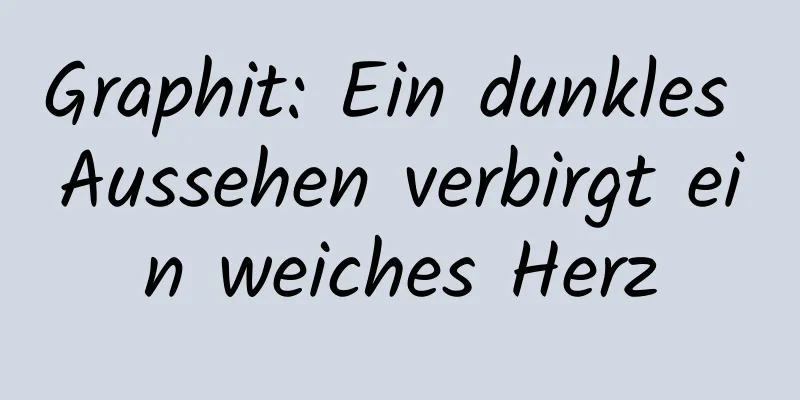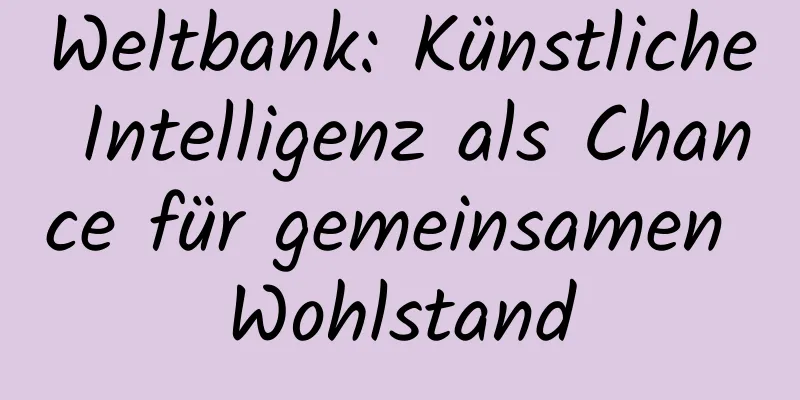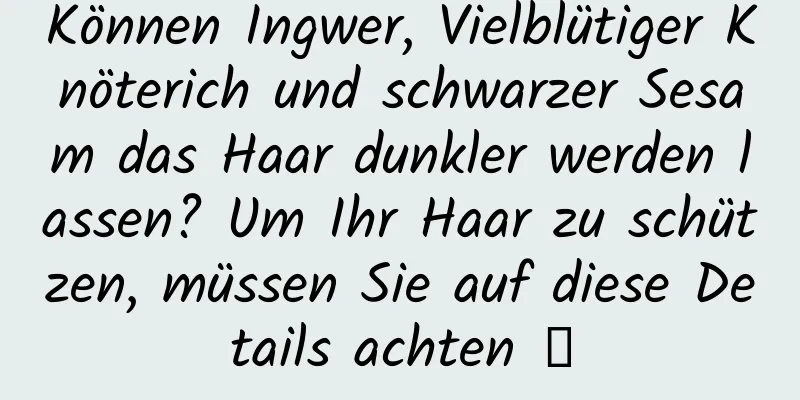Ja! Auch Tiere träumen und haben ein Bewusstsein
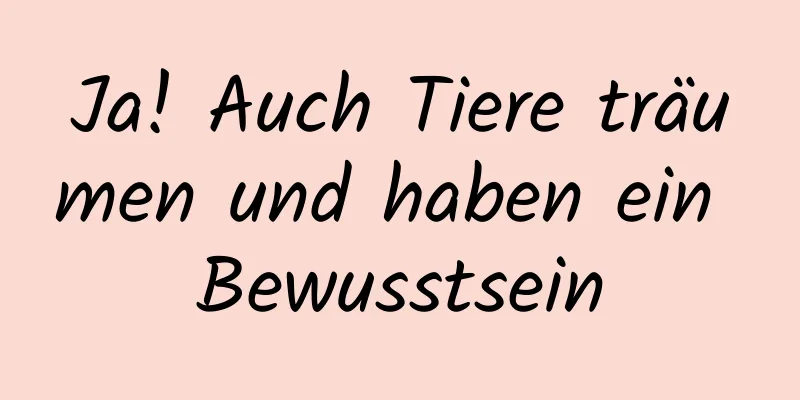
|
Wir denken normalerweise, dass der Mensch das einzige Lebewesen auf der Erde ist, das träumt. David M. Peña-Guzmán, ein amerikanischer Verhaltensforscher, der sich auf kritische Tierforschung spezialisiert hat, hat jedoch die wissenschaftliche Literatur durchsucht und auf der Grundlage detaillierter Daten einer großen Zahl von Tieren, darunter Hauskatzen, Ratten, Zebrafinken, Zebrafische und Schimpansen, nachgewiesen, dass Tiere träumen und dass viele Tiere im Schlaf eine „Realitätssimulation“ durchführen. Auch in seinem neuen Buch „Träumen Tiere?“ verknüpft er das Traumverhalten von Tieren mit neurowissenschaftlicher Forschung und philosophischen Traumtheorien, vertritt die Ansicht, dass Tiere bewusste Lebewesen sind und befasst sich mit den heiklen wissenschaftlich-ethischen Fragen, die sich daraus ergeben. Dieses Buch ist nicht nur eine lebendige Interpretation von Tierträumen, sondern auch eine faszinierende Erklärung ihrer philosophischen und moralischen Bedeutung. Das Folgende ist eine Buchbesprechung des Übersetzers dieses Buches, Herrn Gu Fanji, einem Professor an der School of Life Sciences der Universität Fudan. Es fasst nicht nur kurz die vom Autor dieses Buches vorgestellten wissenschaftlichen Beweise und Methoden zusammen, sondern kommentiert auch die philosophischen und moralischen Implikationen der Annahme des Autors, dass Tiere träumen. Geschrieben von Gu Fanji Träumen Tiere? Welche Tiere träumen? Schimpansen? Affe? Elefant? Hund? Vogel? Oktopus? Regenwurm? Als Menschen wissen wir, dass wir bei Bewusstsein sind, wenn wir träumen. Wenn Tiere auch träumen, bedeutet das, dass Tiere auch ein Bewusstsein haben? Wenn Tiere ein Bewusstsein haben, wie sollten wir sie behandeln? Dies ist das Thema des neuen Buches „Träumen Tiere?“ Obwohl die Neugier der Menschen auf ihre eigene Innenwelt und die der Tiere schon seit der Antike bis ins 19. Jahrhundert andauerte, war sie immer introspektiver und spekulativer Natur. Nach dem Aufkommen des Behaviorismus in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts war die akademische Gemeinschaft im Allgemeinen der Ansicht, dass die Wissenschaft lediglich Verhalten beobachten und untersuchen könne, innere Aktivitäten jedoch nicht untersucht werden könnten. Einige leugneten sogar die Existenz innerer Aktivitäten und schlossen damit deren Untersuchung aus dem Bereich der wissenschaftlichen Forschung aus. Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde die Erforschung der Kognition aufgrund der Fortschritte in den Neurowissenschaften und der Technologie wieder auf die Agenda der wissenschaftlichen Forschung gesetzt. Erst in den späten 1980er Jahren begannen Wissenschaftler wieder über das Bewusstsein zu sprechen, doch die Forschung zu Träumen und Bewusstsein von Tieren hinkte noch weiter hinterher. Dies liegt daran, dass Tiere nicht sprechen können und die Frage, ob Tiere träumen können, zu beantworten scheint. Erst 2020 wurde die erste wissenschaftliche Arbeit über Tierträume veröffentlicht. Natürlich müssen die Bücher, die sich speziell mit diesem Thema befassen, nicht erwähnt werden. Das neue Buch des Tierverhaltensforschers David Peña-Guzmán: „Träumen Tiere?“ Das Buch „The Secret World of Animal Consciousness“[1] thematisierte dies und sammelte zunächst eine große Menge experimenteller Daten aus drei Bereichen: Verhalten, Elektrophysiologie und funktionelle Anatomie, die durchweg die Ansicht stützten, dass auch Tiere träumen. Anschließend hebt der Autor das Thema auf eine philosophische Ebene, um eine vernünftige Erklärung zu liefern. Er nutzte die Tatsache, dass Tiere träumen, um zu veranschaulichen, dass diese Tiere auch ein Bewusstsein haben. Da Tiere beim Träumen nicht durch die Außenwelt stimuliert werden, muss die Quelle dieses Bewusstseins endogen sein. Was in Träumen gesehen wird, ist keine Wiederholung realer Erfahrungen, sondern eine Konstruktion, was darauf hindeutet, dass diese Tiere sich auch eine eigene innere Welt vorstellen und haben können, die sich von unserer menschlichen Erfahrung unterscheidet. Daher ist der Autor der Ansicht, dass wir die ursprüngliche verächtliche Haltung der überwiegenden Mehrheit der Menschen gegenüber Tieren ändern und unsere Einstellung ihnen gegenüber überdenken müssen. Eine derart empirische und relativ umfassende Diskussion verschiedener Fragen im Zusammenhang mit Tierträumen kann natürlich als Pionierarbeit zu diesem Thema angesehen werden. Das Buch ist nicht nur wegen seines Themas so attraktiv, sondern auch, weil es jede Menge interessantes experimentelles Material enthält und der Autor die Geschichte in einem lebendigen und brillanten Schreibstil erzählt, der die Leser dazu bringt, nicht mit der Lektüre aufhören zu können. Träumen Tiere? Das Interessanteste an dem Buch ist, dass der Autor anhand vieler Fakten überzeugend beweist, dass auch Tiere träumen: Verhaltensnachweise Der amerikanische Biologe David Shell züchtete einen Oktopus namens Heidi und beobachtete ihr seltsames Verhalten: Heidi ruhte zunächst friedlich, doch plötzlich veränderte sich ihre Hautfarbe von schneeweiß zu einem schimmernden Gelb mit orangefarbenen Flecken – so verhält sie sich normalerweise, wenn sie im Wachzustand eine Krabbe sieht – und wurde dann dunkelviolett. „Das ist normalerweise das, was ein Oktopus macht, wenn er nach einer erfolgreichen Tötung den Meeresboden verlässt“, erklärte Shell. Heidis Haut nahm dann eine Reihe heller Grau- und Gelbtöne an, doch dieses Mal waren die Farben kreuz und quer und ungeordnet über viele Streifen und scharfe Ecken verteilt. „Es ist eine Tarnung, als ob es gerade eine Krabbe gefangen hätte und sich gleich hinsetzen würde, um sie zu verspeisen, und nicht möchte, dass es jemand bemerkt.“ Auffällig ist, dass Heidis Farbwechselmuster und -abfolge immer exakt dieselben sind wie im Wachzustand beim Krabbenjagen, was nicht durch Zufall zu erklären ist. Eine plausible Erklärung ist, dass Heidi von Raubtieren träumt. Heidi zeigte im Schlaf kontinuierlich drei verschiedenfarbige Muster, wahrscheinlich weil sie in ihren Träumen Beute jagte und fraß | Quelle: Träumen Tiere? Elektrophysiologische Beweise Im Jahr 2000 dokumentierten die Biologen Amish Dave und Daniel Margoliash Muster neuronaler Aktivierung in einem Teil des Gehirns, der als Vogelgesangssystem bezeichnet wird, während eine Gruppe Zebrafinkenküken schlief. Sie fanden heraus, dass das Gehirn des Zebrafinken während des Schlafs zwischen zwei Zuständen wechselt: einem, in dem die neuronale Aktivität anhält, aber auf niedrigem Niveau ist; und ein anderes, bei dem in regelmäßigen Abständen spontan hohe Zündpegel erzeugt werden. Anschließend zeichneten sie neuronale Muster im selben Gehirnbereich auf, während die Vögel im Wachzustand das Singen übten. Die Ergebnisse zeigten, dass das Muster, das durch singende Bewegungen im Wachzustand ausgelöst wurde, strukturell identisch war mit dem Muster, das durch plötzliche Ausbrüche hoher neuronaler Aktivität während des Schlafs gekennzeichnet war. Die Übereinstimmung war so perfekt, dass sie feststellten, dass die beiden Note für Note zusammenpassen konnten. Sie kamen zu dem Schluss, dass Zebrafinken nicht nur im Wachzustand lautes Singen üben, sondern es auch im Schlaf gedanklich wiederholen, ohne zu zwitschern. Darüber hinaus verbrachten die Finken im Wachzustand etwa gleich viel Zeit mit Singen wie im Schlaf mit stillem Singen. Gleichzeitig wurden auch die Hörbereiche ihres Gehirns aktiviert. Dies bedeutet, dass der schlafende Vogel in der extremen Stille des Schlafs auch sein eigenes „stilles Lied“ zu „hören“ scheint. All diese Beweise deuten darauf hin, dass Zebrafinken im Traum singen können. Die Muster der Gehirnaktivität von Zebrafinken beim Singen im Wachzustand stimmten mit denen überein, die beim stillen Singen im Schlaf auftraten. Die Übereinstimmung ist so perfekt, dass Wissenschaftler die beiden Muster Note für Note zuordnen können. Bildquelle: Träumen Tiere? Funktionelle neuroanatomische Beweise Warum spielen Menschen die Handlungen, die sie in ihren Träumen erleben, nicht nach? Dies liegt daran, dass im Schlaf biochemische Veränderungen auftreten, die dazu führen, dass sich der Schläfer in einem Zustand der Muskelschwäche befindet und sich nicht mehr nach Belieben bewegen kann. Diese Veränderungen „verankern“ Verhaltensprogramme tief im Inneren des Schläfers. In den meisten Fällen sind schnelle Augenbewegungen die einzige motorische Komponente des Programms, die diesem Hemmungsprozess entgeht und extern ausgedrückt wird. Der französische Neurowissenschaftler Michel Jouve führte ein Experiment durch, bei dem er bei einer Gruppe von Katzen den dorsolateralen Teil der pontinen retikulären Formation entfernte. Die Studie zeigte, dass eine Schädigung dieser Gehirnstruktur zwar Muskelschwäche hemmt, jedoch nicht den REM-Schlaf. Die Ergebnisse waren schockierend. Als Katzen mit pontinen Schäden in den REM-Schlaf fielen, spielten sie ihre Träume tatsächlich aus. Sie stehen auf, miauen, bewegen sich, putzen sich und erkunden ihre Umgebung. Sie zeigen Freude, Wut, Angst, Erkundungsdrang usw. Manche Katzen starren ins Leere, als würden sie ihre Beute verfolgen und zum Sprung bereit sein, während andere in ihren Gehegen umherrennen und mit aller Kraft gegen imaginäre Feinde kämpfen, dabei aber tief und fest schlafen! Jouve sagte, er könne leicht daraus schließen, wovon jede Katze träume, indem er ihr Verhalten mit ihrem typischen Verhalten im Wachzustand vergleiche. Eine Katze im Labor von Michel Jouvet kämpft gegen einen imaginären Feind, nachdem ihr bei einer Operation die für Myasthenie verantwortlichen Neuronen in der Brücke entfernt wurden. Quelle: Träumen Tiere? Aus Platzgründen wird in diesem Artikel für jede Art von Beweis nur eines der vielen Beispiele aus dem Buch zitiert. Für sich genommen sind die einzelnen Beweisstücke vielleicht nicht überzeugend, doch zusammengenommen bilden diese Erkenntnisse ein starkes Beweisnetzwerk, das die Hypothese stützt, dass auch Tiere träumen. Der amerikanische Physiker und Nobelpreisträger Richard Feynman sagte einmal: „Was wir heute wissenschaftliche Erkenntnisse nennen, ist eine Sammlung von Aussagen mit unterschiedlichen Graden an Gewissheit. Einige davon sind höchst unsicher, andere nahezu sicher, aber keine ist absolut sicher.“[2] Angesichts all der oben genannten Beweise ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich immer noch um reinen Zufall handelt, sehr gering, daher halte ich die Annahme, dass auch Tiere träumen, für „nahezu sicher“. Tiere träumen, das heißt, sie sind bei Bewusstsein Bewusstseinsforscher sind sich im Allgemeinen einig, dass wir während Träumen bei Bewusstsein sind. Eine logische Folge davon ist, dass auch Tiere, die träumen, bei Bewusstsein sind. Es besteht kein Konsens darüber, was Bewusstsein ist. Der Autor ist der Ansicht, dass das Bewusstsein drei wichtige Aspekte umfasst: subjektives Bewusstsein, emotionales Bewusstsein und metakognitives Bewusstsein. Um zu beweisen, dass Träumen Bewusstsein anzeigt, betont der Autor zunächst, dass Träumen auch diese drei Aspekte hat, und beweist damit allgemein, dass Träumen eine hinreichende, aber keine notwendige Voraussetzung für Bewusstsein ist. Da Tiere nicht sprechen können, erklärt der Autor das subjektive Bewusstsein und das metakognitive Bewusstsein durch die Untersuchung menschlicher Träume und schlussfolgert, dass Tiere, da sie träumen können, diese Aspekte des Bewusstseins genauso besitzen sollten wie Menschen. Natürlich handelt es sich hierbei letztlich um eine indirekte Argumentation, die viel Spekulation enthält, daher müssen wir vorsichtig sein. Nur hat der Autor im Bereich der emotionalen Wahrnehmung mehr Ergebnisse aus der Tierforschung herangezogen und direkte Beweise geliefert. Subjektives Bewusstsein Dies hat zwei Aspekte: 1. Subjektives Existenzgefühl, d. h. das Gefühl, im Zentrum der eigenen Welt zu existieren und sich schon seit langer Zeit in dieser Position zu befinden; 2. Verkörpertes Selbstbewusstsein, also das Gefühl, selbstverständlich einen Körper zu haben. Zur Frage der Beziehung zwischen Träumen und subjektivem Bewusstsein betont der Autor, dass es, solange es einen Traum gibt, ein Selbst geben muss, um ihn zu verwirklichen, aufrechtzuerhalten und zu erleben. Wenn wir träumen, vermittelt uns dieses subjektive Zentrum das Gefühl, dass wir „da“ sind und dass das, was im Traum geschieht, mit uns geschieht. Egal wie unberechenbar, unlogisch oder absurd ein Traum auch sein mag, jeder Traum ist um ein Traumselbst herum organisiert, das „im“ Traum ist und das der Träumer letztlich als sich selbst identifiziert. Wir schauen unseren Träumen nie nur zu, wir sind Teil davon. Emotionales Bewusstsein Wir können uns in unseren Träumen glücklich oder traurig fühlen, was bedeutet, dass wir auch über ein emotionales Bewusstsein verfügen, wenn wir träumen. Auch dramatische Gefühlsveränderungen sind oft die treibende Kraft hinter den Träumen von Tieren. Um dieser Frage nachzugehen, haben sich der britische Neurowissenschaftler Olafs Doughty und ihr Team ein cleveres zweistufiges Experiment ausgedacht. Sie ließen eine Gruppe von Ratten eine räumliche Aufgabe ausführen. Nobelpreisträger O'Keefe entdeckte, dass die Aktivierung verschiedener Ortszellen im Hippocampus den unterschiedlichen Positionen des Tieres in einer vertrauten Umgebung entspricht. Durch die Aufzeichnung des Aktivierungssequenzmusters der Ortszellen im Hippocampus des Tieres ist es daher möglich, das innere Verständnis des Tieres für seine eigenen Positionsänderungen im umgebenden Raum zu verstehen. Sie verglichen die resultierenden Muster der Hippocampus-Aktivierung im Wachzustand und im Schlaf. In der ersten Phase konditionierten sie die Ratten auf ein T-förmiges Labyrinth, in dem der Zugang zu den beiden kleineren Armen des Labyrinths durch transparente Barrieren blockiert war. Die Ratten konnten auf dem Hauptweg des Labyrinths hin und her laufen und die beiden Verzweigungen sehen, konnten sie jedoch nicht wirklich erkunden. Der Experimentator brachte dann Motivation in das Szenario ein, indem er einen Arm mit einer Belohnung (ein paar Reiskörnern) markierte und den anderen Arm leer ließ. Dies erregte die Aufmerksamkeit der Ratten, und sie rannten zur Kreuzung der Labyrinthzweige und starrten eifrig auf den Haufen köstlichen Reises direkt vor ihnen. Nachdem sie mit dem Aufbau vertraut waren, wurden die Ratten aus dem Labyrinth genommen und durften ein Nickerchen machen. Während die Ratten schliefen, zeichneten die Forscher die Reihenfolge auf, in der einzelne Hippocampuszellen feuerten. Dadurch entstand eine „neuronale Karte“ der Erfahrungen der Ratten, die die „Reise“ der Ratten in ihren Träumen widerspiegelte. Olafsdottir und ihre Kollegen gehen von der Hypothese aus, dass die Ratten den markierten Arm des Labyrinths mental „vorerkunden“ und ihre Pfoten auf das gewünschte Objekt legen. Um ihre Hypothese zu testen, setzten sie die Ratten in der zweiten Phase des Experiments erneut in das Labyrinth, doch dieses Mal wurden die transparente Barriere, die den Eingang zum Reisarm blockierte, und der Reis selbst entfernt. Nachdem die Ratten wie vorhergesagt wieder eingeführt worden waren, rannten sie zur Kreuzung des T-Labyrinths und wandten sich sofort in die Richtung des zuvor mit Köder versehenen Arms, was darauf hindeutet, dass sie sich daran erinnerten, welcher Arm die leckere Belohnung enthielt, und erwarteten, sie dort zu finden. Selbst nachdem sie bemerkt hatten, dass der Reis weg war, verbrachten die Tiere mehr Zeit damit, den Arm zu erkunden, als Kontrollratten. Während die Ratten zwischen den Armen hin und her rannten, die zuvor die Belohnung gehalten hatten, zeichneten die Forscher Feuerungsereignisse im Hippocampus auf und stellten fest, dass die Muster, die damit verbunden waren, wann die Ratten diesen bestimmten Teil des Labyrinths physisch erkundeten, mit jenen identisch waren, die sie aufgezeichnet hatten, während die Ratten ein Nickerchen machten. Als die Ratten einschliefen, nachdem sie den Belohnungsarm gesehen, aber nicht erkundet hatten, feuerten dieselben Hippocampuszellen in derselben Reihenfolge, als ob sie den Arm nach einem Nickerchen erkundet hätten. Dies bestätigte zweifelsfrei, dass der Hippocampus in beiden Momenten dasselbe tat: einmal, als die Ratten einschliefen, nachdem sie die Belohnung gesehen hatten, und ein anderes Mal, als sie enttäuscht feststellten, dass der Bereich, den sie erkundet hatten, keine Belohnung mehr enthielt. Mit anderen Worten: Die Ratten erinnerten sich an Aspekte der realen Umgebung, die ihr emotionales Interesse weckten, und stellten sich aktiv eine „zukünftige Erfahrung“ vor, die ihre Wünsche wahr werden lassen würde. Diese Vorstellung entsteht, während sie schlafen. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Hinweise darauf, dass Tiere, die in ihrer Kindheit schwere psychische Traumata erlitten haben, auch als Erwachsene oft im Schlaf Anzeichen von Panik zeigen und dass manche Primaten sogar Zeichensprache verwenden, um anzuzeigen, dass sie Albträume haben. Dies ist ein starker Beweis für emotionales Bewusstsein in Träumen. Der in Gefangenschaft lebende Schimpanse Wasiu „spricht“ im Schlaf mit ASL-Zeichen. Hier macht es das ASL-Zeichen für das Wort „Kaffee“, wobei es unter anderem mit der rechten Hand etwas aufhebt und mit der linken Hand ein „C“ formt, wobei es mit der rechten Hand die linke umkreist und beide Hände von der Brust zur Decke wandert. Bildquelle: „Träumen Tiere?“ Metakognitives Bewusstsein Gelegentlich erlangen wir während eines Traums unsere metakognitiven Fähigkeiten zurück und erkennen in einem Moment der Klarheit, dass wir träumen. Der Träumer erlebt einen „klaren Traum“, in dem der Träumer seinen inneren Fokus vom Inhalt seines inneren Zustands auf seinen inneren Zustand als Ganzes verlagert. Mit anderen Worten: Der Träumer konzentriert sich nicht mehr auf die Dinge, die im Traum erscheinen, sondern auf den Traum selbst. Tierträume zeigen, dass auch Tiere Fantasie haben Im oben erwähnten Experiment zum räumlichen Träumen bei Ratten von Olafsdottir und seinem Team mussten sich die Ratten während ihres Nickerchens vorstellen, wie es wäre, durch einen Ort zu reisen, an dem sie noch nie zuvor gewesen waren. Dazu können sie nicht einfach vergangene Erinnerungen durchsuchen und wiedergeben. Sie müssen viele Fragmente alter Erfahrungen nutzen, um neue subjektive Erfahrungen zu schaffen. Die Ratten mussten sich ein mögliches Szenario vorstellen, das sie in der realen Welt noch nie erlebt hatten. Die Ratten erinnerten sich nicht; es ging um Extrapolation, also um die Fähigkeit, „sich selbst gedanklich in die Zukunft zu projizieren (…), um mit möglichen zukünftigen Ereignissen umzugehen, die man vorher noch nicht erlebt hat.“ Tierträume sind ein klarer Beweis für die Entstehung innerer Bilder ohne äußere Stimulation und weisen darauf hin, dass Tiere über Vorstellungskraft verfügen. Haben Tiere einen moralischen Status? Der Autor diskutiert die Tatsache, dass Tiere träumen können und dass sie über Bewusstsein und Vorstellungskraft verfügen, und widerlegt damit die früher weit verbreitete Vorstellung, dass Tiere bloße Bestien ohne innere Welt seien. Die Tatsache, dass Tiere träumen, legt nahe, dass es neben unserer Welt noch unzählige andere Welten gibt – völlig „andere“, nicht-menschliche Welten. Dies wirft auch ethische Fragen über den Status von Tieren als moralische Subjekte und darüber auf, wie wir sie behandeln sollten. Es wird allgemein angenommen, dass das Bewusstsein die Grundlage des moralischen Status ist, aber das Bewusstsein hat viele Aspekte. Welche Aspekte des Bewusstseins bilden die Grundlage des moralischen Status? Der Philosoph Block unterteilt das Bewusstsein in zwei Arten: „Zugangsbewusstsein“ und „phänomenales Bewusstsein“. Zugangsbewusstsein bezieht sich auf repräsentative innere Zustände, deren Inhalt vom umfassenderen kognitiven System verwendet werden kann, um Funktionen wie logisches Denken, Entscheidungsfindung und Sprachberichterstattung auszuführen; phänomenale Bewusstseinszustände sind nicht funktional. Sie haben keinen inhaltlichen Zusammenhang mit der Durchführung einer bestimmten kognitiven Operation. Sie führen nicht zu Schlussfolgerungen, willkürlichen Bewegungen oder kommunikativem Verhalten. Darüber hinaus ist ihr Inhalt eher wahrnehmungsbezogener als gegenständlicher Natur, was bedeutet, dass mit ihnen ein bestimmtes Gefühl verbunden ist, sie jedoch nichts in der Außenwelt darstellen. Ich kann es Ihnen nur entweder metaphorisch beschreiben oder Sie es selbst ausprobieren lassen. Doch trotz meiner ganzen Eloquenz werden meine Metaphern letztlich nicht überzeugen. Denn zwischen meiner persönlichen Erfahrung mit Rotwein und meiner Beschreibung besteht immer eine Lücke. Genau diese Lücke macht den Geschmack aus und diesen Geschmack kann man nur wirklich erfahren, wenn man ihn persönlich erlebt. Dadurch bildeten sich zwei große Lager. Vertreter der Theorie des Eintrittsbewusstseins glauben, dass das Eintrittsbewusstsein die Grundlage moralischen Wertes ist, während Vertreter der Theorie des sensorischen Bewusstseins glauben, dass der moralische Status durch sensorisches Bewusstsein erzeugt wird. Die Kluft zwischen diesen beiden Lagern lässt sich auf zwei unterschiedliche Ansichten des moralischen Lebens reduzieren: Eine, die sich auf Erkenntnis, Rationalität und Sprache konzentriert, und eine andere, die weniger Wert auf intellektuelle Ansätze legt und stattdessen unsere subjektiven, emotionalen und verkörperten Wurzeln in der Welt in den Vordergrund stellt. Der Autor ist davon überzeugt, dass Empfindungsbewusstsein der Schlüssel zum moralischen Status ist. Nach Auffassung des Autors ist es das Wahrnehmungsbewusstsein, das eine Wertzuweisung ermöglicht. Es ermöglicht biologischen Organismen, Werte in ein ansonsten wertloses Universum einzubringen. Ein Lebewesen ohne Empfindungsvermögen hätte keine lebendige Erfahrung der Welt, kein Gefühl für das Hier und Jetzt, kein Gespür dafür, was positiv oder negativ ist (oder, mit anderen Worten, was gut oder schlecht ist). Selbst wenn ein solches Lebewesen in der Lage wäre, eine Vielzahl kognitiver Funktionen auszuführen, hätte es niemals Werte. Ohne Wahrnehmungsanker fehlt die Grundlage für die Wertzuweisung und es können keine Vorlieben, Interessen oder Wünsche entstehen. Ein solches Lebewesen hätte keinen Anreiz, eine Sache einer anderen vorzuziehen. Ein Universum, das nur von solchen Lebewesen bewohnt würde, wäre ein Universum ohne Subjekte, die in der Lage wären, Werte zuzuweisen, und wäre daher ein Universum ohne jeglichen Wert. Meiner Meinung nach glaubt der Autor, dass der moralische Status eines Tieres eher davon abhängt, ob es über ein Wahrnehmungsbewusstsein verfügt, als davon, ob es ins Bewusstsein eintritt. Obwohl er seine Gründe hat, bin ich der Meinung, dass Wahrnehmungsbewusstsein lediglich eine notwendige Voraussetzung für moralischen Status ist, aber nicht unbedingt ausreichend. Obwohl der Autor in seinem Buch Lebewesen erfindet, die nur ins Bewusstsein gelangen, aber kein Bewusstsein wahrnehmen können, verwendet er in manchen Fällen einfach autonome Roboter, die nur ins Bewusstsein gelangen können, als Beispiel, um zu verdeutlichen, dass das Erreichen des Bewusstseins nichts mit dem moralischen Status zu tun hat. Ich bezweifle jedoch, dass es solche Kreaturen wirklich auf der Welt gibt. Noch zweifelhafter ist die Aussage, ein Roboter sei über ein Bewusstsein verfügt, nur weil er logisch denken, sich bewegen und sprechen kann. Ich denke, dass Lebewesen, die ein Bewusstsein erlangt haben, zunächst über ein Wahrnehmungsbewusstsein verfügen. Die Behauptung des Autors, autonome Roboter, die lediglich „ein Bewusstsein erlangen“, aber kein „Bewusstsein wahrnehmen“, sollten keinen moralischen Status haben, ist ein von ihm selbst aufgestelltes Strohmannargument, da solche Roboter überhaupt kein Bewusstsein haben und von einem moralischen Status natürlich keine Rede sein kann. Die wirkliche Frage, die es zu erwägen gilt, ist, ob Tiere mit Empfindungsvermögen einen moralischen Status haben sollten oder ob Tiere, die sowohl Empfindungsvermögen als auch Bewusstsein haben, einen moralischen Status haben sollten. Der Autor hat diese Frage im Buch nicht beantwortet. Der Autor ist schließlich der Ansicht, dass Tiere, die träumen können, als Mitglieder der moralischen Gemeinschaft anerkannt werden sollten und dass man sich um sie als Mitgeschöpfe kümmern, sie respektieren und ihnen Würde entgegenbringen sollte. Wenn ein Subjekt einen moralischen Status hat, können wir es nicht behandeln, wie es uns gefällt. Obwohl ich in dieser Hinsicht mit der Meinung des Autors übereinstimme, dass bewusste Tiere nicht misshandelt werden sollten, stimme ich auch zu, dass Menschen nicht die einzigen Lebewesen sind, die träumen, ein Bewusstsein haben und einen moralischen Status besitzen; Da dieses Thema jedoch über den Rahmen der Naturwissenschaften hinausgeht und eine Frage persönlicher Meinungen ist, habe ich Zweifel an der Ansicht des Autors, dass wir keine Tiere industriell züchten, keine traumatischen Tierversuche für wissenschaftliche Forschungszwecke durchführen und Tiere nicht einmal wie Menschen behandeln sollten. Es stimmt, dass einige Wissenschaftler Vegetarier geworden sind, nachdem sie sich mit der Frage des Bewusstseins beschäftigt haben, aber ich persönlich möchte das nicht. Dies ist möglicherweise eine Frage, die immer kontrovers sein wird! Kurz gesagt, dies ist das erste Meisterwerk, das systematisch Tierträume und ihre Bedeutung vorstellt. Auch wenn die Leser (einschließlich des Autors) möglicherweise nicht mit jedem seiner Argumente einverstanden sind, haben die Ansichten des Autors dennoch ihre Grundlage, und selbst wenn Sie anderer Meinung sind, sollten Sie ernsthaft über seine Argumente und Beweise nachdenken. Im Allgemeinen ist das gesamte Buch gut miteinander verbunden und integriert; es ist sowohl interessant als auch argumentativ streng. Man kann dieses Buch als Pionierarbeit bezeichnen, die Tierträume aus der Perspektive der Wissenschaft, Philosophie und Ethik diskutiert. Für alle an diesen Themen interessierten Leser lohnt es sich, aufmerksam zu lesen, darüber nachzudenken und eigene Schlüsse zu ziehen. Verweise [1] David Peña-Guzmán, trans. Gu Fanji (2023), Träumen Tiere? ——Das geheime Reich des tierischen Bewusstseins. Shanghai: Shanghaier Wissenschafts- und Technologieverlag. [2] Michelle Feynman (Hrsg.), Übers. Wang Zuzhe (2020), Die Feynman-Zitate. Changsha: Hunan Wissenschafts- und Technologieverlag. Dieser Artikel wird vom Science Popularization China Starry Sky Project unterstützt Produziert von: Chinesische Vereinigung für Wissenschaft und Technologie, Abteilung für Wissenschaftspopularisierung Hersteller: China Science and Technology Press Co., Ltd., Beijing Zhongke Xinghe Culture Media Co., Ltd.
1. Gehen Sie zur „Featured Column“ unten im Menü des öffentlichen WeChat-Kontos „Fanpu“, um eine Reihe populärwissenschaftlicher Artikel zu verschiedenen Themen zu lesen. 2. „Fanpu“ bietet die Funktion, Artikel nach Monat zu suchen. Folgen Sie dem offiziellen Account und antworten Sie mit der vierstelligen Jahreszahl + Monat, also etwa „1903“, um den Artikelindex für März 2019 zu erhalten, usw. |
>>: Wie bringen wir Maschinen das Lernen bei?
Artikel empfehlen
Diese Bereiche der Meereswissenschaft und -technologie haben fruchtbare Ergebnisse erzielt!
◎Sun Mingyuan, Praktikant bei Science and Technol...
Können wir öffentliches kostenloses WLAN weiterhin problemlos nutzen?
Ich habe in letzter Zeit viele Berichte gesehen, ...
Lasst uns Karaoke singen! 》:Warum singen wir falsch?
Der Film „Lasst uns Karaoke singen!“ Der Protagon...
Wie viel Trainingsintensität
Egal, wer Sie sind, Sie dürfen bei der Wahl der T...
Apollo verwandelt sich in einen schwungvollen Mönch, und autonomes Fahren hat gerade erst begonnen, die zukünftige industrielle Ökologie zu verändern
Am 28. September brachten Baidu Apollo und die Be...
„Je stärker Wind und Wellen, desto mehr Fische gibt es“? Doch die Gefahr ist noch größer! (Expo Daily)
„Je stärker Wind und Wellen, desto mehr Fische gi...
Was sind Laufsportgeräte?
Unter den vielen Sportarten ist Laufen für viele ...
Mama, Mama, Mama, warum fühlt sich mein Körper so taub an?
Immer wenn wir taumelnd und langsam an der Wand e...
Weil ich etwas Seltsames gesehen habe, wurde meine Erinnerung an die Zeit vor meinem dritten Lebensjahr gelöscht?
Wenn ich genau darüber nachdenke, hatte ich zum e...
Sit-up-Techniken
Sit-ups sind eine sehr verbreitete Übung, die nic...
Welche Tipps gibt es zum Abnehmen durch Sport?
Manche Menschen, die gerne Fitnessübungen machen,...
Methoden der körperlichen Betätigung
Viele Menschen mögen körperliche Betätigung in ih...
Die Größe L wurde wieder auf Größe S geändert! Warum laufen Pullover immer ein? ?
Ein warmer Wollpullover Im Winter ist er ein Must...
In einer Zeit, in der die Luft- und Raumfahrt nicht geschätzt wird, schreiben Wissenschaftler ihre Forschung lieber in Romane
Die Rückkehrkapsel des bemannten chinesischen Rau...
Was sind die Meridian-Yoga-Stellungen?
Yoga ist heute ein sehr beliebter Sport und übera...