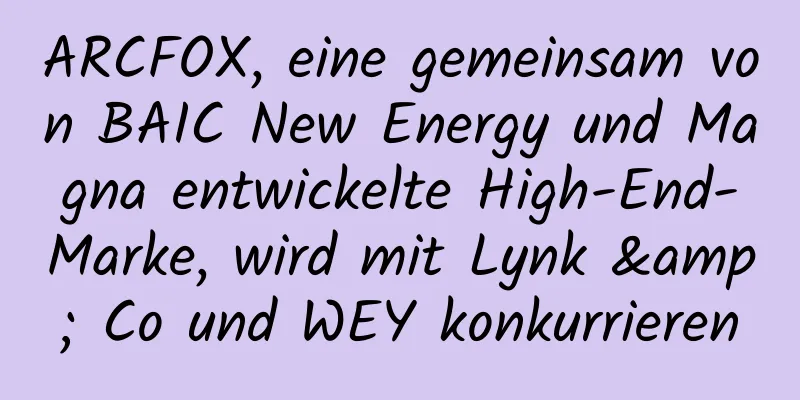Wie hat Leonardo da Vinci Sie mit der Mona Lisa „ausgetrickst“?丨Art Sea Collection
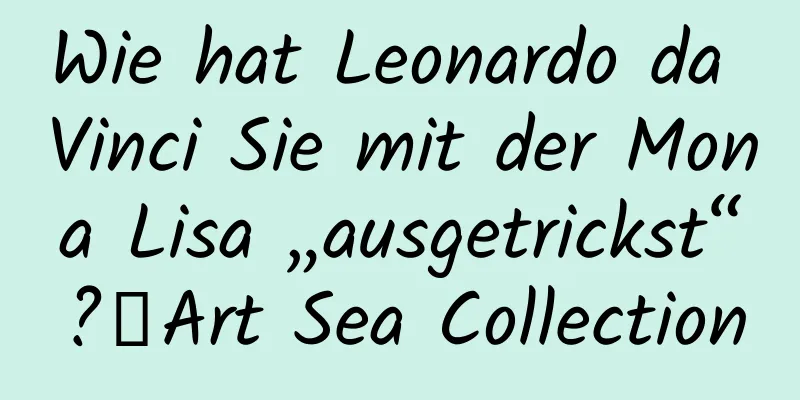
|
Leonardo da Vincis „Mona Lisa“ ist sehr berühmt, aber wer weiß, wer die Frau auf dem Gemälde ist? Warum hat Leonardo da Vinci ihr Porträt gemalt? Warum hat die Version, die wir jetzt sehen, keine Augenbrauen und Wimpern? Gibt es andere Versionen? Geschrieben von | Zhang Yi Ein angenehmes Lächeln scheint eher göttlich als menschlich, ... ein Lächeln, das wahrhaftig und authentisch die Essenz des Lebens widerspiegelt. ——Giorgio Vasari (Hinweis: Dies ist eine Übersetzung des Autors aus Vasaris Diskussion über Leonardo da Vincis Gemälde „Mona Lisa“ in seiner Biografie.) „ 1 Der Name und die Herkunft der „Mona Lisa“ „Mona Lisa“ (Abbildung 1) stammt aus einer Transliteration. Mona leitet sich vom italienischen Wort Madonna ab, abgekürzt als Monna oder Mona, das normalerweise vor einem Frauennamen steht. Mona Lisa bedeutet eigentlich „Frau Lisa“. Ein anderer Name für dieses Gemälde ist „Gioconda“, was vom italienischen Wort Gioconda stammt, der weiblichen Schreibweise des Nachnamens Giocondo. Auf Italienisch bedeutet Gioconda „Freude und Glück“, daher kann Gioconda auch mit „glückliche Frau“ übersetzt werden. Der Name hat aufgrund des markanten Lächelns der Frau auf dem Gemälde eine doppelte Bedeutung. Mona Lisa oder Gioconda sind die gebräuchlichen Namen dieses Gemäldes. Wir werden in diesem Artikel den Namen „Mona Lisa“ verwenden. Abbildung 1. Leonardo da Vinci, Mona Lisa, Ölgemälde auf Holztafel, 1503–1517, Höhe 77 cm, Breite 53 cm, jetzt im Louvre-Museum ausgestellt | Bildquelle: Wikipedia 2Wer ist die Mona Lisa auf dem Gemälde? Laut Vasari malte Leonardo da Vinci einst ein Porträt der Mona Lisa, der Frau von Francesco del Giocondo. Er brauchte dafür vier Jahre, wurde aber nie fertiggestellt. Als Vasari seine Biografie schrieb, wurde das Gemälde von König Franz I. von Frankreich im Schloss Fontainebleau gesammelt. Die überwiegende Mehrheit der Kunsthistoriker ist davon überzeugt, dass es sich bei der Mona Lisa, die heute im Louvre ausgestellt ist, um das in Vasaris Biografie erwähnte Porträt von Giocondos Frau handelt. Doch es gibt immer Menschen, die Autoritäten gerne in Frage stellen, und die kunsthistorische Forschung bildet hier keine Ausnahme. Einige Wissenschaftler weisen darauf hin, dass es sich bei dem im Schloss Fontainebleau gesammelten Gemälde möglicherweise nicht unbedingt um die von Vasari erwähnte „Mona Lisa“ handelt. Diese Leute glauben, dass es sich bei der Person auf dem Louvre-Gemälde um eine andere Italienerin aus der Zeit Leonardo da Vincis handeln könnte. Isabella d’Este (1474–1539); Isabella von Aragon (1470–1524); Cecilia Gallerani (1473-1536); Caterina Sforza (1463–1509); usw. oder sogar Leonardo da Vincis Assistent Salaì (1480-1524) oder Leonardo da Vinci selbst. Natürlich haben diese Wissenschaftler, die verschiedene Kandidaten vorschlagen, alle ihre eigenen Theorien und können verschiedene interessante Geschichten erzählen. Im Jahr 2005 beendete die Entdeckung von Dr. Armin Schlecter, einem Administrator der Universitätsbibliothek Heidelberg, fast alle der oben genannten Spekulationen und Debatten. Beim Sortieren der Bücher stieß er auf eine Ausgabe von Ciceros Epistulae ad familiare, die 1477 in Bologna erschienen war. In einer der leeren Stellen befand sich eine im Oktober 1503 verfasste Notiz von Agostino Matteo Vespucci (1462-1515). Vespucci verglich Leonardo da Vinci mit dem antiken griechischen Maler Apelles (tätig im 4. Jahrhundert v. Chr.) und wies darauf hin, dass Leonardo da Vinci zu dieser Zeit gerade ein Porträt von Lisa del Giocondo malte (Abbildung 2). Abbildung 2. Eine Seite aus der Korrespondenz von Cicero in der Sammlung der Universitätsbibliothek Heidelberg mit einer Notiz von Agostino Vespucci aus dem Jahr 1503, aus der hervorgeht, dass Leonardo an einem Porträt von Lisa del Giocondo arbeitete. (Die grüne Linie unter Lisa del Giocondo im Bild wurde vom Autor hinzugefügt) Agostino Vespucci, der Verfasser dieser Notiz, war nicht nur ein florentinischer Regierungsbeamter, sondern auch Assistent des zweiten Staatssekretärs Niccolò Machiavelli (1469-1527), einem Freund von Leonardo da Vinci. Vespucci verfasste außerdem relevante historische Dokumente zu Leonardo da Vincis bevorstehender „Schlacht von Anghiari“, um dem Maler zu helfen, die Schlacht zu verstehen. Vor diesem Hintergrund ist die überwiegende Mehrheit der Historiker und Kunsthistoriker der Ansicht, dass es sich bei der Mona Lisa auf dem Gemälde um die von Vasari erwähnte Lisa del Giocondo handeln müsse. Obwohl Vincent Delieuvin, ein Kurator des Louvre, dieser Identifizierung damals in einem Fernsehinterview skeptisch gegenüberstand, argumentierte er, Schlechtels Entdeckung sei kein vollständiger Beweis dafür, dass es sich bei der auf dem Louvre-Gemälde dargestellten Figur um die in Vespuccis Notizbüchern erwähnte Lisa del Gioconda handele. Die von Leonardo da Vinci in „Mona Lisa“ gemalte Frau hieß ursprünglich Lisa di Antonmaria Gherardini (15. Juni 1479 – 15. Juli 1542). Sie war eine in Florenz geborene Adlige. Ihre Familie Gherardini lässt sich bis ins antike Rom zurückverfolgen und behielt den Adelstitel auch nach der Einigung Italiens. Als sie geboren wurde, hatte ihre Familie keinen großen politischen Einfluss in Florenz und war wirtschaftlich nicht so bedeutend wie die Familien Medici, Strozzi, Rucellai und andere, obwohl sie gewisse Verbindungen zu diesen mächtigsten Familien hatte. Am 5. März 1495 heiratete sie Francesco di Bartolomeo del Giocondo (1465–1538), einen wohlhabenden Florentiner Geschäftsmann, der in der Bekleidungs- und Seidenindustrie tätig war. Letzterer war finanziell mächtig. Er war nicht nur der Anführer der Florentiner Seidengilde, sondern hatte auch eine Position in der Florentiner Regierung inne. Es muss gesagt werden, dass es sich hierbei um eine Verbindung zwischen einer traditionellen Adelsfamilie und aufstrebenden bürgerlichen, wohlhabenden Geschäftsleuten handelt. Nach ihrer Heirat wurde ihr Name in Lisa del Giocondo geändert, und um die Leute auf ihren adeligen Familienhintergrund aufmerksam zu machen, wurde sie auch Lisa di Gherardini del Giocondo genannt. Ihr Ehemann, Francesco del Giocondo, war ebenfalls Kunstsammler und es ist wahrscheinlich, dass das Paar zu Lebzeiten Kontakt zu Vasari hatte. Obwohl die überwiegende Mehrheit der Kunsthistoriker seit der Entdeckung des Gemäldes in der Universitätsbibliothek Heidelberg im Jahr 2005 davon ausgeht, dass es sich bei der Mona Lisa auf dem Gemälde um die Florentinerin Lisa del Gioconda handelt, gibt es immer noch eine sehr kleine Zahl von Menschen, die darauf bestehen, dass es sich bei der Frau auf dem Gemälde um Isabella d'Este, Marquise von Mantua (Abbildung 3), handeln muss, eine herausragende Politikerin und wichtige Kunstmäzenin während der italienischen Renaissance. Vielleicht meinen sie, dass die legendären Gemälde, die Leonardo da Vinci uns überliefert hat, die großen Persönlichkeiten dieser Zeit darstellen müssten? Abbildung 3. Leonardo da Vinci, Porträt von Isabella d’Este, Skizze, um 1500, Höhe 61 cm, Breite 46,5 cm, jetzt im Louvre-Museum | Bildquelle: Wikipedia Überlieferten historischen Dokumenten zufolge kam Leonardo da Vinci etwa zwischen 1499 und 1500 nach Mantua, um den Unruhen zu entgehen, die durch den Einmarsch der französischen Armee in Mailand verursacht wurden. Er wurde von der Herrscherin der Stadt, der Marquise Isabella d'Este, bewirtet und versprach, ihr Porträt zu malen. Zur Vorbereitung dieses Porträts fertigte Leonardo da Vinci eine Skizze für die Marquise an (Abbildung 3). Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass Leonardo da Vinci das Ölporträt nicht vollendete, da wir noch immer zwei Briefe lesen können, die sie am 14. Mai und 31. Oktober 1504 an Leonardo da Vinci schrieb. In beiden Briefen wird das Porträt erwähnt, das Leonardo da Vinci ihr zu zeichnen versprochen, aber noch nicht fertiggestellt hatte. Darüber hinaus erklärte der Botschafter Mantuas in Florenz in einem Bericht an die Marquise, er werde sein Bestes tun, um Leonardo da Vinci zur Fertigstellung des Porträts zu drängen. Diese sagte jedoch auch, er könne nicht garantieren, dass Leonardo da Vinci das Gemälde fertigstellen würde. Daher können wir davon ausgehen, dass Leonardo da Vinci das Porträt Ende 1504 noch nicht fertiggestellt hatte. 3Warum hat Leonardo da Vinci Lisa del Gioconda gemalt? Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts war Leonardo da Vincis künstlerischer Ruf in Italien auf seinem Höhepunkt und viele Fürsten, Adlige und hochrangige Beamte des Vatikans hofften, ihn bitten zu können, ihre Porträts zu malen. Doch Lisa del Gioconda und ihr Mann gehörten offensichtlich nicht zu den angesehensten und finanziell nicht besonders gut ausgestatteten Personen. Warum war Leonardo da Vinci bereit, ihre Porträts zu malen? Zunächst einmal können wir aus den in Florenz hinterlassenen Dokumenten erfahren, dass Lisa und ihr Mann einst in einer Straße in der Nähe der Basilika Santa Croce in Florenz lebten. Ihr Haus lag ganz in der Nähe des Hauses von Leonardo da Vincis Vater. Als Anwalt und Notar hätte Leonardo da Vincis Vater Lisas Ehemann professionelle Dienste leisten sollen. Wahrscheinlich war es die Verbindung zwischen den beiden Familien, die Francesco del Giocondo im Jahr 1503 dazu veranlasste, bei Leonardo da Vinci ein Porträt seiner Frau in Auftrag zu geben. Darüber hinaus wollte Leonardo da Vinci die Mona Lisa malen, eine edle Frau mit relativ geringer Macht, vielleicht weil er sich durch das Motiv seines Gemäldes nicht stören lassen wollte. So malte Tizian beispielsweise einst ein Porträt der bereits erwähnten Marquise Isabella d’Este. Da diese jedoch mit dem Porträt des großen Malers, das ihr Alter getreu wiedergab, unzufrieden war, zwang sie Tizian, ein neues Porträt zu malen, auf dem sie jünger und schöner aussah. Vergleicht man es mit ähnlichen Werken aus derselben Zeit, fällt leicht auf, dass Leonardo da Vincis Porträt der Mona Lisa völlig frei von den verschiedenen Arten von Juwelen ist, die damals auf typischen Porträts aristokratischer Frauen sorgfältig aufgemalt wurden. Hier lenkte der Maler die Aufmerksamkeit des Publikums vollständig auf die Frau im Gemälde, insbesondere auf ihr Gesicht. Leonardo da Vinci kombinierte sein Wissen über Anatomie, Optik und verschiedene künstlerische Kenntnisse und Erfahrungen, die er in der Vergangenheit erworben hatte, um das Idealbild einer schönen Frau zu malen. 4 Wie ist Vasaris Beschreibung des Gemäldes Mona Lisa zu verstehen? Um das Gemälde Mona Lisa besser zu verstehen, können wir zunächst Vasaris Beschreibung in seiner Biografie von Leonardo da Vinci lesen: Jeder kann anhand dieses Kopfes verstehen, wie weit die Kunst bei der Nachahmung der Natur gehen kann, denn Leonardo hat jedes Detail mit seiner zarten Hand wiedergegeben. Die hellen, feuchten Augen, die nur im wirklichen Leben auf dem Gesicht einer realen Person zu sehen sind, und die sie umgebenden Wimpern mit ihrem rötlichen Farbton können ohne äußerst zarte und feine Pinselführung nicht zum Ausdruck gebracht werden. Die Augenbrauen sind so realistisch wie möglich gemalt, da sie den Zustand des auf der Haut wachsenden Haares zeigen – je nach Verteilung der Poren in der Haut an manchen Stellen dick und an anderen spärlich. Die Nasenspitze ist naturgetreu und rosa gefärbt, und die Nasenlöcher wirken äußerst zart. Der Mund ist leicht geöffnet, und das Rot der Lippen geht natürlich in das Rosa der Wangen über, was so realistisch aussieht, dass man nicht auf die Idee kommen würde, es handele sich um ein Gemälde. (Hinweis: Der Autor hat es gemäß dem Originaltext übersetzt) Wenn man nur diese Passage liest, könnte man meinen, es handele sich um die Beschreibung eines Frauenporträts, das ein französischer Rokoko-Maler im 18. Jahrhundert gemalt hat (siehe Abbildung 4). Warum unterscheidet sich Vasaris Beschreibung der Gemälde Leonardo da Vincis so sehr von den Gemälden, die wir sehen? Eine einfache Erklärung dafür ist, dass die Reinigung und Restaurierung des Gemäldes in den letzten paar hundert Jahren sowie die Schäden und der Staub, die mit der Zeit auf dem Gemälde entstanden sind, seine Farbe und sein Aussehen in gewissem Maße verändert haben. Abbildung 4. Boucher, „Madame Pompadour“ (teilweise), Öl auf Leinwand, 1756, Höhe 212 cm, Breite 164 cm, jetzt ausgestellt in der Alten Pinakothek in München, Deutschland, Bild aus Wikipedia. Das Prado-Museum im spanischen Madrid zeigt ein Gemälde der „Mona Lisa“ aus Leonardo da Vincis Atelier. Es wurde wahrscheinlich gleichzeitig von einem Assistenten in seinem Atelier unter Anleitung von Leonardo da Vinci gemalt, als dieser an der „Mona Lisa“ malte. Das Prado-Museum hat es kürzlich gereinigt und das fertige Gemälde soll die Leser daran erinnern, wie Leonardos Gemälde ausgesehen haben sollten (Abbildung 5). Um die Veränderungen des Bildbildes durch die Reinigung besser verständlich zu machen, zeigen wir den Lesern zusätzlich das Foto vor der Reinigung (Abbildung 5a), damit jeder selbst einen Vergleich anstellen kann. Abbildung 5. Atelier von Leonardo da Vinci, „Mona Lisa“, Ölgemälde auf Holz, ca. 1503–1516, 76,3 cm hoch, 57 cm breit, jetzt ausgestellt im Prado-Museum in Madrid, Spanien | Bildquelle: Wikipedia Abbildung 5a. Die Prado-Version der „Mona Lisa“ vor der Reinigung | Bildquelle: Wikipedia Vergleicht man die Mona Lisa im Louvre mit Vasaris Beschreibung, fällt als Erstes auf, dass die Augenbrauen und Wimpern der Frau auf dem Gemälde völlig verschwunden sind, vielleicht aufgrund der Reinigung, die in der Vergangenheit vorgenommen wurde. Doch der lavierte Prado-Abzug (Abb. 6 und Abb. 6a) gibt uns vielleicht einige Hinweise und lässt uns erahnen, wie die Augenbrauen und Wimpern der Frau auf dem Gemälde ursprünglich aussahen. Abbildung 6. Teil der Louvre-Version der „Mona Lisa“ ohne Augenbrauen und Wimpern | Bildquelle: Wikipedia Abbildung 6a. Augenbrauen und Wimpern der Mona Lisa, Teil der Prado-Version der „Mona Lisa“ | Bildquelle: Wikipedia 5. Eine kurze Analyse der Mona Lisa im Louvre Betrachtet man die Louvre-Version der „Mona Lisa“ genauer, erkennt man, dass die Frau auf dem Gemälde uns anzulächeln scheint. Bei genauerem Hinsehen wirkt sie jedoch unsicher und in ihrem Gesichtsausdruck scheint ein Hauch von Sarkasmus und Spott zu liegen. Als Leonardo da Vinci das Gesicht der Mona Lisa malte, mischte er zwei spezielle Techniken: Sfumato und Chiarosuro. Ersteres wird allgemein als Erfindung Leonardo da Vincis angesehen, während die Erfindung des Letzteren etwas umstritten ist. Aber auf jeden Fall ist das von Leonardo da Vinci verwendete Helldunkel sehr charakteristisch für ihn. Durch die Verwendung dieser beiden Maltechniken sind die Umrisse der Figuren im Gemälde weniger deutlich erkennbar. Es sind diese leicht verschwommenen Umrisse und die sanften Farben, die einen natürlichen Übergang zwischen den Organformen und der Gesichtshaut der Figuren im Gemälde schaffen. Dadurch wird das etwas steife Gefühl der Figuren in den Gemälden von Leonardo da Vincis Vorgängern und Zeitgenossen in der Renaissance vermieden und gleichzeitig Raum für die Vorstellungskraft des Betrachters gelassen. Der Leser kann die „Mona Lisa“ mit den früheren Werken von Ghirlandaio und Botticelli sowie mit Raffaels Werken aus derselben Zeit vergleichen (Abbildungen 7, 8 und 9). Abbildung 7. Botticelli, Simoneda Vaspucci als Fee, Tempera auf Holz, 1480, 81,8 cm hoch, 54 cm breit, jetzt ausgestellt im Städel Museum in Frankfurt, Deutschland | Bildquelle: Wikipedia Abbildung 8. Domenico Ghirlandaio, „Porträt von Giovanna Tornabuoni“; Tempera und Öl auf Holz, circa 1489–1490, 75,5 cm hoch, 49,5 cm breit, jetzt ausgestellt im Collection Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid, Spanien | Bildquelle: Wikipedia Abbildung 9. Raffael, „Junge Frau mit Einhorn“, Ölgemälde, ca. 1505–1506, Höhe 65 cm, Breite 51 cm, jetzt ausgestellt in der Galleria Borghese in Rom | Bildquelle: Wikipedia Besonders bemerkenswert ist, dass die lächelnden Lippen der Mona Lisa grundsätzlich leicht nach oben gebogen sind, an den äußersten Enden jedoch leicht nach unten zeigen, was dem Lächeln der Frau auf dem Gemälde eine geheimnisvolle, ironische und sogar eine Spur von Traurigkeit verleiht (Abbildung 10). Es sollte gesagt werden, dass der Grund, warum das Lächeln der Mona Lisa so bezaubernd ist, darin liegt, dass sein Ausdruck beim Betrachter ein Gefühl der Unberechenbarkeit hervorruft. **Leonardo da Vinci hat diese Lippenbewegung sorgfältig studiert, und wir können Spuren davon in seinen Notizen finden (Abbildung 10a). Aus einigen anderen Skizzen dieser Zeit können wir auch ersehen, dass Leonardo da Vinci das Mysterium studierte, das die Bewegung der Lippen dem Gesicht verleiht (siehe Abbildung 10b). Abbildung 10. Lippen der Mona Lisa in der Louvre-Version | Bildquelle: Wikipedia Abbildung 10a. Leonardo da Vinci, Lippenstudie (Detail), Skizze, ca. 1508, British Royal Collection. Abbildung 10b. Leonardo da Vinci, Studie des Kopfes der Mona Lisa, Skizze, gezeichnet zwischen 1505 und 1508, 20 cm hoch und 16,2 cm breit, in der British Royal Collection. Wenn Sie das Gemälde „Mona Lisa“ schon oft gesehen haben, werden Sie feststellen, dass sich die Frau auf dem Gemälde ständig zu verändern scheint. Jedes Mal, wenn Sie sie sehen, fühlt sie sich anders an als beim letzten Mal. Darüber hinaus sieht die Frau auf dem Gemälde aus verschiedenen Blickwinkeln oder sogar aus dem gleichen Blickwinkel, aber zu unterschiedlichen Zeitpunkten, anders aus. Dies liegt daran, dass Leonardo da Vinci bei der Erstellung dieses Werks sein gesamtes Wissen aus der Analyse des menschlichen Gesichts zusammenführte, wie etwa die Beziehung zwischen Lippen und Gesichtsmuskelbewegungen und die Licht- und Schatteneffekte, die das Gesicht im Licht erzeugt (Abbildungen 11 und 11a). Gleichzeitig trug er mit äußerst zarten Pinselstrichen Schicht für Schicht transparente, mit Öl vermischte Pigmente auf, um einen besonderen Effekt zu erzielen. Da während des Malprozesses die Pinselstriche in den verschiedenen Schichten nicht in die gleiche Richtung weisen und die Farbdicke nicht exakt gleich ist, sowie durch den geschickten Einsatz von Verblassen und Hell-Dunkel-Effekten, sieht die Frau auf dem Gemälde nicht nur wie eine lebende Person aus, sondern vermittelt den Menschen auch das Gefühl, dass sie eine reale Person ist. Aufmerksame Menschen werden jedes Mal, wenn sie sie sehen, das vage Gefühl haben, dass sie sich irgendwo verändert zu haben scheint. Abbildung 11. Leonardo da Vinci, Studie der Gesichtsmuskeln und Arme, Skizze, 1510–1511, Höhe 28,8 cm, Breite 20 cm, British Royal Collection. Abbildung 11a. Leonardo da Vinci, Studie eines einzelnen Lichtpunkts auf einem Gesicht, Skizze, 1488, Höhe 20,3 cm, Breite 14,3 cm, British Royal Collection. 5.1 Transparenter Schal im Gemälde In der Antike gab es keine Fototechnik. Nur eine sehr kleine Zahl wohlhabender Menschen konnte Maler beauftragen, ihre Porträts zu malen. Selbst die Reichen und Mächtigen konnten nur wenige Porträts von sich hinterlassen. Daher trugen Frauen damals normalerweise den teuersten oder ihren Lieblingsschmuck im Haus, in der Hoffnung, ihren Altersgenossen durch Porträts ihr Image und ihre Identität zu zeigen und diese an zukünftige Generationen weiterzugeben (siehe Abbildungen 7, 8 und 9). Als das Gemälde im Louvre kürzlich mithilfe moderner Technologie untersucht wurde, stellte sich heraus, dass Leonardo den Schmuck auf dem Kopf der Frau auf die Ölfarbe des Gemäldes gemalt hatte, später jedoch den gesamten Schmuck von ihrem Körper entfernte, vermutlich um dem Betrachter die Möglichkeit zu geben, sich auf das Gesicht der Person im Gemälde zu konzentrieren. Um jedoch einen natürlichen Übergang zwischen der Figur und dem Hintergrund zu schaffen, behielt er den zarten und durchsichtigen Schleier auf Mona Lisas Kopf bei, der damals im Italien des spanischen Stils sehr modisch war. Es war teuer und luxuriös und verriet auch den sozialen Status und Beruf ihrer Familie. Aus künstlerischer Sicht erzeugt der transparente Schal einen allmählichen Farbübergang zwischen den Haaren und der Haut im Gesicht der Figuren im Gemälde sowie zwischen den Haaren und der Landschaft dahinter, obwohl wir die Ränder des Schals sehen können. Durch den Schleier können wir den Glanz der Haut auf Mona Lisas Stirn sehen, während der Teil außerhalb des Haares, der den Himmel und die Landschaft in der Ferne verdeckt, durch seine Verdunkelung eine deutlichere Textur aufweist. Leonardo da Vinci hat hier zweifellos seine unglaubliche Einsicht und Vorstellungskraft unter Beweis gestellt. 5.2 Landschaft Anders als bei Porträts der frühen Renaissance oder der Gegenwart, bei denen die Figuren in realistischen Landschaften oder Innenräumen dargestellt wurden, entstammt die Landschaft der Mona Lisa größtenteils der Fantasie Leonardo da Vincis, was ihr eine surreale Atmosphäre verleiht. Die schroffen und gewundenen Pfade und Brücken über den Fluss zeigen nicht nur die Veränderungen, die der Mensch in der Natur bewirkt hat, sondern verleihen dem Gemälde selbst auch Lebendigkeit. Die Brücke auf dem Gemälde dürfte jedoch von der Ponte alla Carraia am Arno in Florenz (Abbildung 12) abgeleitet sein, die mindestens aus dem frühen 13. Jahrhundert stammt. Zu Leonardo da Vincis Zeiten muss sie die schönste Brücke in Florenz gewesen sein. Da die vorherige Brücke 1333 durch eine Überschwemmung zerstört wurde, müsste die Brücke, die Leonardo da Vinci sah, vom Meisterkünstler Giotto entworfen worden sein. und das Gebäude, das wir heute sehen, wurde 1948 auf der ursprünglichen Basis wiederaufgebaut, nachdem es im Zweiten Weltkrieg von der deutschen Armee bombardiert worden war. Abbildung 12. Karaia-Brücke in der Abenddämmerung im Sommer | Bildquelle: Wikipedia Wenn wir uns die Szenerie hinter der Figur genau ansehen, werden wir feststellen, dass die horizontale Linie auf der linken Seite ihres Gesichts etwas niedriger liegt als der Horizont auf der rechten Seite ihres Gesichts, während die Schultern der Frau auf dem Gemälde gerade bleiben. Leonardo da Vinci bediente sich hier einer optischen Täuschung, denn wenn wir das Gemälde betrachten, haben wir den Eindruck, dass die Mona Lisa auf der linken Seite des Gemäldes etwas größer ist als auf der rechten Seite, und unser Gehirn versucht, dies durch eine visuelle Anpassung zu korrigieren. Wenn Menschen also verschiedene Teile des Gemäldes betrachten, erwecken die stationären Figuren im Gemälde den Eindruck ständiger Bewegung und Veränderung. Abbildung 13. Schematische Darstellung des Landschaftshorizonts auf beiden Seiten hinter der Mona Lisa. 6 Einfluss der neuplatonischen Philosophie Vor dem Erscheinen der Mona Lisa war der Gesichtsausdruck der Figuren auf fast allen Porträts recht ernst (wie etwa in den Abbildungen 7 und 8). Da es sich um ein Porträt handelte, mussten Maler damals ihre Werke meist anhand realer Personen anfertigen. Da es für Menschen schwierig ist, ständig zu lächeln, ist es für Maler schwierig, lächelnde Menschen in Porträts zu malen. Doch die folgende Passage in Vasaris „Biographie“ verrät uns, welche Techniken Leonardo da Vinci beim Malen der „Mona Lisa“ anwandte. Leonardo fügte der ohnehin schon schönen Mona Lisa folgende Techniken hinzu: Er bat Musiker, für sie zu spielen oder zu singen, und Clowns, aufzutreten, um sie in einem Zustand der Freude zu halten und ihre innere Traurigkeit zu vertreiben, die beim Malen des Porträts oft unbeabsichtigt Einzug hielt. In Leonardos Porträt scheint das angenehme Lächeln eher göttlich als menschlich, doch es ist eine solch magische Schöpfung, die das Lächeln aus der Quelle des Lebens so zeigt, wie es ist. (Hinweis: Meine eigene Übersetzung) Leonardo, der in Florenz unter der Herrschaft Lorenzos des Prächtigen aufwuchs, war eindeutig von der neuplatonischen Philosophie beeinflusst, ging jedoch noch einen Schritt weiter. In „De Inventione“ erzählt Cicero die Geschichte der Erschaffung der Helena von Troja durch den antiken Maler Zeuxis (der im 5. Jahrhundert v. Chr. lebte). Als Zeuxis malte, bat er die Leute von Crotone, ihm viele schöne Mädchen als Modelle zur Verfügung zu stellen, weil er glaubte, dass die Natur selbst nicht jeden Teil ihres Körpers absolut perfekt wachsen lassen könne, egal wie schön der Körper einer Frau sei. Als Maler war es ihm unmöglich, alle Elemente zu entdecken, die für die ultimative Schönheit einer einzigen schönen Frau notwendig sind. Leonardo da Vinci wandte dasselbe Konzept an, als er die Mona Lisa schuf. Da es sich jedoch um ein Porträt handelte, sollte der Künstler keine schönen Elemente aus den Gesichtern anderer Modelle zeichnen und in das Gemälde integrieren. Daher entschied sich Leonardo da Vinci dafür, eine möglichst ideale Umgebung für das Modell zu schaffen, in der er die Möglichkeit hatte, die schönsten und attraktivsten Teile des Motivs in verschiedenen Momenten einzufangen und sie schließlich in das Gemälde zu integrieren. Die Mona Lisa war unvollendet, als Leonardo 1506 Florenz verließ und nach Mailand ging. Vielleicht aus diesem Grund nahm Francesco del Giocondo das Porträt nicht an. Leonardo da Vinci trug es immer bei sich, veränderte es von Zeit zu Zeit und malte weiter daran, bis er es nach seiner Ankunft in Frankreich im Jahr 1517 endgültig vollendete. Noch wichtiger ist jedoch, dass der Maler nach seiner Abreise aus Florenz nicht mehr Lisa del Giocondo darstellen sollte, sondern eine in seinen Gedanken vollkommenere Darstellung der Menschheit. Daher ist es ganz natürlich, das Verständnis und die Gefühle der menschlichen Natur dieses Malers einzubeziehen, der viele Wechselfälle des Lebens erlebt und die Höhen und Tiefen des Lebens gekostet hat, was diesem Gemälde zweifellos eine tiefere Wirkung verleihen wird. Gerade aufgrund des starken Einflusses des Neuplatonismus und des Bemühens, das schönste Bild der Mona Lisa in dem Gemälde zu zeigen, ist dieses Werk zu einer perfekten Kombination aus der Darstellung der feierlichen und heiligen Schönheit menschlicher Frauen und dem Bild realer Frauen in der säkularen Gesellschaft von Florenz geworden. 7. Raphaels schnelle Antwort auf die Mona Lisa Als Leonardo da Vinci die Mona Lisa malte, studierte der junge Raffael in Florenz. Dieser überaus kunstsinnige und lernbegabte Maler fertigte umgehend eine Aufzeichnung in Form einer Skizze an (Abbildung 14). Die „Junge Frau mit Einhorn“ und das „Porträt der Magdalena Doni“, die er um 1506 malte, entstanden beide unmittelbar unter dem Einfluss der „Mona Lisa“ (Abbildungen 9 und 15). Abbildung 14. Raphael, Porträt einer Frau, Skizze, 1505–1506, Höhe 22 cm, Breite 15,8 cm, jetzt im Louvre-Museum in Paris gesammelt | Bildquelle: Wikipedia Abbildung 15. Raffael, „Porträt der Maddalena Doni“, Ölgemälde, ca. 1506, 65 cm hoch, 45,8 cm breit, jetzt ausgestellt im Uffizien-Museum in Florenz | Bildquelle: Wikipedia Wenn wir uns Raffaels Skizze (Abbildung 14) genauer ansehen, werden wir feststellen, dass sich auf beiden Seiten der Frau im Gemälde Säulen befinden. Wenn wir uns die Louvre-Version der Mona Lisa genauer ansehen, bemerken wir, dass auf beiden Seiten der Arme der Frau Spuren der Säulenunterseiten vorhanden sind, es gibt jedoch keine Säulen; Während wir bei der Mona Lisa im Prado-Museum die Säulen auf beiden Seiten des Gemäldes deutlich erkennen können (Abbildung 5). Da stellt sich die Frage: Wurde die Louvre-Version der „Mona Lisa“ später geschnitten? Ist das Gemälde, das wir heute sehen, das vollständige Gemälde? 8 Einfache Schlussfolgerung Leonardo da Vincis „Mona Lisa“ ist ein bedeutendes Gemälde in der Geschichte der Renaissancekunst. Es verkörpert nicht nur die Errungenschaften vieler Vorgänger und Kollegen, sondern präsentiert auch viele neue Technologien, die von Leonardo da Vinci erfunden wurden. Der Einfluss dieses Porträts auf die westliche Porträtmalerei hielt lange an, bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Im Laufe der Zeit und in verschiedenen Anzeigen spiegelt sich die Vorliebe der Menschen für das Prinzip „Der Gewinner bekommt alles“ jedoch auch in der Einführung und Zusammenfassung dieses Gemäldes wider. In vielen vereinfachten Einführungen in die Kunst der Renaissance und die Mona Lisa wird die technologischen Erfindungen ihrer Vorgänger Leonardo da Vinci zugeschrieben. Am häufigsten lesen oder hören wir, dass die Augen der Mona Lisa den Leser anblicken, ganz gleich aus welchem Blickwinkel wir das Gemälde betrachten. Das stimmt zwar, wurde aber nicht von Leonardo da Vinci erfunden. Dasselbe Phänomen können wir auf einigen Porträts vor dem Erscheinen der Mona Lisa beobachten. Hier stellen wir zwei Porträts vor, die von Malern aus verschiedenen Regionen Italiens gemalt wurden (Abbildungen 16 und 17). Abbildung 16. Perugino, „Porträt von Francesco delle Opere“, Öl auf Holz, 1494, 52 cm hoch, 44 cm breit, jetzt im Uffizien-Museum ausgestellt | Bildquelle: Wikipedia Abbildung 17. Francesco Francia, „Porträt von Bartolomeo Bianchini“, Öl auf Holz, 1493–1495, Höhe 56,6 cm, Breite 40,6 cm, jetzt ausgestellt in der National Gallery in London | Bildquelle: Wikipedia Pietro Perugino (ca. 1448–1523) aus Umbrien war ein Klassenkamerad von Leonardo da Vinci und ein ihm ebenbürtiger großer Maler, während Francesco Francia (1450–1517) ein Bologneser Maler war. Wenn der Leser die Gelegenheit hat, vor den beiden oben stehenden Porträts zu stehen, die er im späten 15. Jahrhundert gemalt hat, wird er feststellen, dass die Augen der Figuren auf dem Gemälde ihn immer anschauen, ganz gleich, wo er vor dem Gemälde steht. Es ist auch erwähnenswert, dass die Leser den Unterschied zwischen den realistischen Landschaften in diesen beiden Porträts und der traumhaft surrealen Landschaft der Mona Lisa leicht erkennen können. Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass die Mona Lisa Hunderte von Jahren nach ihrer Entstehung in der breiten Öffentlichkeit nicht so berühmt war wie heute. Seit Beginn des 16. Jahrhunderts wird es im Schloss Fontainebleau in Frankreich gesammelt. Abgesehen von einer sehr kleinen Zahl von Königen, Adligen und Eliten haben es nur wenige Menschen gesehen. Erst als die Mona Lisa im frühen 19. Jahrhundert im Louvre ausgestellt wurde, konnten die Menschen sie wirklich wertschätzen und allmählich verstehen. Der wichtigere Grund für seine heutige Berühmtheit liegt in seiner komplexen Beziehung zur internationalen Geopolitik, der italienischen Innenpolitik und den Veränderungen im Kunstgeschmack der Menschen. Über den Autor Zhang Yi ist Kunsthistoriker, Berater der Abteilung für Uhren und antike Musikinstrumente des Eremitage-Museums in Russland, Berater der Galerie für französische Pendeluhren, Berater des Forschungsausschusses der Uhrensammlung Guangdong sowie Mathematiker und Logiker. Produziert von: Science Popularization China Besondere Tipps 1. Gehen Sie zur „Featured Column“ unten im Menü des öffentlichen WeChat-Kontos „Fanpu“, um eine Reihe populärwissenschaftlicher Artikel zu verschiedenen Themen zu lesen. 2. „Fanpu“ hat die Funktion zur Artikelsuche nach Monat eingeführt. Folgen Sie dem offiziellen Account und antworten Sie mit der vierstelligen Jahreszahl + Monat, also etwa „1903“, um den Artikelindex für März 2019 zu erhalten, usw. Copyright-Erklärung: Einzelpersonen können diesen Artikel gerne weiterleiten, es ist jedoch keinem Medium und keiner Organisation gestattet, ihn ohne Genehmigung nachzudrucken oder Auszüge daraus zu verwenden. Für eine Nachdruckgenehmigung wenden Sie sich bitte an den Backstage-Bereich des öffentlichen WeChat-Kontos „Fanpu“. |
Artikel empfehlen
Wie viele Sit-ups können Sie täglich machen, um Gewicht zu verlieren?
Da die Menschen in der modernen Gesellschaft imme...
Unsichtbarer „Fremdkörper“: Was tun, wenn bei der körperlichen Untersuchung Knoten in der Brust entdeckt werden?
„Knoten“, „Polypen“, „Zysten“ … Diese Wörter sche...
Schwachpunkt des Rockchip-IPO: Schwierigkeiten bei der nachhaltigen Rentabilität
Für Rockchip, einen wichtigen inländischen Chiphe...
Was tun, wenn Sie nach dem Training Muskelkater haben?
Viele Freunde, die nicht regelmäßig viel Sport tr...
Genießen Sie KTV auf Ihrem Mobiltelefon. Die neue Version von Tianlai Karaoke eröffnet abwechslungsreiche Handheld-Unterhaltung
Die Leistungsfähigkeit von Smartphones wird immer...
Sie lebte 16 Jahre lang allein, ohne sich zu paaren, und brachte ein Kind zur Welt
Nachdem sie viele Jahre allein gelebt und nie ein...
Was sind die Vorteile von Widerstandsband-Yoga?
Beim Yoga wird Widerstandsband-Yoga verwendet. Es...
Kann ich während meiner Menstruation Yoga praktizieren?
Ich glaube, dass die meisten Freundinnen während ...
Das größte Highlight des Fujian-Schiffs, einer wichtigen Nationalwaffe, ist das elektromagnetische Katapult. Warum ist diese Technologie weltweit führend?
Am Morgen des 17. Juni fand eine Stapellaufzeremo...
Kann Laufen Akne verursachen?
Jeder weiß, wie wichtig Bewegung ist. Verschieden...
Die Verkäufe des Corolla Hybrid haben fast 40.000 Einheiten erreicht. Warum ist der Hybridantrieb von Toyota wie das iPhone in der Automobilindustrie?
Freunde, die sich mit Autos auskennen, sind sich ...
Welche Veränderungen treten 72 Stunden nach dem Tod im Körper auf? (Keine Angst, lesen Sie es bitte mit Zuversicht)
Dieser Artikel wurde von Zhang Yinming, PhD in Fo...
Welche Übungen eignen sich für Hämorrhoiden-Patienten?
Hämorrhoiden sind für viele Menschen ein Albtraum...
Helfen! Ameisen können dank einer Tasse Milchtee in Computern leben
Welche Orte fallen Ihnen ein, wenn Sie an Ameisen...
Hat eine Bleivergiftung den Untergang des mächtigen Römischen Reiches beschleunigt? Die Wahrheit ist...
Das Römische Reich war einst eines der mächtigste...

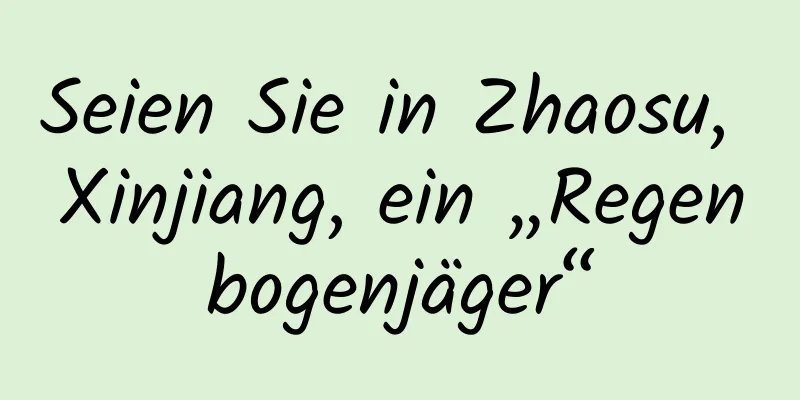

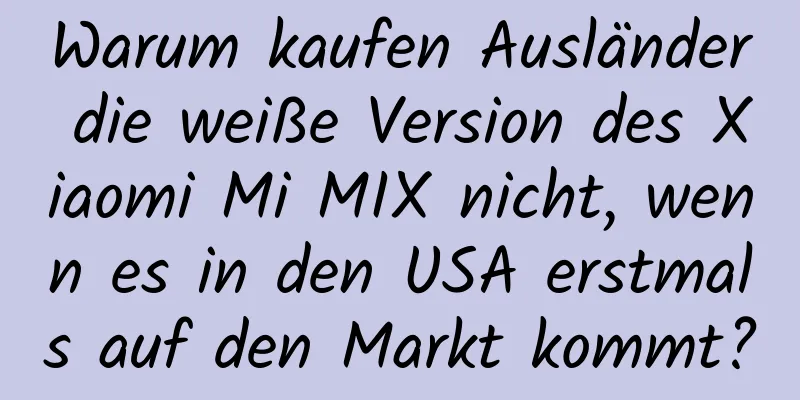
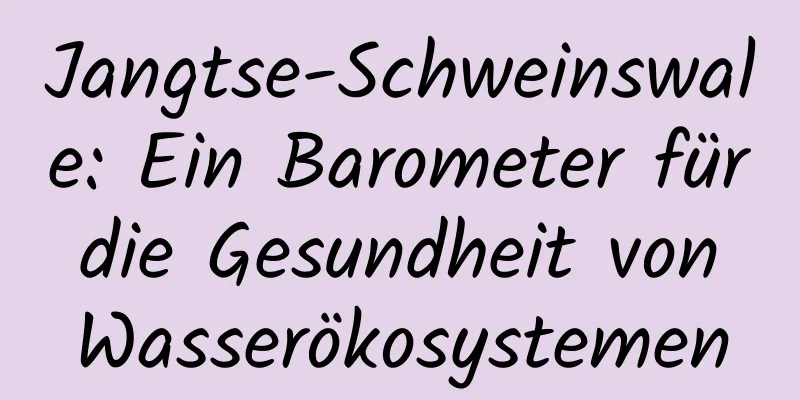

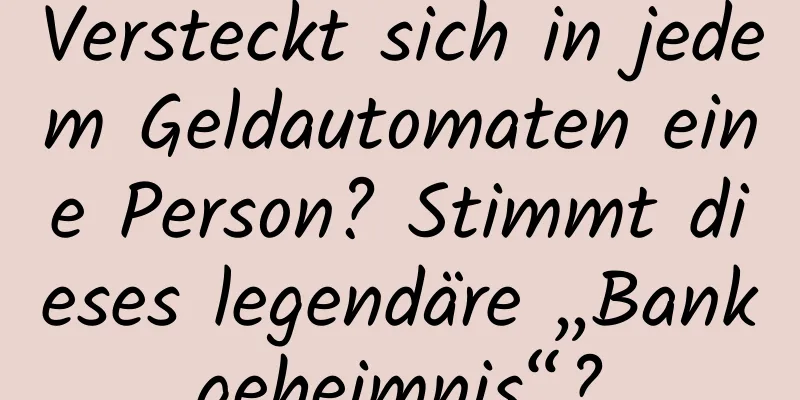
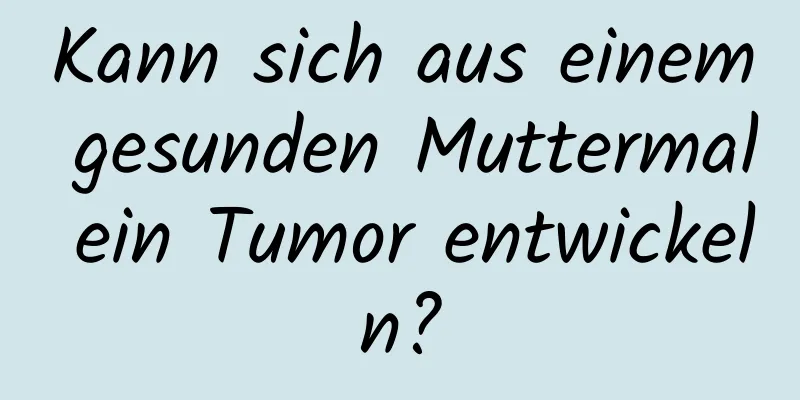
![[Programm zur kreativen Kultivierung] Die Leute sagen, Horoskope seien Aberglaube. Warum glauben Sie trotzdem, dass sie so genau sind?](/upload/images/67f2625faf3f5.webp)