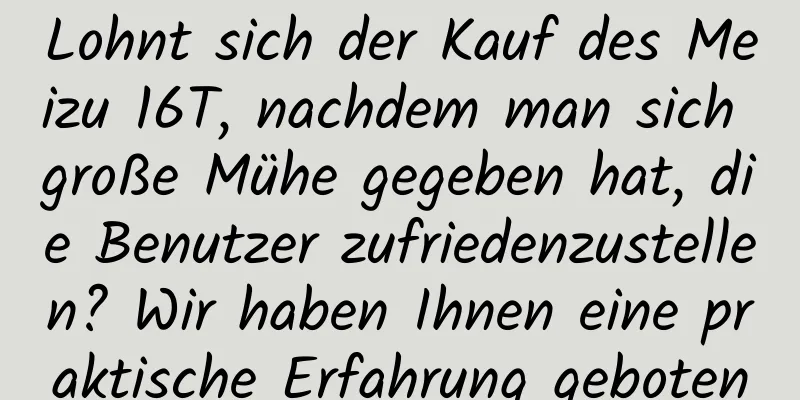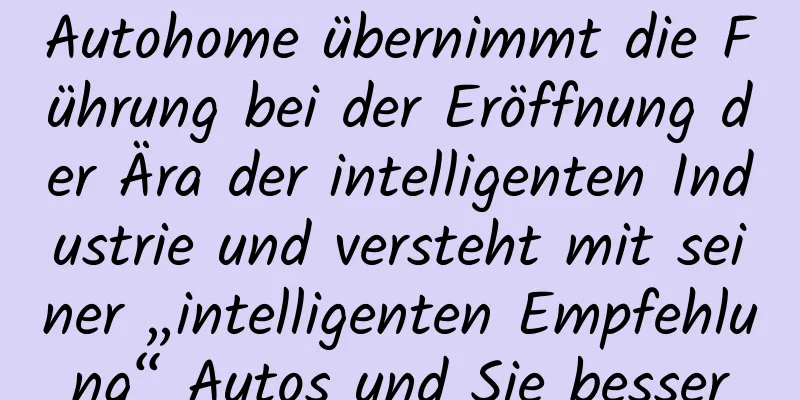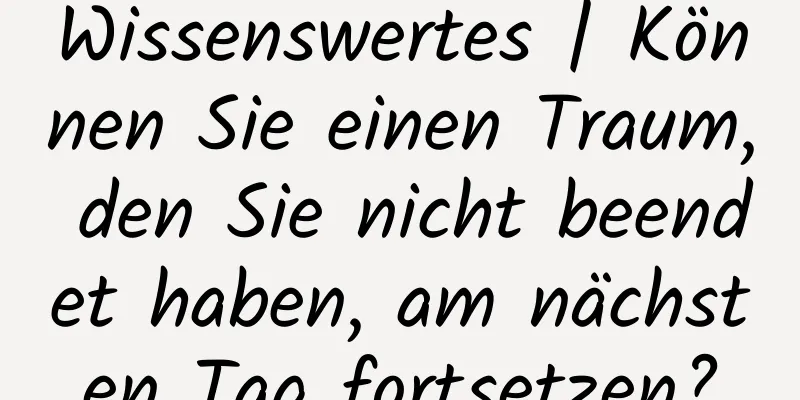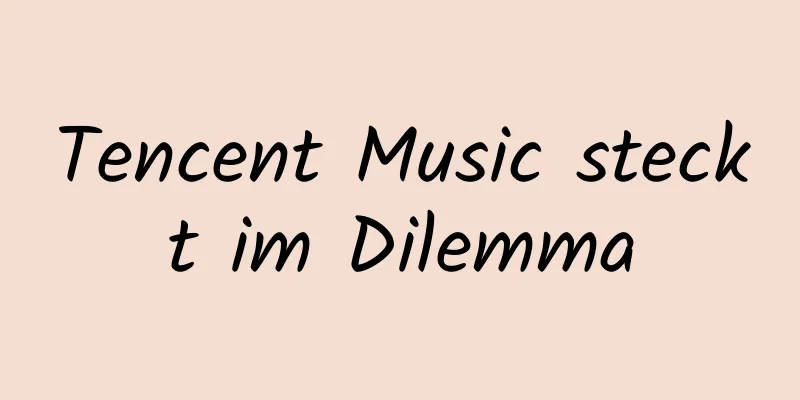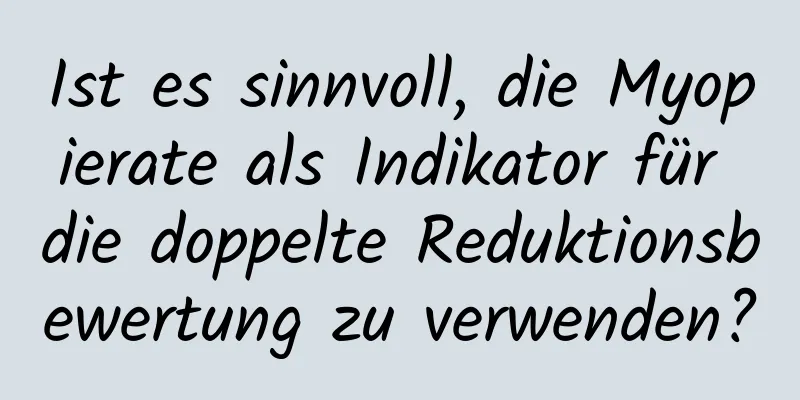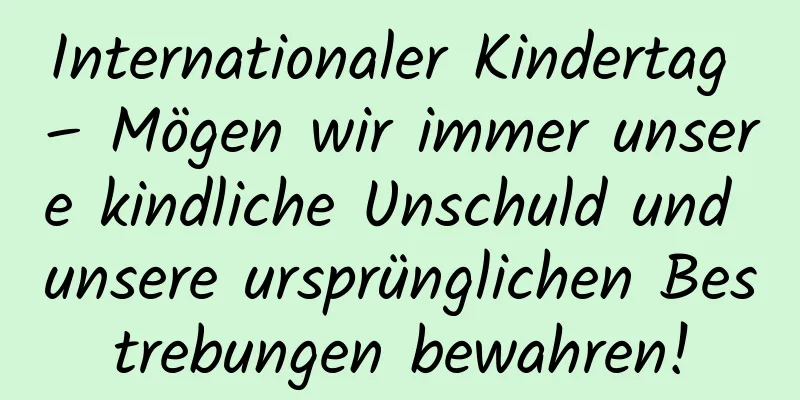Die bezaubernde Geschichte des „Zauberweins“: die furchterregende Flüssigkeit, die einst England berauschte
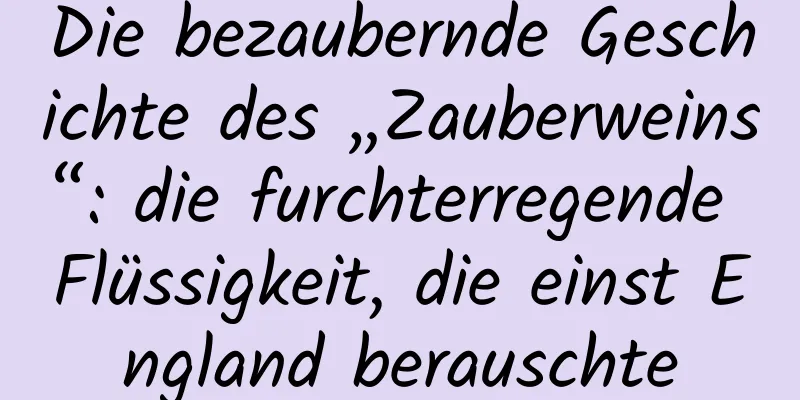
|
William Hogarth, Gin Lane, 1751. © www.metmuseum.org Leviathan Press: Die Einführung von Gin in England war eine berauschende und schädliche Angelegenheit. Trinker berichteten von einer Reihe von Reaktionen: Geistesverlust, Wahnsinn, Euphorie und sogar Tod. Mithilfe von Drucken von George Cruikshank, William Hogarth und anderen begibt sich James Brown in diese süchtig machenden Treffpunkte – Pubs, Gin-Bars, Friseurläden – , die, je nachdem, wen man fragt, entweder Vergnügen oder Laster bieten. Im Jahr 1751 schuf der Grafiker und Satiriker William Hogarth „Gin Lane“, seine berühmte visuelle Darstellung der verheerenden Wirkung, die Gin, eine neue Spirituose, auf das Leben der Armen Londons hatte. Dieses Werk ergänzt Beer Street, ein erschütterndes Panorama von Armut, Sucht, Wahnsinn, Gewalt, Kindstötung und Selbstmord; Inmitten von Chaos und Verzweiflung gibt es nur Wohlstand bei Gripe, einem Pfandleiher, der Beerdigungen durchführt , und zwei Unternehmen, die „tödliche Getränke“ anbieten: eine Gin-Taverne und Kilman, ein Destillateur. „Beer Street“ (links) und „Gin Lane“ (rechts). © www.metmuseum.org Laut Hogarths Biograf „ prägt sich die zerrüttete, zerfallende Szene der Gin Lane ... tief ins Gedächtnis ein .“ Abwandlungen dieser Zeichnungen erfreuen sich bei politischen Karikaturisten so großer Beliebtheit, dass sie häufig und wirkungsvoll bei wissenschaftlichen Konferenzen zur Geschichte des Alkohols auftauchen und die „Gin Alley-Sirenen“ mittlerweile in den sozialen Medien zu hören sind. Doch so faszinierend dieses Bild auch ist, seine Dominanz in der Geschichte des Alkohols und der Kunst verdeckt eine größere Bandbreite subtiler und unverwechselbarer Berichte über Gin und die Kontexte, in denen er im 18. und 19. Jahrhundert konsumiert wurde. Verfluchter Wein Gin war neben Schokolade, Kaffee, Opium, Zucker, Tee und Tabak eines von zahlreichen neuen Rauschmitteln für den Menschen und erweiterte in der Zeit der psychoaktiven Revolution (1600–1800) die Möglichkeiten der Europäer, ihr Bewusstsein zu verändern, erheblich. Seit dem Spätmittelalter wurden in England in Klöstern, Privathäusern und Apotheken Spirituosen (vor allem das Rohdestillat aus Wein, „Aqua Vitae“) hergestellt. Sie waren allerdings teuer, wurden in der Regel für medizinische Zwecke verwendet und nur in begrenzten Mengen hergestellt. Der explosionsartige Anstieg von Brandy, Rum, Whisky und insbesondere Gin im späten 17. Jahrhundert war auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen – ein Überangebot an Getreide, Beschränkungen bei der Einfuhr von französischem Wein, die Lockerung des Brennereimonopols und höhere Steuern auf Ale und Lager –, doch der Aufstieg des Gins verlief besonders rasant. Ursprünglich wurde Gin als „Genever“ (aus Wacholderbeeren, der wichtigsten Geschmackszutat in Gin) aus den Niederlanden importiert. In den 1690er Jahren begann man mit der Massenproduktion von Gin durch heimische Malzbrennereien, die das Produkt im Großhandel an eine Reihe kleiner Mischbetriebe verkauften. Diese Hersteller „korrigieren“ es mit einer Vielzahl pflanzlicher Zusatzstoffe, darunter Wacholderbeeren, Koriandersamen, Orangenschalen, Lakritzpulver und Kolophonium. Laut George Smith, einem Destillateur aus Cumbria, hatte Gin im Jahr 1725 „eine solche allgemeine Anerkennung erlangt, insbesondere unter der einfachen Bevölkerung …, dass in vielen Brennereien täglich mehr davon verkauft wird als in den meisten öffentlichen Bars sowohl Lager als auch Ale“. Das daraus entstandene Getränk war viel stärker als die traditionellen alkoholischen Getränke (Ale, Lager, Apfelwein und Wein), die zuvor sowohl bei der Freizeitgestaltung als auch beim Essen dominiert hatten, und stellte eine große Veränderung in der englischen Trinkkultur dar; Jessica Warner nannte es sogar „die erste moderne Medizin“ . Kurz gesagt, Gin hatte für die Trinker der frühen Neuzeit eine ganz andere Bedeutung: Er bot keinen allmählichen Rausch, sondern einen sofortigen, extremen Rausch . Diese hohe Intensität hatte auch eine Reihe ungewöhnlicher und schrecklicher Nebenwirkungen zur Folge, die von Kommentatoren des 18. Jahrhunderts ausführlich diskutiert wurden, darunter moralischer Verfall, Kriminalität, Wahnsinn, zwanghafte Vergiftung und Tod. Ein anonymer Autor bemerkte im Jahr 1736: „Eine Person, die eine kleine Menge Gin zu sich nimmt, wird fast augenblicklich betrunken, so dass sie jegliche Vernunft und Kontrolle über ihre Handlungen verliert.“ In ähnlicher Weise warnte Eliza Haywood in ihrer Abhandlung von 1750, die sich an Gin-Trinkerinnen richtete, dass traditionelle Getränke ihre Konsumenten zwar „mürrisch, schläfrig oder überaus heiter“ machten, Gin sie jedoch „kühn, stur und erfüllt von einem wilden Verlangen, Böses zu tun … der reine Konsum von hochprozentigen Getränken, so könnte man sagen, ist der schnellste Weg, die Menschheit ihrer Vernunft zu berauben und sie durch einen Wahnsinn zu ersetzen, der zunächst vorübergehend, letztlich aber dauerhaft ist“. Im folgenden Jahr stimmte ein anderer anonymer Autor dem zu: „[Gins] schädlicher Einfluss dringt tief in ihre Seelen ein; jedes hohe moralische Prinzip wird entwurzelt und zerstört.“ Darüber hinaus gilt: „Wenn sie sich erst einmal an das Trinken gewöhnt haben, sind sie erst zufrieden, wenn sie das Glas von der Nase genommen haben.“ Dies macht die einzigartigen physiologischen und psychologischen Wirkungen des Gins zu einer immer wiederkehrenden zeitgenössischen Metapher: der des Verzaubertseins, der Unterwerfung des normalen menschlichen Willens und der Talente unter eine verborgene übernatürliche Kraft. Der Totentanz: Die Schankstube, Aquarell von Thomas Rowlandson, 1816. © Wellcome Collection Brutstätte des Unheils: Der Gin Pub Wie andere neue Rauschmittel hat Gin eine völlig neue Art von urbanem Raum geschaffen, der sich ausschließlich um seinen Verkauf und Konsum dreht. So wie aus Kakao Schokoladenhäuser, aus Kaffee Kaffeehäuser, aus Opium Opiumhöhlen und aus Tee Teestuben und Teegärten entstanden, so entstanden aus Gin Pubs, die von den Menschen damals als „Ort der Elenden“, „Brutstätte des Unheils“ oder „Wiege allen Übels und aller Sünde“ beschrieben wurden. Die Entstehung solcher Orte begann vor allem in Städten und Gemeinden, ab Beginn des 18. Jahrhunderts breiteten sie sich jedoch rasch aus. Im Jahr 1726 schätzte ein Richterausschuss in Middlesex, dass es allein in diesem Londoner Vorort 6.000 Gin-Häuser gab, wobei in einigen Gemeinden sogar jedes fünfte Gin-Haus zu finden war . Wie die Radierung unten zeigt, war die Gin Tavern weitaus bescheidener als die traditionellen Gasthäuser, Pubs und Ale Houses, die zuvor das englische Restaurantsystem ausgemacht hatten, das unter den hannoverschen Vorschriften immer ausgefeilter und standardisierter geworden war. Um mit dem Verkauf von Alkohol zu beginnen, müssen Sie lediglich einen Vorrat an „schädlichen Getränken“ finden (entweder vor Ort destilliert oder von einem professionellen Hersteller gekauft). Anonymer Stich, The Gin Tavern, 1765. © Wellcome Collection Die Tische und Stühle in den Läden sind bewusst spärlich angeordnet, um den Außer-Haus-Verkauf und das Trinken im Stehen zu fördern. Beides sorgt für einen schnellen Zustrom vor allem armer Kunden, die nicht das Geld für ausgedehnte Trinkgelage vor Ort haben . Eine der räumlichen Innovationen der Gin-Bars ist die Bar, die dem boomenden Einzelhandel entlehnt ist. Entgegen der landläufigen Meinung waren diese Bars ein Merkmal etablierter Trinklokale, in denen den Gästen in der Lobby und den Privaträumen Getränke von einem Team aus Eigentümern, Kellnern, Bedienungen und Barkeepern aus Weinkellern im Keller serviert wurden. Wie der Architekturhistoriker Mark Girouard anmerkt, war die Bar ein revolutionärer „Durchbruch in Zeit und Bewegung“, der den Service bequemer und effizienter machte; Darüber hinaus brachte es weitere Vorteile mit sich, beispielsweise die Trennung zwischen Kellnern und Gästen, die Bereitstellung einer Fläche zum Abmessen und Einschenken von Getränken und die Bildung einer Barriere zur sicheren Aufbewahrung von Getränken, Servierutensilien und Einnahmen. Flüssigkeitsbahnen Gin wird nicht nur an diesen speziellen Orten verkauft und genossen, sondern ist auch eine nahezu allgegenwärtige Substanz, die in vielen etablierten Lokalen und Räumen zu finden ist. Wie die Radierung oben, die eine Kellnerin zeigt, die ein Trinkgeld für das Getränk gibt, zeigt, war die zunehmende Popularität des Gins nicht aufzuhalten. Dieses „Mad Pour“ wurde insbesondere in ländlichen Gebieten in das Geschäft traditioneller Gasthaus-, Pub- und Bierhausbesitzer integriert und auch in Cafés, Lebensmittelgeschäften, Feinkostläden, Pfandhäusern und Tabakläden weithin verkauft – denn Einzelhändler, die mit alkoholfreien Waren handelten, konnten Gin ebenfalls ohne Lizenz oder Regulierung verkaufen. Da der Außer-Haus-Verkauf einen erheblichen Teil des Geschäfts der Taverne ausmachte, wurde Gin häufig zu Hause und in Privatwohnungen konsumiert und konnte sogar beim Haareschneiden oder Rasieren genossen werden – wie im Fall der Sexarbeiterinnen und Matrosen auf dem Stich unten. Die Gravur von Gin, der in einem Friseursalon serviert wird (unten), stellt einen visuellen Kontrapunkt zum verstorbenen Friseur in Hogarths Gin Lane dar, der von seinen schmutzigen, ginvernebelten Kunden in den Bankrott getrieben wird. Handkolorierter Kupferstich aus dem Jahr 1793 mit folgendem Text: „Eine Rasur für einen Penny, ein Haarschnitt für weniger als zwei Pence und ein Glas Gin zum Schnäppchenpreis.“ © wikimedia Handkolorierter Kupferstich, circa 1792. Eine Sexarbeiterin ist in ihrem Zimmer abgebildet, neben einem Waschzuber ist ein Gin-Krug zu sehen. © wikimedia George Cruikshank, Mrs. Toppers Traum, ca. 1812. Auf dieser handkolorierten Lithografie sind ein Seemann und seine Frau im Bett abgebildet, auf dem Tisch ist eine kleine Flasche Gin zu sehen. © wikimedia Ähnlich wie Tee und Saloop (ein Heißgetränk aus gemahlenen Orchideenwurzeln, das ursprünglich aus dem Osmanischen Reich stammt) wird auch Gin, die „brennende Substanz aus der Hölle“, in der Outdoor-Trinker-Szene Einzug halten. Tatsächlich zeigt Gin Alley eine alptraumhafte Art des Open-Air-Trinkens. Gin wird nicht nur in Fachgeschäften verkauft, sondern auch in Schuppen und an Ständen in Gassen, und man kann ihn auf der Straße trinken. Und – wie andere Nahrungsmittel dieser Zeit – wurde es von fahrenden Händlern auf der Straße verkauft, insbesondere bei großen Festivitäten wie Hinrichtungen. William Hogarth, Der müßige Lehrling, hingerichtet in Tyburn, 1747. Auf der rechten Seite des Drucks verkauft ein Straßenhändler Gläser mit Gin aus einem Karren. © wikimedia Die berühmteste Darstellung dieser Szene ist Hogarths „The Idle Prentice Executed at Tyburn“, in dem ein Straßenhändler am Ort einer öffentlichen Hinrichtung von einem Pferdewagen aus Gin verkauft. Es gibt auch weniger bekannte Szenen, wie etwa James Gillrays Kupferstich „Copenhagen House“ aus dem Jahr 1795, der einen Hausierer zeigt, der bei einer geschäftigen und ausgelassenen Versammlung der London Corresponding Society Gin verkauft. James Gillray, Copenhagen House, 1795. Im mittleren linken Vordergrund dieser handkolorierten Lithografie verkauft eine Weinhändlerin mit Kopftuch Gin bei einem Treffen der London Correspondence Society. Die Gesellschaft war ein von der Französischen Revolution inspirierter Debattierclub, der sich für demokratische Parlamentsreformen einsetzte. Ganz links fügen drei Schornsteinfeger, deren Messingkappen die Namen ihrer Herren tragen, ihre eigenen Namen der Liste berühmter politischer Rebellen hinzu. Auf ihren charakteristischen Gin-Fässern steht: „Thelwall & Co.’s True Democratic Gin“, eine Anspielung auf John Thelwall, den radikalen Journalisten und politischen Reformer, der die Gesellschaft mitbegründet hat. Der Zusammenhang mit Gin könnte darin liegen, dass er aufgrund seines niedrigen Preises für die Armen leicht erhältlich war und ihn somit zu einer demokratischen und zugänglichen Form der Berauschung machte. © wikimedia Wie Kaffee wird Gin an temporären oder „Pop-up“-Ständen in Parks und auf Jahrmärkten verkauft. Immer wenn die Themse zufriert, finden regelmäßig Frostmärkte statt. Während des Frosts von 1814 gab es Zelte mit dem Namen „Orange Boven“ und „City of Moscow“. In letzterem war eine lebensechte Statue des Herzogs von Wellington ausgestellt und es wurde Gin verkauft. Frost Fair an der Themse, handkolorierter Holzschnitt von 1814. In der Bildmitte dienen zwei provisorische Zelte als Verkaufsfläche für Gin. © britishmuseum.org Zwischen 1729 und 1751 führte eine Reihe von Gesetzen der Zentralregierung im späten 18. Jahrhundert zu einem allmählichen Rückgang des Gin-Konsums und der damit verbundenen Lokale und Räume , obwohl Steuersenkungen im frühen 19. Jahrhundert eine Wiederbelebung des Konsums und die Schaffung eines weiteren innovativen Lokals auslösten: des Gin Palace. Gin-Paläste erlebten ab den 1820er Jahren (als der Begriff geprägt wurde) ein Jahrzehnt der Blütezeit, und diese luxuriösen Veranstaltungsorte zeichneten sich durch eine Reihe neuartiger architektonischer Merkmale aus, die aus dem Einzelhandel übernommen wurden: die allgegenwärtige Bar, aber jetzt auch große Bereiche mit Glasvorhangfassaden, verziert mit Säulen und Kapitellen, Rokoko-Details, Gasbeleuchtung innen und außen, große Fässer gefüllt mit verschiedenen Gin-Sorten und umfangreiche Inschriften. Letzteres unterstreicht die lange Verbindung von berauschenden Orten mit Texten (Bars und Cafés waren wichtige Orte für die Verbreitung und den Konsum von Büchern, Zeitungen und anderen Druckerzeugnissen), und wie wir weiter unten sehen werden, diente die weit verbreitete Verwendung von Etiketten und Legenden im Gin Palace den Cartoonisten als Inspiration. Charles Dickens beschrieb 1836 einen typischen Gin-Palast: Alles ist herrlich und großartig. Dort drüben ertönte ein melodisches Dröhnen aus einer luxuriösen Bar, die die Mitte der beiden gegenüberliegenden Straßen markierte. Das heitere Gebäude mit seiner reich verzierten Brüstung, seiner leuchtenden Uhr, seinen mit Stuckornamenten umgebenen Spiegelglasfenstern und seinen reich mit Edelmetallen vergoldeten Gaslampen bildete einen schillernden Kontrast zu der Dunkelheit und dem Elend, das wir gerade verlassen hatten. Das Innere ist noch prächtiger als das Äußere. Eine Bar aus Mahagoni mit französischen Schnitzereien erstreckte sich über die gesamte Länge des Raumes. auf beiden Seiten standen Reihen riesiger Fässer, grün und gold bemalt und von leichten Messinggeländern eingerahmt, mit Inschriften wie „Old Tom, 549“; "Der junge Tom, 360"; und „Samson, 1421“, was vermutlich „Gallonen“ bedeutete. Hinter der Bar befand sich eine hohe und geräumige Halle, die mit ebenso faszinierenden Gefäßen gefüllt und von einem ebenso üppig dekorierten Korridor umgeben war. [16] In diesen vornehmen Etablissements und zur gleichen Zeit, als der Gin wieder florierte, begann eine organisierte Abstinenzbewegung Gestalt anzunehmen. Angeführt von Kaffeehändlern, Ärzten, Evangelisten und Industriellen sowie Menschen, die fest an die schädlichen wirtschaftlichen, medizinischen, moralischen und sozialen Auswirkungen alkoholischer Getränke glaubten, setzte sich die Temperance Society aktiv gegen den Freizeitalkoholkonsum und letztlich für völlige Abstinenz ein. Diese reformierte Vorstellungskraft war grundsätzlich räumlich; Wie Brian Harrison betont, waren die neuen Gin-Paläste sowohl Symptom als auch Synonym für die verderblichen Übel des Alkohols, wenn sich ihre „Vorstellung von Unterhaltung auf das Zuhause konzentrierte“. Die Abstinenzreformer mobilisierten ihre Anliegen nicht nur durch Flugblätter, Landkarten und Lieder, sondern auch durch Bilder. Luke Limners Stich aus dem Jahr 1847 vergleicht eine traditionelle Taverne mit einem modernen Gin-Palast. © Wellcome Collection George Cruikshanks Trinker An vorderster Front im Kampf gegen die Prohibition stand der Cartoonist George Cruikshank. Er wurde in London geboren und wuchs dort auf. Wie seine Zeitgenossen James Gillray und Thomas Rowlandson war er ein Erbe der visuellen Tradition Hogarths. Cruickshank war ein produktiver und erfolgreicher kommerzieller Cartoonist, der im Laufe seiner langen Karriere über 6.000 Zeichnungen für Bücher, Zeitschriften und Broschüren anfertigte. Gin und seine Paläste spielen eine wichtige Rolle im pulsierenden Leben und den eindringlichen Szenen Londons, die er meisterhaft darstellt. Frühe Entwürfe, wie seine Illustrationen für Dickens’ Sketches by Boz und Pierce Egans Roman Life in London (ein Bestseller im Jahr 1821), sind im Allgemeinen freundlich und liebevoll; Die Lokale sind ansprechend und die Gäste sind überwiegend glücklich, gesund und respektabel. Dies könnte die zentrale und aktive Rolle widerspiegeln, die Gin und der Gin Palace in Cruickshanks Leben während dieser Zeit spielten. Obwohl er offenbar weder alkoholabhängig noch krankhaft trinkerisch war, war er wie die meisten Künstler des 19. Jahrhunderts ein Gewohnheitstrinker und bekannt für seine Liebe zur Geselligkeit. Cruikshanks Illustration für Piers Egans „London Life“, ca. 1820, zeigt Tom und Jerry in ihrem Gin-Palast. © Wellcome Collection Links: Cruikshanks Illustration zu Dickens' „The Notes of Boz“, ca. 1836, zeigt das Innere des Gin Palace. Rechts: Cruikshank, The Gin Palace, ca. 1842. © archive.org Im Jahr 1847, im Alter von 55 Jahren, erlebte Cruikshank eine dramatische Veränderung und befürwortete begeistert die Prohibition. Seine Entscheidung war möglicherweise eine Reaktion auf die Folgen seiner damaligen Krankheit oder wurde durch das Schicksal seines Vaters, des Illustrators Isaac Cruikshank, inspiriert. Isaac Cruikshank soll ein Vollalkoholiker gewesen sein, der im Alter von 46 Jahren an einer Alkoholvergiftung starb, nachdem er einen Trinkwettbewerb gewonnen hatte. Was auch immer seine Motivation war, von dem Moment an, als er sich der Abstinenzbewegung anschloss, entwickelte Cruickshank das, was Richard Vogler als „evangelikale Sorge um die Übel des Alkohols“ bezeichnete. Er unterstützte und illustrierte die National Temperance Association und wurde besonders kritisch gegenüber Gin und Gin-Palästen, die er in seinen späteren Werken neu interpretieren sollte. In seiner berühmtesten Serie, „Die Flasche“ (1847), schildern acht Stiche den Zerfall einer Familie, während die Eröffnungsszene seines eindrucksvolleren Nachfolgewerks „Die Kinder des Trunkenbolds“ (1848) in einem Gin-Palast spielt. Die erwachsene Tochter des Trinkers wird in den Mittelpunkt „jenes Brunnens, der alle Arten von Verbrechen speist“ gestellt; Sie wird von einer in einen Schal gehüllten Puffmutter angesprochen, die von einem Mob umgeben ist, zu dem auch trinkende Kinder und ein betrunkener behinderter Mann gehören. Sie alle werden von riesigen Fässern in den Schatten gestellt, auf denen die ironischen Worte „Cream of the Valley“ und „Famous Double Gin“ prangen. Andere Darstellungen aus dieser Zeit zeigen hoffnungslose Betrunkene, die vor der Tür eines Gin-Palastes stolpern und zusammenbrechen. Im dritten Teil von Cruikshanks „The Bottles“ aus dem Jahr 1847 betäubt sich die dem Untergang geweihte Familie mit Gin, während Gerichtsvollzieher ihre Möbel wegschaffen. In den nächsten fünf Gemälden verschlechtert sich die Situation. © www.bl.uk Cruikshanks auffälligste Negativdarstellung des Gin Palace mit dem Titel „The Gin Shop“ stammt aus dem Jahr 1829, fast zwei Jahrzehnte bevor er mit dem Trinken aufhörte. In diesem Werk stellt er sich den Gin-Palast als einen furchterregenden und gefährlichen Ort des Todes vor, der seine späteren Ängste vorwegnimmt, obwohl der Ausdrucksstil eher komisch als realistisch ist. Im Eröffnungskapitel von Cruikshanks „The Drunkard’s Children“ aus dem Jahr 1848 werden die unglückseligen Nachkommen des Gin Palace dargestellt. © Wellcome Collection Dieser Druck zeigt eine weitere dem Untergang geweihte Familie: Das Gin-Fass ist als Sarg gestaltet und wird von einem als Barkeeper verkleideten Skelett bedient. Ein weiteres Skelett hält eine Sanduhr und einen Speer in der Hand und bedroht die Familie. George Cruikshank, Die Goldene Taverne, 1829. © www.bl.uk Wie beim Gin Palace selbst verwendet Cruikbank häufig Titel, Dialogfelder und andere Textformen, um seine Argumente hervorzuheben. Die Gins heißen „Demon Slayer“, „Blue Ruin“ und „Death in Kindness“, Schilder weisen auf „The Workhouse“, „The Lunatic Asylum“, „The Prison“ und „The Gallows“ hin und deuten diese an, während ein Totenkopf grimmig andeutet: „Sie haben fast ihren letzten Drink getrunken.“ In einem Wortspiel, das die schädlichen Auswirkungen von Gin mit dem unheimlichen Übernatürlichen verbindet, tanzt ein kleiner Dämon um einen Kessel und singt einen Zauberspruch in den „Geistergewölben“. Von James Brown Übersetzt von Tim Korrekturlesen/tamiya2 Originaltext/publicdomainreview.org/essay/liquid-bewitchment/#p-1-0 Dieser Artikel basiert auf der Creative Commons License (BY-NC) und wird von Tim auf Leviathan veröffentlicht Der Artikel spiegelt nur die Ansichten des Autors wider und stellt nicht unbedingt die Position von Leviathan dar |
Artikel empfehlen
China Automobile Dealers Association: „China Automobile Retention Value Report für Januar 2025“ Wenjie M9 belegt den ersten Platz im Retentionswert der reinen Elektrofahrzeuge Chinas
Im „China Automobile Resale Value Report im Janua...
Was tun nach dem Training?
Obwohl wir oft Sport treiben und alle wissen, wel...
Welche Vorteile haben Oberschenkelübungen?
Im Fitnessstudio trainieren die meisten Menschen ...
Welche Art von Übung eignet sich zum Aufstehen am Morgen
Jeder sagt, dass die Planung eines Tages am Morge...
Fat Burning Yoga Aktion Einführung
Yoga ist heutzutage eine beliebte Trainingsmethod...
Können mit Kot Krankheiten behandelt werden? Die Darmflora hat eine wundersame Wirkung
Autor: You Wenjuan, Redaktionsleiter von World Sc...
Toyota Supra-Spionagefotos: Details ähneln denen des Konzeptautos FT-1
Vor Kurzem veröffentlichten ausländische Medien d...
Wie lange nach dem Laufen kann ich duschen?
Viele Menschen duschen gerne direkt nach dem Trai...
Warum ist der Bauchnabel von Mädchen vertikal und der von Jungen horizontal?
Eine Minute beim Arzt, die Haltungen verbessern s...
China Passenger Car Association: Schnellbericht zum Großhandelsverkaufsranking der Hersteller von Pickup-Trucks im Juli 2023
Laut Daten des gemeinsamen Informationsausschusse...
Ärzte warnen: Diese Nagelveränderung könnte Krebs sein! Nehmen Sie es nicht auf die leichte Schulter
Haben Sie beim Nägelschneiden schon einmal die su...
Der Hochleistungs-Elektro-SUV der Audi e-tron S-Serie wird erneut aktualisiert, „Spezialfans“ schweigen und „Elektro-Hasser“ sind in Tränen aufgelöst
Obwohl Tesla das einzige Unternehmen ist, das auf...
Die Evolution fleischfressender Pflanzen ist eine Geschichte berufsverändernder Gene
Vor dem 18. Jahrhundert glaubten die Menschen im ...
Proteinfabriken: Mit der Kraft der Evolution den Feind besiegen
Die Evolution hat in der Milliarden Jahre während...