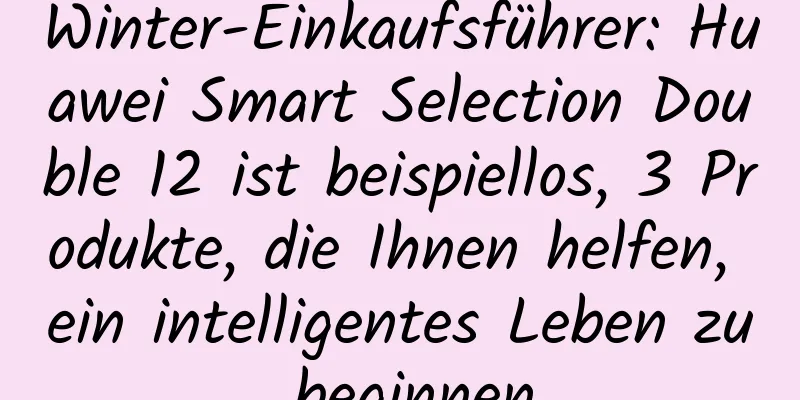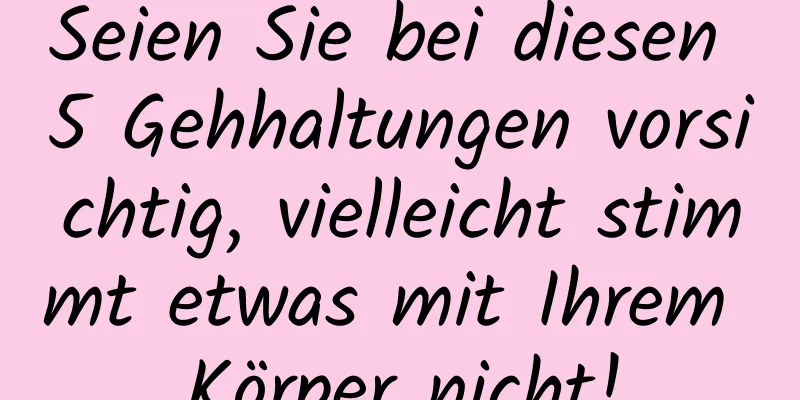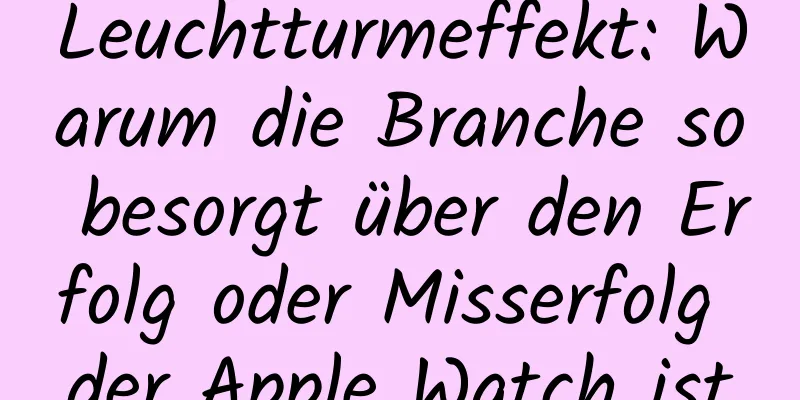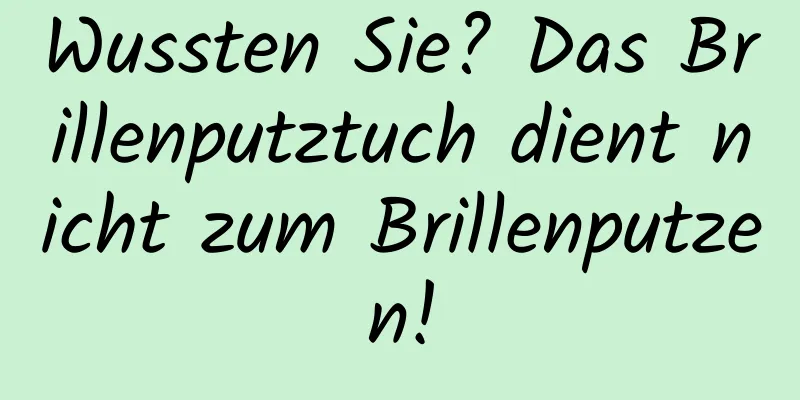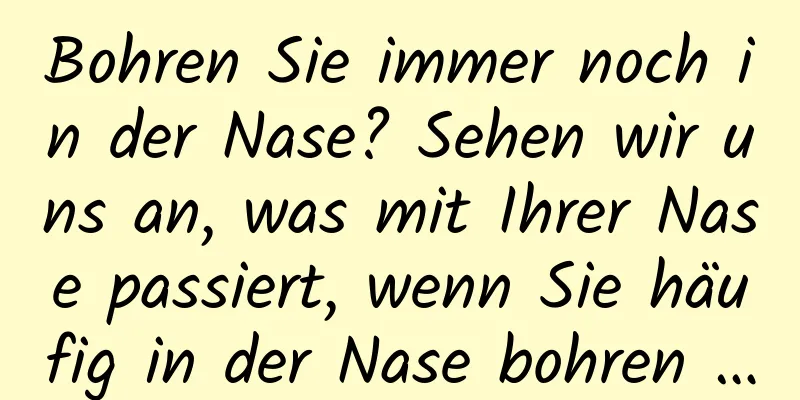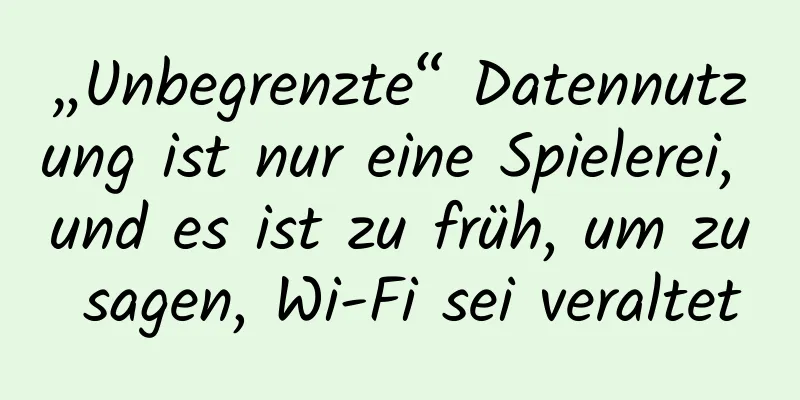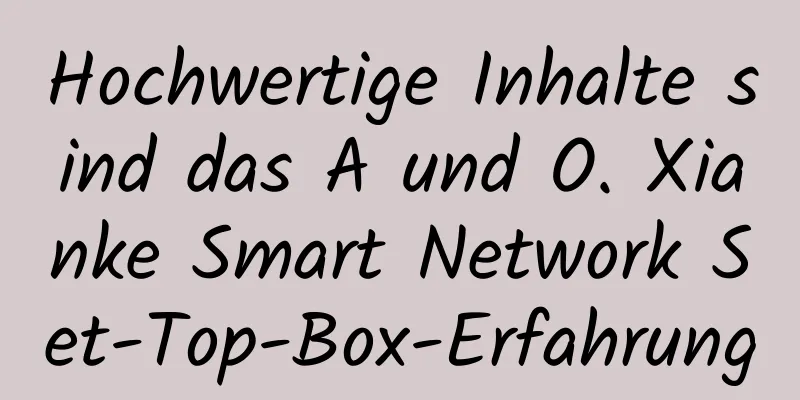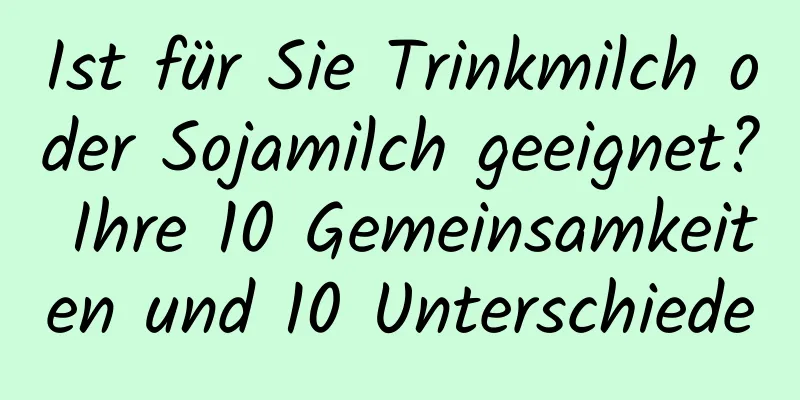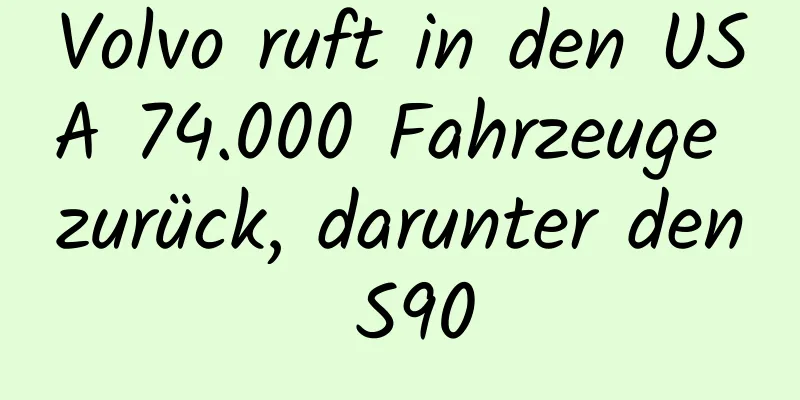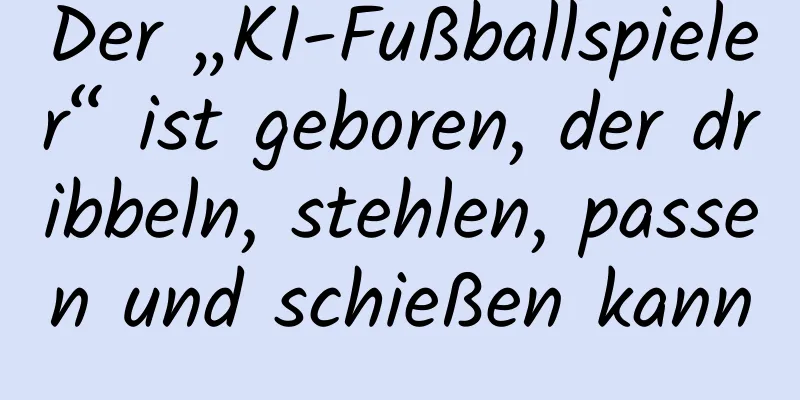Stigmatisierung und Dämonisierung von Krankheiten
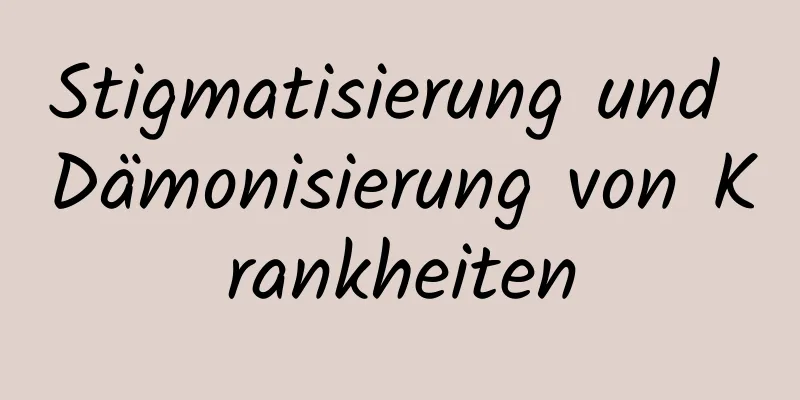
|
In jüngster Zeit scheint die Stigmatisierung des neuen Coronavirus vor allem von Politikern auszugehen, und ihre Absichten und Motive liegen auf der Hand. Ich war ein wenig überrascht, dass das britische Magazin „Nature“, das zunächst unangemessene Bemerkungen machte, sofort einen Leitartikel veröffentlichte, in dem es „ein sofortiges Ende der Stigmatisierung des neuen Coronavirus“ forderte, sich dafür entschuldigte, Wuhan und China mit dem Virus in Verbindung zu bringen, und seine Bereitschaft zum Ausdruck brachte, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Der Artikel kommt zu dem Schluss, dass viele Politiker hoffen, auf den wissenschaftlichen Rat von Experten zu hören und auf der Grundlage dieser Ratschläge Maßnahmen zu ergreifen, um auf die Epidemie zu reagieren und Leben zu retten. Was die Sprache betrifft, ist unser Rat eindeutig: Wir müssen alles tun, um Stigmatisierung zu vermeiden und abzubauen, COVID-19 nicht mit bestimmten Personengruppen oder Orten in Verbindung zu bringen und zu betonen, dass das Virus uns nicht diskriminiert – wir sind alle gefährdet. Bei so einem „Verständnis“ ist das meiner Meinung nach wirklich ein „Fortschritt“ und verdient einen Daumen hoch! Dies erinnert mich auch an viele Dinge, die mit Krankheiten zu tun haben. Der Einsatz von Krankheitserregern zur Stigmatisierung oder Dämonisierung von Krankheiten ist in der menschlichen Gesellschaft tatsächlich ein weit verbreitetes Phänomen. Sherwin Nuland, ein berühmter amerikanischer Chirurg, schrieb einmal über die Erfahrungen einer Epilepsiepatientin namens Leah. Diese intelligente und schöne Frau wurde seit ihrer Kindheit ständig gedemütigt und verspottet und wurde wiederholt von ignoranten „gutherzigen Menschen“ verletzt. Die Nonnen in der Schule sagten ihr beispielsweise: „Es ist bedauerlich, diese Krankheit zu haben. Du wirst in Zukunft geistig zurückgeblieben sein.“ Unter dieser „Suggestion“ hatte Leah wirklich das Gefühl, dass sie träge und träge wurde. Jahre später, nachdem sie operiert worden war und sich vollständig erholt hatte, benutzte sie immer noch diese Worte, wenn sie auf die „dunklen Tage“ der Vergangenheit zurückblickte: „Ich fühlte mich nicht nur anders, sondern schämte mich auch für mich selbst. Ich dachte, ich sei krank und könnte den Menschen nicht mehr ins Gesicht sehen.“ Wenn wir uns unser wirkliches Leben ansehen, gibt es zu viele solcher Beispiele. Ich erinnere mich vage daran, als Kind Zeuge eines epileptischen Anfalls geworden zu sein und auch an die Reaktionen der Menschen um mich herum. die Einstellung der Menschen gegenüber Leprapatienten und die „Haltung“ der Patienten selbst. In den vergangenen Jahren kam es vielerorts im Land zu „Hepatitis-B-Diskriminierung“ und es wurden Klagen eingereicht. Neben dem Unverständnis, der Vermeidung und sogar Diskriminierung von Patienten mit bestimmten Krankheiten treten bei den Patienten selbst oder ihren Angehörigen häufig auch Verlegenheits- und Schuldgefühle auf. Die schrecklichste, tödlichste und tabuisierteste Krankheit der letzten Jahrzehnte ist AIDS. Bevor das Humane Immundefizienz-Virus (HIV), der Erreger von AIDS, tatsächlich entdeckt wurde, gab es viele Spekulationen. Manche Menschen bezeichnen AIDS als eine latente psychische Störung, andere glauben, dass es Ausdruck eines genetischen Defekts sei. Da Menschen ihre persönlichen Gefühle, die ihr professionelles Urteil beeinträchtigen könnten, nicht außer Acht lassen können, werden in der Ethik häufig auch Fragen wie die Schuld und Unschuld der behandelten Patienten untersucht. Würden Ärzte oder Pflegekräfte beispielsweise einen AIDS-Patienten anders behandeln, der sich die Krankheit durch eine Bluttransfusion zugezogen hat, als wenn er sich die Krankheit durch sexuelle Aktivität oder Drogenmissbrauch zugezogen hätte? Sollte diese unterschiedliche Behandlung oder unterschiedliche Einstellung zur Behandlung erlaubt sein? Susan Sontag, eine berühmte amerikanische Wissenschaftlerin, die sich seit langem mit Literaturkritik und Romanschreiben beschäftigt, übte auf Grundlage ihrer persönlichen Erfahrungen scharfe Kritik an der Praxis und Denkweise, die Krankheiten dämonisiert. 1977 wurde bei Sontag Krebs diagnostiziert. Während sie sich in mehreren Krankenhäusern in den USA und Frankreich ambulant einer Chemotherapie unterzog, musste sie feststellen, dass ihre Mitpatienten alle einen „irrationalen Ekel“ gegenüber dem Krebs zeigten, ihn als „eine Herabwürdigung des Selbst“ betrachteten und sich dafür schämten. Später schrieb sie: „Solange eine bestimmte Krankheit als etwas Böses, Unüberwindbares und nicht nur als Krankheit behandelt wird, werden sich die meisten Krebspatienten moralisch minderwertig fühlen, wenn sie von ihrer Krankheit erfahren.“ Ganz zu schweigen von den ähnlichen Mythen über Verantwortung und Charakterbildung, die auch im Zusammenhang mit Krebs verbreitet werden: Krebs wird als eine Krankheit angesehen, die Menschen befällt, die leicht frustriert sind, sich nicht ausdrücken können und verklemmt sind, insbesondere diejenigen, die ihr Temperament oder ihr sexuelles Verlangen unterdrücken. Nach Sontags Ansicht führt die Dämonisierung der Krankheit (der damit verbundenen symbolischen Bedeutungen oder Metaphern) unweigerlich dazu, dass die Schuld dem Patienten zugeschrieben wird, unabhängig davon, ob der Patient selbst als Opfer der Krankheit betrachtet wird. Kurz gesagt: Was ist das „Verbrechen“ daran, krank zu sein? Opfer bedeuten Unwissenheit. Und Unwissenheit bedeutet – gemäß derselben rücksichtslosen Logik, die das Vokabular aller menschlichen Beziehungen bestimmt – ein Verbrechen. Die Entdeckung des Stigmas, unter dem Krebspatienten leiden, veranlasste Sontag dazu, zwei berühmte „kleine Bücher“ zu schreiben: „Krankheit als Metapher“ und „AIDS und AIDS und Metapher“ (die chinesische Übersetzung lautet zusammenfassend „Krankheit als Metapher“). Wenn wir Krankheiten aus soziologischer Sicht betrachten, erkennen wir, dass unangemessenes Denken ausreichen kann, um bei einer Person Schuldgefühle hervorzurufen und das Gefühl zu vermitteln, jemand sei schuld. Derzeit verbreitet sich das neue Coronavirus immer noch überall. Ich denke, die Menschen verstehen im Allgemeinen, dass sie nichts dafür können, wenn sie sich mit dem neuen Coronavirus angesteckt haben. Sie brauchen sich deshalb psychisch nicht belastet zu fühlen und es ist auch nicht ungerecht, in Quarantäne zu sein. Wenn Sie jedoch wissen, dass Sie mit der Krankheit infiziert sind, sich aber dennoch an öffentlichen Orten bewegen, als wäre nichts geschehen, ist das nicht nett und sollte verurteilt werden. |
<<: Welche Tricks haben Pflanzen, um in einem Feuermeer zu überleben?
>>: Ganesha und das Wunder der Kapillarität
Artikel empfehlen
Golf für Anfänger
In westlichen Ländern gilt Golf als aristokratisc...
Wie schnell kann ich joggen, um abzunehmen?
Laufen ist heute eine sehr gute Form der Bewegung...
Supergroße Sonnenflecken kehren zurück. Werden geomagnetische Stürme und Polarlichter erneut auftreten?
Produziert von: Science Popularization China Auto...
Baidu kauft Kuaiqian für 2 Milliarden RMB: ein gutes Geschäft für einen Mann und eine Frau
Nach Double Eleven startete auch Baidu den „Kaufe...
Administrator der Ammoniakbehandlung: Warum kann diese Batterie Fischleben retten?
Autor: Duan Yuechu Ammoniak ist eine giftige Verb...
Zhou Wen | „Komm schon“ und „Strebe nach Exzellenz“ seit 40 Jahren
Zhou Wen, ein in den 1960er Jahren geborener Prof...
Kann man beim zügigen Gehen Bauchfett verlieren?
Liebe Damen, Sie alle wollen abnehmen, nicht wahr...
Kann Laufen Sie größer machen?
Wenn Sie sich in der Phase der Knochenentwicklung...
Wie trägt man beim Training die richtige Unterwäsche?
Welche Unterwäsche sollte man beim Sport tragen, ...
Innerhalb von 6 Tagen wurden 194 Fälle bestätigt. Warum war es Manzhouli? Wie groß ist der Druck durch importierte Fälle aus dem Ausland?
Laut der sechsten Pressekonferenz der Zentrale fü...
Welche Vorteile bieten Plank-Bauchübungen?
Die Plank-Position kann die Bauchmuskeln trainier...
Kann Yoga helfen, die Brüste zu vergrößern?
Eine perfekte Figur zu haben, ist der Traum jeder...
Das ist nicht nur Vater-Mutter-Kind-Spielen, Holzsatelliten können auch ins All fliegen!
Reporter Chen Jie von Popular Science Times Das i...
Kann tägliches Training Impotenz heilen?
Impotenz ist eine häufige Männerkrankheit, die me...