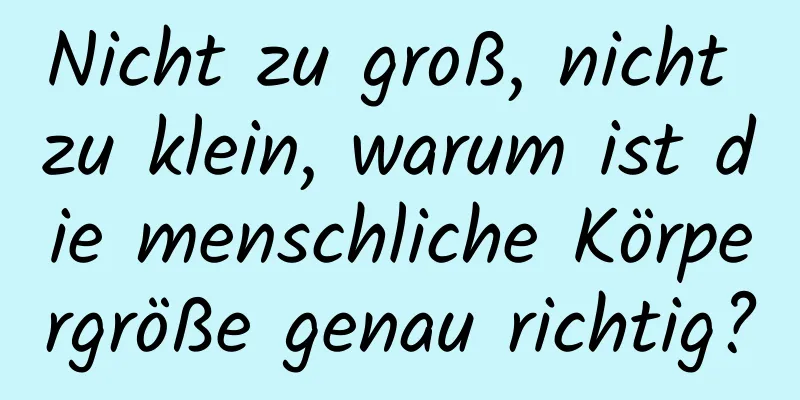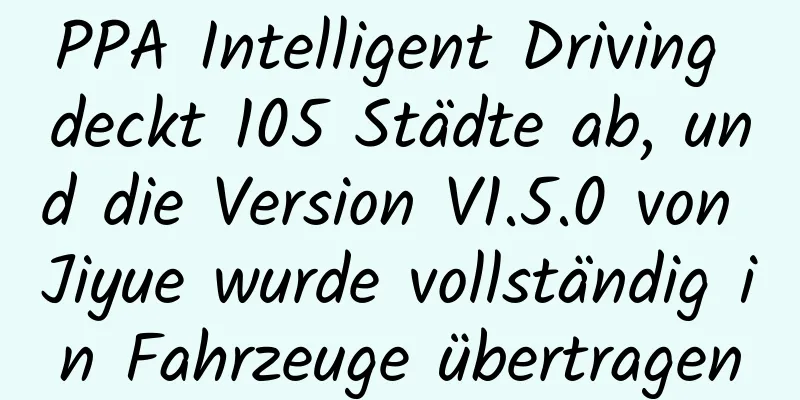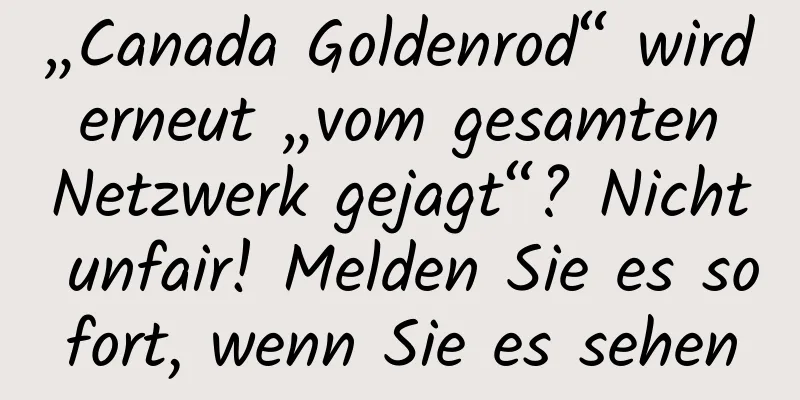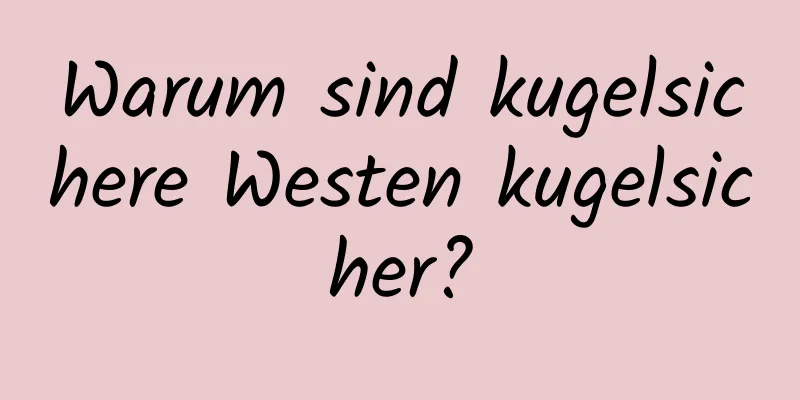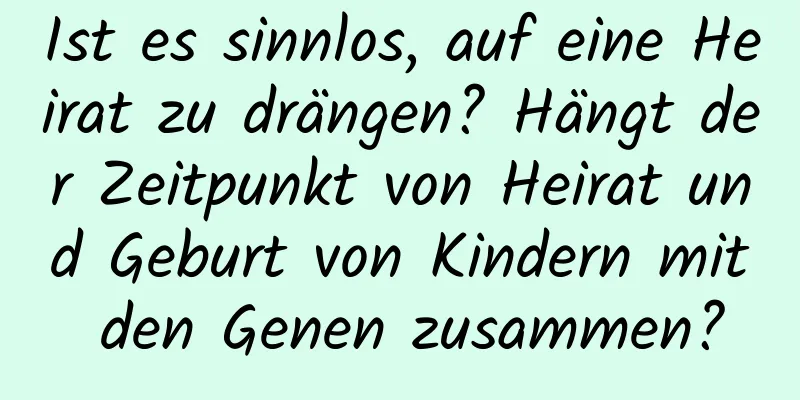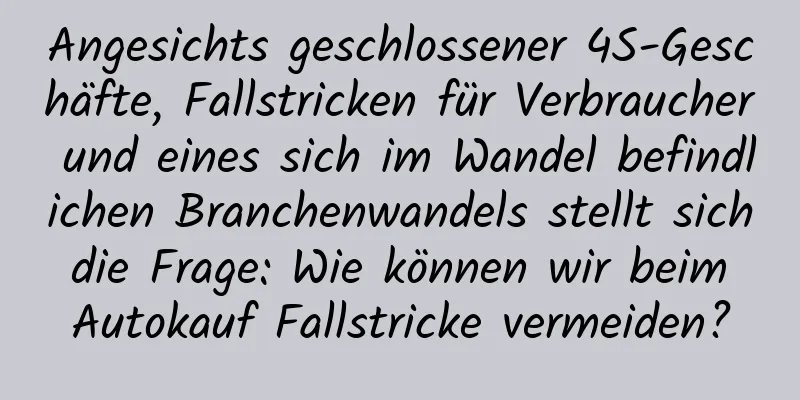Gibt es das Stockholm-Syndrom wirklich?
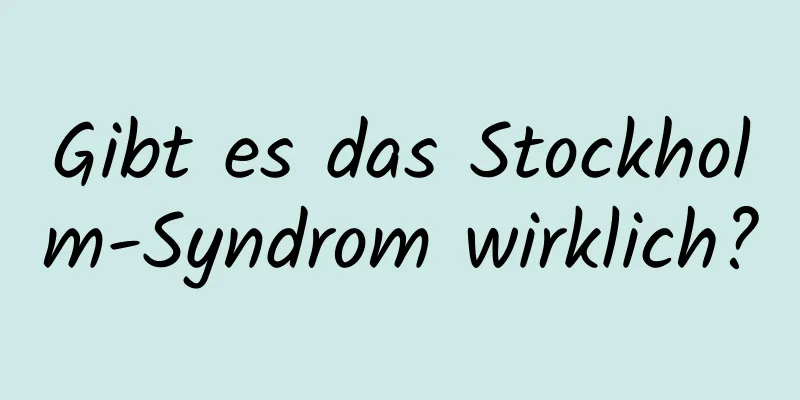
|
BBC Leviathan Press: Es gibt in der Wissenschaft viele Erklärungen für das Stockholm-Syndrom. Die Evolutionspsychologie geht davon aus, dass dies eines der wenigen psychologischen Phänomene sein könnte, die aus der Zeit der Jäger und Sammler übrig geblieben sind: Damals gab es ständig Kriege zwischen Stämmen und es kam zu zahlreichen Morden und Entführungen. Unter den Entführten befanden sich vor allem Frauen und Kinder. Um ihre eigene Sicherheit und die ihrer Kinder zu gewährleisten, entschieden sich viele Frauen aktiv oder passiv für die Integration in andere Stammesgruppen, um zu überleben. Diese Art der emotionalen Bindung ist eigentlich eine Manifestation des Abwehrmechanismus. Am 23. August 1973 um 10 Uhr betrat Jan-Erik Olsson, ein frisch entlassener Häftling, eine schwedische Kreditbank am Norrmalm-Platz in Stockholm. Mit einer Perücke und geschwärztem Gesicht betrat er die Banktür und zog ein halbautomatisches Gewehr hervor, das unter seinem Mantel versteckt war. Er hob sie in die Luft, feuerte ab und rief: „Die Party hat gerade erst begonnen!“ So begann der berüchtigtste Bankraub in der schwedischen Geschichte, ein Raub, der die damaligen Schweden nicht nur sechs Tage lang mit angehaltenem Atem vor den Fernsehern sitzen ließ, sondern auch ein heute bekanntes und umstrittenes psychologisches Phänomen auslöste: das Stockholm-Syndrom. Bald traf die Polizei ein und umstellte die Bank, bei der Olsen arbeitete. Ingemar Warpefeldt betrat als erster Kriminalinspektor das Gebäude, wurde jedoch sofort von Olsen in den Arm geschossen und mit vorgehaltener Waffe aufgefordert, sich auf einen Stuhl zu setzen und „ein Lied für Sie zu singen“. Während Wappefelt „Lonesome Cowboy“ von Elvis Presley sang, schickte die Polizei einen weiteren Beamten, Morgan Rylander, um als Vermittler zwischen Olson und der Regierungspolizei zu fungieren. Dann machte Olsson sein Angebot: drei Millionen schwedische Kronen, zwei Pistolen und eine kugelsichere Weste, ein Fluchtauto und eine Erlaubnis, Stockholm ungehindert zu verlassen. Außerdem forderte er die Polizei auf, seinen Freund und Bankräuberkollegen Clark Olofsson aus dem Gefängnis zu entlassen und zu ihm zu bringen. Um sicherzustellen, dass die Polizei seinen Bedingungen nachkam, entführte Olsen vier Bankangestellte – Birgitta Lundblad, Elisabeth Oldgren, Kristin Ehnmark und Sven Safstrom – und hielt sie als Geiseln im Tresorraum der Bank fest. Was dann geschah, war eine spannende, bizarre Pattsituation, die sechs Tage lang anhielt: Während die Polizei sich den Kopf darüber zerbrach, wie sie Olsen fassen könnte, gab sie vor, die von ihm gestellten Bedingungen zu erfüllen. Später am ersten Tag hatten sie das versprochene Bargeld, das Auto und Olofsson bereits bei der Bank abgeliefert, doch als die Polizei verlangte, den Räubern die Mitnahme der Geiseln zu verbieten, beschlossen Olson und Olofsson, im Tresorraum zu bleiben. Unterdessen verfolgten die schwedischen Bürger das spannende Spektakel, das live im Fernsehen übertragen wurde. Die Polizei erhielt weiterhin allerlei fantastische Rettungspläne von begeisterten Bürgern: Sie luden den Chor der Heilsarmee ein, am Eingang der Bank religiöse Lieder zu singen, sie warfen Tennisbälle auf den Tresorraum, um die Räuber bewegungsunfähig zu machen, sie ließen einen Bienenschwarm in die Bank los usw. Am dritten Tag der Pattsituation gelang es der Polizei, über dem Tresorraum ein Loch zu bohren, durch das sie Fotos von den Räubern und Geiseln im Tresorraum machte. Dieser Angriff wurde jedoch schnell kontert, und Olofsson schoss anschließend durch das Loch auf einen Polizisten und verletzte ihn. Am Abend des 28. August endete die sechstägige Geiselnahme schließlich, als die Polizei Tränengas in den Tresorraum feuerte und die Räuber schließlich zur Aufgabe zwang. Foto vom Tatort der Flugzeugentführung, aufgenommen von der Stockholmer Polizei am 26. August 1973. © The Unencumbered Mind Dann passierte etwas Seltsames. Als die Polizei die Geiseln aufforderte, zuerst den Tresorraum zu verlassen, weigerten sie sich, und Christian Enmark rief: „Nein, Jan und Clark (so heißen die beiden Räuber) gehen zuerst – Sie werden sie erschießen, sobald wir den Tresorraum verlassen!“ Sobald sie den Tresorraum verließen, umarmten sich die Räuber und die Geiseln, schüttelten sich die Hände und küssten sich zum Abschied. Als die Polizei Olson und Olofsson abführte, flehte Enmark: „Bitte tun Sie ihnen nichts – sie haben uns nichts getan.“ Jan Erik Olsen wurde verhaftet. © Vintage Everyday Im Laufe der nächsten Tage wurde immer deutlicher, dass sich zwischen den Geiseln und den Verbrechern eine enge emotionale Bindung gebildet zu haben schien. Obwohl Olsson und Olofsson wiederholt drohten, die Geiseln zu töten, behandelten sie sie mit überraschender Freundlichkeit. Als Christiane Enmark vor Kälte zitterte, war es Olsen, der ihr einen Mantel überzog, sie beruhigte, sie fragte, ob sie Albträume habe, und ihr eine Kugel als Talisman gab; und als Elizabeth Aldgren unter Klaustrophobie litt, erlaubte er ihr sogar, auf einem neun Meter langen Seil durch die Banklobby zu laufen. Diese freundlichen Taten brachten die Geiseln und die Verbrecher einander näher und innerhalb eines Tages nannten sich alle beim Vornamen. Sven Safstrom, einer der damaligen Geiseln, erinnerte sich später: „Wenn er uns gut behandelte, war er in unseren Augen wie Gott, als das Unglück geschah.“ Laut Enmark entwickelten die Geiseln bald mehr Hass und Angst vor der Polizei und der Regierung als vor ihren Entführern und warfen ihnen vor, ihr Leben als Druckmittel einzusetzen, um die Verbrecher zur Strecke zu bringen: „Wir hatten mehr Angst vor der Polizei als vor den beiden Jungen. Wir haben darüber gesprochen, und ob Sie es glauben oder nicht, wir haben uns ziemlich gut geschlagen. Warum konnten sie die Jungen nicht einfach mit uns wegfahren lassen?“ Enmark rief sogar den schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palme an und bat ihn, den Entführern zu erlauben, sie ins Auto zu nehmen und zu fliehen: „Meiner Meinung nach behandeln Sie unser Leben wie unbedeutende Schachfiguren. Ich habe volles Vertrauen in Clark und die Entführer. Ich bin nicht hysterisch. Sie haben uns nichts getan. Im Gegenteil, sie waren immer sehr gut zu uns. Aber wissen Sie, Olof, wovor ich wirklich Angst habe, ist, dass der überstürzte Angriff der Polizei uns töten wird.“ Die schwedische Polizei eskortierte Olsson aus der Bank, in der sich der Vorfall ereignete. BBC Ein weiterer Vorfall, der die wahren Gefühle der Geiseln gegenüber ihren Entführern offenbarte, ereignete sich, als Olsen drohte, Sven Safstrom ins Bein zu schießen, um die Polizei einzuschüchtern, und Enmark ihren Kollegen drängte, den Schuss abzugeben. Der örtlichen Regierung war bereits etwas Merkwürdiges aufgefallen. Als die Polizei mit ihrer Erlaubnis einen Kommissar in den Tresorraum schickte, um den Gesundheitszustand der Geiseln zu überprüfen, stellte sie fest, dass diese ihm gegenüber nur misstrauisch waren und den Räubern gegenüber entspannter und näher standen. An der Decke des Tresorraums angebrachte Mikrofone zeichneten außerdem auf, wie die Geiseln und ihre Entführer miteinander plauderten und scherzten. Ja, dieser Punkt lässt die Polizei glauben, dass die Räuber den Geiseln nichts antun werden, wie sie nach dem Einsatz von Tränengas behaupten. Nach dem Raubüberfall befragte Nils Bejerot, ein Kriminalpsychologe, der der Polizei während der Krise geholfen hatte, die Geiseln. Auch viele Jahre später besuchen einige ehemalige Geiseln ihre Entführer noch immer im Gefängnis. Bergero prägte den Begriff „Norrmalm-Syndrom“, um dieses scheinbar widersprüchliche Phänomen zu beschreiben. Dieser Begriff wurde bald weltweit bekannt und zum geläufigen Namen „Stockholm-Syndrom“. Obwohl der Begriff bereits 1973 geprägt wurde, fand er erst drei Jahre später breite Anwendung. Am 4. Februar 1974 wurde Patricia Hearst, die 19-jährige Tochter des Eigentümers von Hearst International, von der Symbionese Liberation Army (SLA) in ihrer Wohnung in Berkeley entführt. SLA ist eine linksgerichtete Stadtguerillagruppe aus den USA. Nachdem die Lösegeldverhandlungen gescheitert waren, fesselte die SLA Hearst, legte ihr eine Augenbinde an und sperrte sie mehrere Monate lang in einen Schrank. Sie zwang sie, den Inhalt linker Bücher auswendig zu lernen, und folterte sie bis zum Tod. Hurst sagte später aus: „(Donald) DeFreeze teilte mir mit, dass der Kriegsrat entschieden habe oder darüber nachdenke, mich hinzurichten oder mich zu einem seiner Mitglieder zu machen, und dass ich besser anfangen sollte, über die Möglichkeit des Letzteren nachzudenken. Ich war gezwungen, meine Gedanken mit ihren zu vereinen.“ Am 15. April, zwei Monate nach der Entführung, erschien Hearst bei der Hibernia Bank im Sunset District von San Francisco und beteiligte sich unter dem Namen „Tania“ an einem bewaffneten Raubüberfall. In den folgenden anderthalb Jahren nahm Hearst bis zu seiner Verhaftung am 18. September 1975 an mehreren Operationen der SLA teil, darunter an einem weiteren Banküberfall und dem versuchten Mord an zwei Polizisten. Bei der Dokumentation des Archivs bezeichnete Hearst seinen Beruf als „Stadtguerilla“. Patricia Hurst (Mitte) wird 1976 vor Gericht gestellt. © Archiv Bettmann Der Prozess gegen Hearst begann am 15. Januar 1976 und ist seitdem zu einem Meilenstein in der strafrechtlichen Verantwortlichkeit geworden. Ihr Anwalt, F. Lee Bailey, argumentierte, Hearst sei von der SLA einer Gehirnwäsche unterzogen worden und leide am Stockholm-Syndrom – einem neu geprägten Begriff, der erstmals in die Öffentlichkeit gelangte. Nach dem US-amerikanischen Strafrecht ist eine Person, sofern kein Beweis für die Diagnose einer psychischen Erkrankung vorliegt, für jedes kriminelle Verhalten, das nicht unter Zwang begangen wurde, voll verantwortlich. Überwachungsaufnahmen vom Raubüberfall auf die Hibernia Bank zeigten keine Anzeichen dafür, dass Hurst etwas gegen ihren Willen getan hätte, und obwohl bei einer psychiatrischen Untersuchung eine Reihe von Anzeichen eines extremen psychischen Traumas festgestellt wurden – ein deutlicher Rückgang des IQ, häufige Albträume und Amnesie –, zeigte sie keine erkennbare Geisteskrankheit. Sollte er daher vom Vorwurf der „Gehirnwäsche“ freigesprochen werden, wäre dies ein beispielloser Fall in der amerikanischen Rechtsgeschichte. Leider gelang es den Staatsanwälten, die Jury davon zu überzeugen, dass sie sich freiwillig der Organisation angeschlossen hatte, indem sie nachwiesen, dass es Hearst mehrfach problemlos gelungen war, Kontakt zu den Behörden aufzunehmen und der SLA zu entkommen. Hearst wurde schließlich wegen bewaffneten Raubüberfalls zu 35 Jahren Gefängnis verurteilt. Nachdem sie 22 Monate im Gefängnis verbracht hatte, wandelte Präsident Jimmy Carter ihre Strafe um, und später im Jahr 2001 begnadigte Bill Clinton Hearst und sie wurde aus dem Gefängnis entlassen. Ein weiterer berühmter Fall des Stockholm-Syndroms ist der von Natascha Kampusch, einem australischen Mädchen, das 1998 im Alter von zehn Jahren von Wolfgang Prikopil entführt und acht Jahre lang in einem Keller gefangen gehalten wurde. Am Tag von Kampuschs Flucht beging Priklopel Selbstmord, indem er sich vor einen fahrenden Zug warf, da er wusste, dass er von der Polizei verfolgt werden würde. Als Kampusch erfuhr, dass ihr Entführer tot war, brach sie Berichten zufolge in Tränen aus und zündete später eine Kerze für ihn an. Natascha Kampusch. © Eduardo Parra/Getty Images Laut dem Psychiater Frank Ochberg, der dem FBI und Scotland Yard in den 1970er Jahren dabei half, das Phänomen zu identifizieren, kann das Stockholm-Syndrom als Bewältigungsstrategie auftreten, die Entführungsopfern hilft, sich an Stresssituationen anzupassen. Die Menschen erleben zunächst etwas Schreckliches und Unerwartetes. Sie sind überzeugt, dass der Tod naht. Dann erleben sie eine Art Infantilisierung – sie werden in ihre Kindheit zurückversetzt, an einen Ort, an dem sie weder essen noch sprechen noch ohne Erlaubnis auf die Toilette gehen dürfen. Aus kleinen Gesten der Güte entwickelt sich schnell eine tiefe Dankbarkeit für das Geschenk des Lebens. Geiseln entwickeln ein ursprüngliches und sehr starkes positives Gefühl gegenüber ihren Entführern. Sie leugnen, dass diese Person sie in diese Situation gebracht hat. In ihren Augen sind es die Entführer, die sie am Leben erhalten haben. Dieser Prozess weist Ähnlichkeiten mit den „Gehirnwäsche“-Methoden auf, die Nordkorea Berichten zufolge während des Koreakriegs an amerikanischen Kriegsgefangenen anwandte. Nach Aussagen von Überlebenden wurden die Gefangenen zunächst gefoltert und ihnen wurde Schlaf und Nahrung entzogen, um ihren Willen zu brechen. Anschließend wurden sie gezwungen, kleine Aufgaben zu erledigen, wie etwa Nachrichten oder Essen zu überbringen, um ein Vertrauensverhältnis zwischen den Entführern aufzubauen. Ihre Aufgaben wurden mit der Zeit immer weniger mit ihrer ursprünglichen Weltanschauung vereinbar, beispielsweise das Verfassen oder Senden antiamerikanischer Reden, bis die Gefangenen begannen, die Beweggründe ihrer Entführer nachzuvollziehen. Wie im Fall Patricia Hearst passten sich Gefangene der Denkweise anderer an, um zu überleben. Doch obwohl der Begriff in der Populärkultur allgegenwärtig ist, sind tatsächliche Fälle des Stockholm-Syndroms selten und viele Psychiater akzeptieren nicht, dass dieses Phänomen existiert. Hugh McGowan, seit 35 Jahren Geiselunterhändler beim New York Police Department, meint: „Ich glaube nicht, dass es so etwas gibt. Manchmal sucht man in der Psychologie nach Gründen und Auswirkungen, die es gar nicht gibt. Stockholm war ein einzigartiger Fall. Er ereignete sich zu einer Zeit, als es immer mehr Geiselnahmen gab, und vielleicht wollten die Leute einfach nichts auf sich nehmen, was sich möglicherweise wiederholen würde.“ Das Stockholm-Syndrom ist keine formelle psychiatrische Diagnose und erscheint weder im U.S. Diagnostic and Statistical Manual, noch in der International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) oder anderen häufig verwendeten Diagnosetexten. Laut Jennifer Wild, Psychologin an der Universität Oxford, könnte es sich bei dem, was wir oft als Stockholm-Syndrom bezeichnen, tatsächlich um eine Mischung anderer, häufiger auftretender psychologischer Phänomene handeln, die oft in Extremsituationen auftreten: Ein klassisches Beispiel ist häusliche Gewalt, wenn jemand – meist eine Frau – von ihrem Partner abhängig wird. Sie empfindet dann eher Mitgefühl als Wut. Ein weiteres Beispiel ist Kindesmissbrauch: Wenn ein Elternteil sein Kind emotional oder körperlich misshandelt und das Kind dazu neigt, den Elternteil abzuschirmen, zu schweigen oder darüber zu lügen. Andere wiederum argumentieren, dass das Konzept des Stockholm-Syndroms selbst sexistisch sei, da es sich bei fast allen gemeldeten Opfern um Frauen handele. Sie glauben, dass dieses Etikett impliziert, dass Frauen nicht so stark wie Männer sind und dass Empathie mit Entführern ein Zeichen von angeborener Schwäche ist. Doch die Interviews des amerikanischen Journalisten Daniel Lang mit Teilnehmern des Nomalm-Raubs für den New Yorker zeigen, dass diese Sichtweise eine entscheidende Dimension der Geisel-Entführer-Beziehung übersieht: Ich stellte fest, dass die Psychiater, die ich interviewte, alle eines übersahen: Die Opfer mögen sich mit ihren Angreifern verständigt haben, wie die Ärzte behaupteten, aber das war keine Einbahnstraße. Olson drückte es hart aus: „Die Schuld liegt ganz allein bei den Geiseln“, sagte er. „Sie haben alles getan, was ich von ihnen verlangt habe. Hätten sie das nicht getan, wäre ich jetzt vielleicht nicht mehr hier. Warum hat mich keiner von ihnen angegriffen? Sie haben es uns schwer gemacht, zu töten. Sie haben zugelassen, dass wir Tag für Tag zusammenlebten, wie Ziegen auf einem Misthaufen. Wir hatten damals keine andere Wahl, als einander zu verstehen.“ Viele sogenannte Überlebende lehnen diese Bezeichnung ab, darunter auch Natasha Kampusch, die 2010 in einem Interview sagte: „Ich fand es ganz natürlich, mit dem Entführer mitzufühlen, besonders wenn man viel Zeit mit ihm verbracht hat. Es geht um Empathie, um Verbundenheit. Im Rahmen der Kriminalität Normalität zu finden, ist kein Syndrom. Es ist eine Überlebensstrategie.“ Von Gilles Messier Übersetzt von Ishmael Korrekturlesen/Sesam Zahnlücken füllen Original/ www.todayifoundout.com/index.php/2021/06/is-stockholm-syndrome-actually-a-thing/ Dieser Artikel basiert auf der Creative Commons License (BY-NC) und wird von Ishmael auf Leviathan veröffentlicht Der Artikel spiegelt nur die Ansichten des Autors wider und stellt nicht unbedingt die Position von Leviathan dar |
>>: Unglaublich! So sieht die Welt für Blinde und Farbenblinde aus ...
Artikel empfehlen
Das Zentrum der Milchstraße ist sehr hell. Gibt es dort einen supermassereichen Stern? Aber mehr als einer
Die Milchstraße, in der wir leben, ist eine sehr ...
Kann Kaffeetrinken Anämie verursachen? Das müssen Sie über gesundes Kaffeetrinken wissen
Wenn die Menschen in den letzten Jahren eine Erfr...
Alarm! VOIP-Geräte werden zu einem neuen Betrugstool. Erfahren Sie, wie Sie diese erkennen und verhindern können →
Autor: Duan Yuechu Vor kurzem wurde vielerorts ei...
Kann ich im Winter laufen?
Während des Laufens müssen mehrere Dinge gut gema...
Russische Geschichte in einem Atemzug verstehen (3)
Gemischtes Wissen Speziell entwickelt, um Verwirr...
Welche Schuhe eignen sich zum Laufen?
Laufen ist ein sehr einfacher Sport, deshalb acht...
Ist es eine Notwendigkeit oder eine Spielerei? Wenn Sie Spiele lieben, brauchen Sie dann wirklich ein Gaming-Telefon?
654 Millionen Spieler tragen jedes Jahr zu einem ...
Was sind Sportverletzungen?
Beim Training erleiden viele Menschen Sportverlet...
@2022 College-Aufnahmeprüfung, bitte akzeptieren Sie diese Tipps zur College-Aufnahmeprüfung
Die nationale College-Aufnahmeprüfung 2022 steht ...
Was ist die einfachste Art, eine Übung für den unteren Rücken durchzuführen?
Heutzutage müssen Mädchen, die nach dem Jahr 2000...
Welche Abendzeit eignet sich am besten zum Trainieren?
Wenn Menschen sich mit der Wahl der Trainingszeit...
Nass, nass, nass, nass … wie unverschämt kann die Rückkehr des Südwindes sein?
Haben Sie schon einmal ein solches Wetter erlebt?...
Können Frauen während der Menstruation Sit-ups machen?
Ich glaube, jede Freundin kennt die Menstruation....
Ist frisch geschlachtetes Fleisch das frischeste? Der Schlüssel zur Auswahl eines guten Stücks Schweinefleisch liegt darin, diese 6 Punkte zu beachten →
Gerücht: „Fleisch, das frisch geschlachtet wurde,...