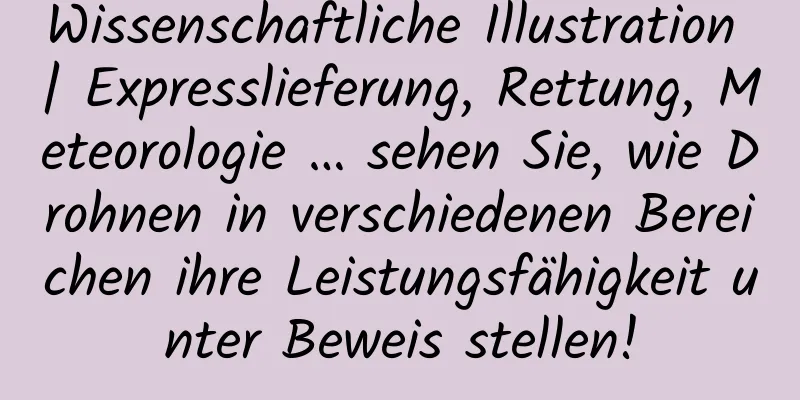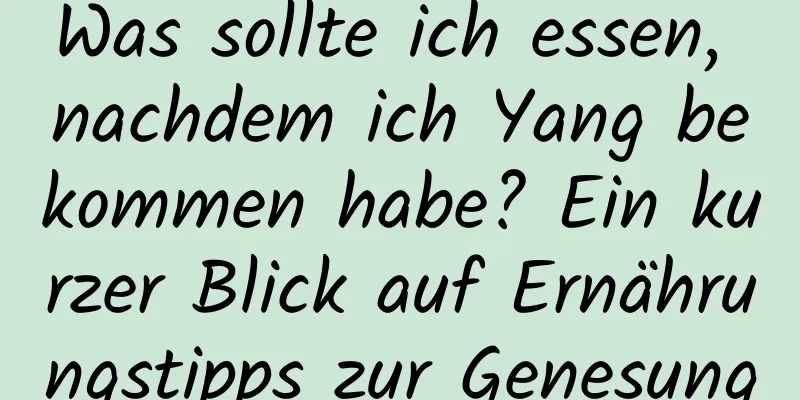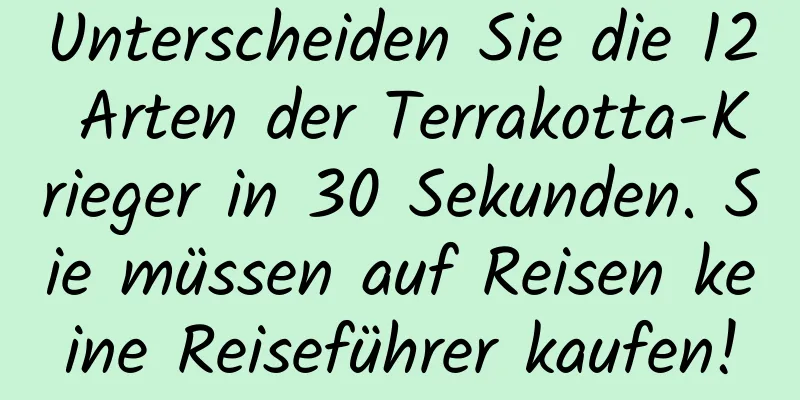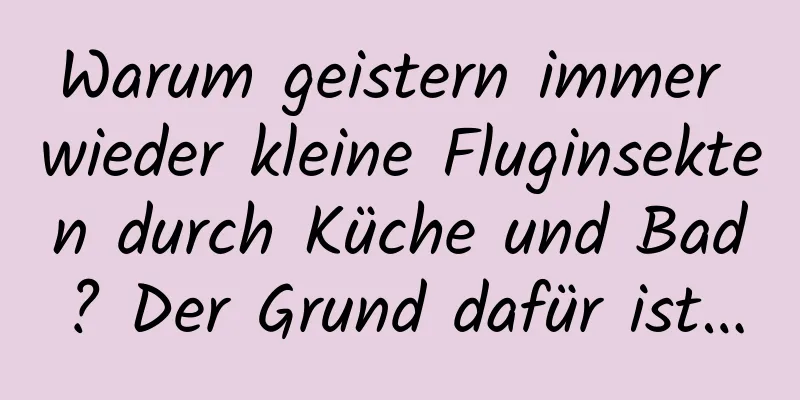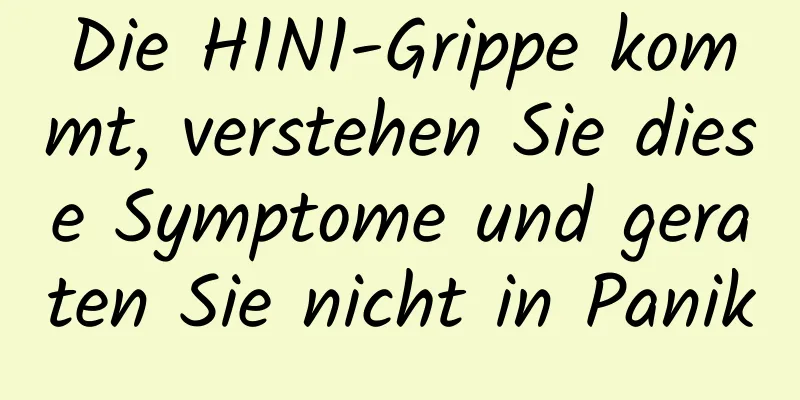Das Geheimnis des Tiefseeschlosses: Mensch, woher kommst du?
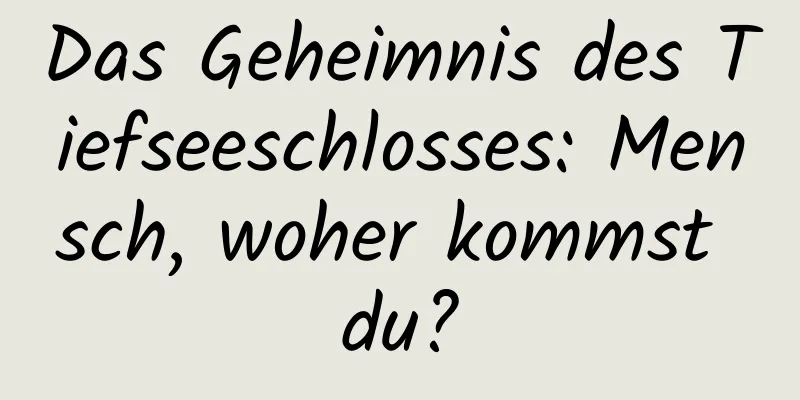
|
Manche Rätsel werden vielleicht nie gelöst. Von Amanda Heidt Zusammengestellt von Huang Yan „Woher komme ich?“ „Woher komme ich?“ ist neben „Wer bin ich?“ eine der drei Grundfragen der Philosophie. und "Wohin gehe ich?" Seit Beginn der menschlichen Zivilisation haben die Menschen nie aufgegeben, ihre eigenen Ursprünge zu erforschen. Über Jahrtausende hinweg haben unzählige Literaten, talentierte Männer und schöne Frauen dafür mit ihrem Blut und ihrem Leben bezahlt – glücklicherweise geschah dies nur im Zeitalter der Unwissenheit, und heute müssen die Menschen nur noch mit ihrer Zeit und ihren Haaren bezahlen. Heute, nach jahrzehntelanger Arbeit, haben Wissenschaftler diese Frage im Wesentlichen mit der Aussage beantwortet, dass wir uns aus primitiven Eukaryoten entwickelt haben. Allerdings ist der Ursprung der eukaryotischen Zellen immer noch unklar. Die Frage, die Evolutionisten nun zu beantworten versuchen, lautet: „Wir stammen von primitiven eukaryotischen Zellen ab. Woher also stammen die primitiven eukaryotischen Zellen?“ Im Jahr 2022 begaben sich López-García, ein Biologe der Universität Paris -Saclay, und seine Kollegen auf eine Reise, um die Ursprünge des Lebens weiter zu erforschen. Zu diesem Zweck begaben sie sich an einen der trockensten Orte der Welt – die mit Büschen und Schotter bedeckte Hochebene im Norden der Atacama-Wüste in Südamerika. Besucher sind dort nicht willkommen, aber sie könnten Hinweise auf die Ursprünge komplexen Lebens enthalten. Umgeben von Bergen und Sanddünen gibt es einen kleinen Teich mit warmem, bitterem Brackwasser. Der Pilzteppich aus Cyanobakterien und Archaeen gleicht einem tausendschichtigen Kuchen, eine Schicht über der anderen – für sie könnte er eine seltene Oase in der Wüste sein. López-García nennt es den „Urwald“ und meint damit das „komplexe“ Ökosystem, das lange vor der Artenexplosion auf der Erde existierte. Wissenschaftler nutzen diese winzigen Ökosysteme heute zur Simulation urzeitlicher Ökosysteme, da sie spätestens mit dem ersten Auftreten der Eukaryoten entstanden sein müssen. Die Pilzmatte könnte die Bedingungen nachahmen, die auf der frühen Erde zur Entstehung eukaryotischen Lebens führten. VIELFALT, ÖKOLOGIE UND EVOLUTION VON MIKROBEN (DEEM)/PURIFICACIÓN LÓPEZ-GARCÍA Jede Schicht dieser Pilzmatten wird von unterschiedlichen Arten von Mikroorganismen bewohnt. Die Hauptorganismen, die die Oberfläche bevölkern, wo es reichlich Licht und Sauerstoff gibt, sind Cyanobakterien, die ersten photosynthetisch Sauerstoff freisetzenden Organismen. Ihr Auftreten veränderte die Umwelt der Erde von sauerstoffarm zu sauerstoffhaltig, was die materielle Grundlage für die spätere aerobe Atmung bot – sagen wir gemeinsam „Danke, Cyanobakterien“. Dabei ernähren sich Cyanobakterien nicht nur vom Menschen, sondern auch heterotrophe Organismen in der sauerstoffarmen Umgebung des unteren Pilzteppichs ernähren sich von den Nebenprodukten der Cyanobakterien. Die untere Schicht der Pilzmatte ist schwarz und stinkend. Dies ist das Ergebnis der Mikroorganismen, die in einer sauerstoffarmen Umgebung Sulfat reduzieren und Methan produzieren. Das Leben ist hier nicht für alle einfach. Sie ernähren sich von den Stoffwechselabfällen der anderen – sie füttern sich gegenseitig mit ihrer eigenen Scheiße und Pisse. Eine solche Beziehung, in der die Lasten gemeinsam getragen werden, wird wissenschaftlich als „gegenseitige Symbiose“ oder „Ernährungssymbiose“ bezeichnet. López-García sagt, diese vorübergehende, für beide Seiten vorteilhafte Beziehung könne sich mit der Zeit stabilisieren und zu einer dauerhaften entwickeln – so, als ob man bis ins hohe Alter Sex hätte. In dieser Umgebung können Individuen verschiedener Arten von Mikroorganismen zusammenwachsen und eine relativ stabile Einheit bilden. Wissenschaftler vermuten, dass es sich bei diesem Gebilde um den Prototyp einer frühen komplexen eukaryotischen Zelle handelte. Im Laufe der langen Geschichte besetzte diese primitivste „Zelle“ nach und nach die gängige ökologische Nische und entwickelte sich zu einer stabilen eukaryotischen Zelle. Eukaryotenzellen mit unterschiedlicher Arbeitsteilung vereinigten sich auf ähnliche Weise und entwickelten sich schließlich zu dem vielfältigen makroskopischen Leben, das wir heute kennen. Dieser Vorgang wird „ Eukaryogenese “ genannt. Die Definition der Eukaryogenese ist umstritten, bezieht sich aber im Allgemeinen auf den evolutionären Anstieg der Zellkomplexität vor 1 bis 2 Milliarden Jahren. In dieser Zeit entstanden einige der charakteristischen Merkmale moderner eukaryotischer Zellen, wie etwa der Zellkern, die Mitochondrien, das Zytoskelett, die Zellmembran und die Chloroplasten. Diese Merkmale traten zwischen dem ersten und dem letzten gemeinsamen Vorfahren aller eukaryotischen Zellen auf. Gemäß der Akronymmethode wird ersteres FECA (First Eukaryotic Common Ancestor) und letzteres LECA (Last Eukaryotic Common Ancestor) genannt. Viele Einzelheiten des Prozesses sind jedoch noch ungeklärt. Wie sahen die ersten Eukaryoten aus? Welche Art von Beziehungen könnten sie zu anderen Organismen haben? Wie funktionieren ihre molekularen Mechanismen und wie entwickeln sie sich? …Diese Rätsel müssen noch gelöst werden. Über wichtige Fragen wie „in welchem Lebenszweig es entstanden ist“ und „welche mikrobiellen Akteure möglicherweise dazu beigetragen haben“, herrscht in der Wissenschaft noch keine Einigkeit. Die Identifizierung der „Asgard-Archaeen“ in den letzten Jahren hat die Diskussion über den Ursprung der Eukaryoten jedoch erneut neu belebt. Dieses nach der nordischen Mythologie benannte Archaeon ist „der nächste lebende Verwandte der modernen Eukaryoten“ und liefert Beweise für frühere Diskussionen, wirft aber auch neue Fragen auf. Einige Forscher glauben, dass dies derzeit die aufregendste Entwicklung in der Biologie ist. „Es wird so viel entdeckt und so viele Vorhersagen werden bestätigt.“ Der nordische Tempel von Asgard erscheint Im Jahr 2013 suchte Anja Spang, die in Evolutionärer Mikrobiologie promoviert hatte, nach einer Postdoc-Stelle (Anmerkung der Übersetzerin: Wer hat Sie gebeten, Biologie zu studieren? Sie finden doch keine Stelle, oder?!). Seine Doktorarbeit befasste sich mit einer Gruppe von Archaeen namens Thaumarchaeota (jetzt umbenannt in Nitrososphaerota). (Anmerkung des Übersetzers: Sieht dieses Thema aus, als könnte es zu einem Job führen?!) Während ihrer Promotion entdeckte Anja, dass die Genome dieser und einiger anderer Archaeen Gene enthielten, die für „ eukaryotische Signaturproteine (ESP)“ kodieren. Sie werden als eukaryotische Signaturproteine bezeichnet, da es sich bei ihnen um charakteristische Proteine in eukaryotischen Zellen handelt. Das bedeutet, dass sie in Archaeen nicht vorkommen sollten – es aber tun. Mit dieser Frage im Kopf schloss sich Anja Spang der Forschungsgruppe von Professor Thijs Ettema an der Universität Uppsala in Schweden an und begann ihre Reise zur Erforschung der Tiefsee. (Der Übersetzer hat an der Universität Uppsala in Schweden studiert. Als ich diesen Absatz sah, sagte ich: Melonen zu Hause essen.jpg.) Loki's Castle liegt mitten im Atlantik und ist eine Gruppe von fünf aktiven hydrothermalen Quellen. (Bildnachweis: Zentrum für Geobiologie von RB Pedersen) Mehr als 2.300 Meter unter der Oberfläche des Nordatlantiks zwischen Norwegen und Grönland befindet sich ein Haufen Meeresbodensedimente namens „Rocky Castle“, aus dem Ettemas Team Genome extrahieren will. Die ursprüngliche Probe bestand aus weniger als einem Teelöffel Meeresbodenschlamm, doch bei der Analyse lieferte die zur Annotation und Analyse des genetischen Materials verwendete Software merkwürdige Ergebnisse. Das ist eigentlich keine große Sache, denn die Erfahrung der wissenschaftlichen Forschung zeigt, dass das Gute an unerwarteten und unbefriedigenden Ergebnissen darin liegt, dass sie wahrscheinlich wahr sind. Die Software markiert homologe Gene zum Gen, das Aktin kodiert. Aktin wird in eukaryotischen Zellen zur Aufrechterhaltung der Zellform verwendet und ist ein typisches eukaryotisches Protein. Es sollte offensichtlich nicht in Archaeen vorkommen. Daher stammen die von der Software markierten homologen Gene aus einer neuen Gruppe. Im Jahr 2015 veröffentlichte Ettemas Team einen Artikel in der Fachzeitschrift Nature und nannte dieses Gen Lokiarchaeota, wobei „Loki“ eine Hommage an Loki in der nordischen Mythologie ist. In den folgenden Jahren bereicherte das Team diese Gruppe schrittweise und nannte sie „Asgard-Superphylum“. Neben Loki umfasst es auch Gruppen, die nach nordischen Göttern wie Thor, Odin und Heimdall benannt sind – diese Götter leben alle im Asgard-Palast und das Wichtigste für eine Familie ist, zusammen zu sein. Seitdem haben Forscher weitere eukaryotische charakteristische Proteine in der oben genannten „Familie“ entdeckt, beispielsweise Homologe von Proteinen, die an verschiedenen physiologischen Prozessen beteiligt sind, von der Ubiquitin-Signalgebung bis zur Gametenfusion. Charakteristische Proteine der Eukaryoten kommen in dieser Familie sehr häufig vor, was darauf schließen lässt, dass diese Mikroorganismen die den heutigen Eukaryoten am nächsten stehenden lebenden Prokaryoten sein könnten. Und moderne Eukaryoten haben ihre molekularen Mechanismen wahrscheinlich von Archaeen geerbt. Traditionell ging man davon aus, dass sich die modernen Eukaryoten aus urzeitlichen Bakterien oder sogenannten „Proto-Eukaryoten“ entwickelt haben. Doch nun droht diese Ansicht zu scheitern. Die meisten Wissenschaftler glauben heute, dass der gemeinsame Vorfahre aller lebenden eukaryotischen Zellen ein Vorfahre der Asgard-Superlinie oder einer anderen ähnlichen Gruppe urzeitlicher Organismen (der Archaea) war. Im Jahr 2019 gelang es Forschern erstmals, Organismen der Asgard-Superfamilie zu züchten und so die Familie eingehender zu untersuchen. Sie stellten fest, dass eine kultivierte Art klein und langsam wuchs und sich nur alle zwei bis drei Wochen teilte, während sich andere Mikroorganismen innerhalb von Minuten oder Stunden verdoppeln konnten. Sie nannten den ersteren „Candidatus Prometheoarchaeum syntrophicum“ (der Name stammt offensichtlich von Prometheus), und Candidatus Prometheoarchaeum syntrophicum lebt in enger Symbiose mit einer anderen Gruppe von Archaeen namens „Methanogenium“. Erstere gewinnen Stickstoff und Energie durch die Verdauung von Aminosäuren und Peptiden, wobei Wasserstoff entsteht, der dann von Letzteren aufgenommen und verwertet wird. Durch diesen Vorgang kann der Wasserstoffgehalt im Mikromilieu reduziert und so der Zellstress gelindert werden. Wissenschaftler, die das Asgard-Supersystem untersuchen, glauben, dass diese symbiotische Beziehung ein Modell für die Entstehung der Eukaryoten sein könnte. Asgard Archaea wurde erstmals 2015 von Forschern anhand metagenomischer Daten identifiziert und gilt als der den modernen Eukaryoten am nächsten stehende lebende Prokaryot. Einige Jahre später wurde das erste asgardische Archaeon, Candidatus Prometheoarchaeum syntrophicum, kultiviert, wobei einzigartige Aspekte seiner Biologie ans Licht kamen. HIROYUKI IMACHI, MASARU K. NOBU UND JAMSTEC Anja Spang sagt, dass diese symbiotische Beziehung auch auf genetischer Ebene bei anderen Archaeen nachgewiesen wurde, aber die Beziehung zwischen Candidatus Prometheoarchaeum syntrophicum und Methanogenium liefere dafür solide Beweise. Viele Jahre später erinnerte sich Anja, die es inzwischen an Land geschafft hat und ihre eigene Forschungsgruppe am Königlich Niederländischen Institut für Meeresforschung gegründet hat: „Als ich erfuhr, dass die Arbeit, die diesen Organismus und seine Ernährungssymbiose beschreibt, endlich veröffentlicht werden würde, war ich sehr glücklich. Das beweist, dass diese Art experimenteller Arbeit für Stoffwechselvorhersagen im Asgard-Supersystem von Bedeutung ist.“ Umstrittene eukaryotische Hypothese Diese frühen Beobachtungen führten zu zahlreichen Forschungsarbeiten – und einem großen Hype. In den folgenden Jahren erschienen auf bioRxiv Hunderte von Vorabdrucken von Artikeln über das Asgard-Supersystem und den eukaryotischen Ursprung. Die unmittelbarste Auswirkung der oben genannten Entdeckung besteht darin, dass Eukaryoten und Archaeen derselben Domäne zugeordnet werden , wodurch das aus drei Domänen bestehende Baummodell des Lebens, bestehend aus Eukaryoten, Prokaryoten und Archaeen, auf ein Zwei-Domänen-Modell reduziert wird. (Anmerkung des Übersetzers: „Domäne“ ist die größte Einheit in der biologischen Taxonomie. Unter einer Domäne gibt es mehrere Reiche, gefolgt von den bekannten Stämmen, Klassen, Ordnungen, Familien, Gattungen und Arten; beispielsweise gehören Menschen zur Domäne Eukaryota, zum Reich Animalia, zum Stamm Chordata, zur Klasse Mammalia, zur Ordnung Primates, zur Familie Hominidae, zur Gattung Homo, zur Art Homo sapiens...) Früher glaubte man, dass sowohl Bakterien als auch Archaeen Prokaryoten seien. Doch im Laufe der fortwährenden Forschung in der Planbiologie stellte man fest, dass die Unterschiede zwischen Archaeen und anderen Prokaryoten immer größer wurden. Daher trennte man die Archaeen und klassifizierte sie als Archaeen. Obwohl Eukaryoten und Archaeen im traditionellen Drei-Domänen-Modell einen gemeinsamen Vorfahren haben, gehören sie unterschiedlichen Zweigen an. Forschungen im Bereich der Systembiologie haben in den letzten Jahren gezeigt, dass komplexe eukaryotische Zellen aus Archaeen entstanden sind. Dadurch können Eukaryoten und Archaeen derselben Domäne zugeordnet werden. Das Dual-Domain-System wurde bereits vor der Entdeckung des Asgard-Supersystems diskutiert, das Asgard-Supersystem liefert jedoch weitere Beweise dafür. Die Zwei-Domänen-Hypothese unterstützt auch die Theorie, dass Eukaryoten aus Archaeen und nicht aus sogenannten „Proto-Eukaryoten“ entstanden sind. 01Was war zuerst da, die Zelle oder die Mitochondrien? Viele Wissenschaftler glauben, dass die ersten Eukaryoten aus einer Zusammenarbeit zwischen Archaeen und Bakterien entstanden sind. Irgendwie fanden die Bakterien ihren Weg in die Archaeen und wurden zu Organellen wie dem Zellkern und den Mitochondrien – endgültige Kennzeichen eukaryotischen Lebens. Die Einzelheiten dieses Prozesses sind noch unklar, aber Hinweise kommen höchstwahrscheinlich aus den Mitochondrien. „In den Mitochondrien gibt es DNA, die auf Alphaproteobakterien zurückgeht“, sagt Laura Eme, Evolutionsmikrobiologin am französischen Nationalen Zentrum für wissenschaftliche Forschung (CNRS). „Es ist ein solider Proof of Concept, auch wenn wir die genaue Route nicht kennen.“ α-Proteobakterien sind eine Klasse von Bakterien im Stamm der Proteobakterien. Es gibt große interne Unterschiede und nur sehr wenige Gemeinsamkeiten, und die Gruppe ist allgemein als „Bulk Gang“ bekannt. Die meisten α-Proteobakterien sind gramnegativ und zu den typischen Mitgliedern zählen Pflanzensymbionten wie Rhizobien, endosymbiotische Bakterien wie Wolbachia und intrazelluläre Parasiten wie Rickettsien. Manche Leute glauben, dass α-Proteobakterien dabei sind, sich in Organellen umzuwandeln, und dass es sich bei den aktuellen Organellen um α-Proteobakterien handelt, die bereits gelandet sind und eine „Organisation“ innerhalb der Zelle aufweisen. Selbst wenn Gerüchte stichhaltige Beweise liefern, wird die Öffentlichkeit dennoch die Einzelheiten ausgraben – bei Wissenschaftlern ist es genauso. Über den Ablauf der „Prüfung“ von α-Proteobakterien in Zellen gab es schon immer unterschiedliche, ja sogar widersprüchliche Hypothesen. Wie gelangen α-Proteobakterien in Zellen? Wissenschaftler grübeln schon lange darüber nach, können es aber noch immer nicht herausfinden: Der Prozess der Endozytose erfordert enorme Mengen an Energie. Bei einer solch luxuriösen physiologischen Funktion stellt sich die Frage: Waren es zunächst die Mitochondrien, die Energie für diesen Prozess lieferten, und entwickelten die Zellen dann die Endozytosefunktion, oder trat die Endozytosefunktion zuerst auf, bevor die Zellen Mitochondrien in sich aufnehmen konnten? Daher waren die Wissenschaftler in zwei Lager gespalten: „Mitochondrien kamen zuerst“ und „Endozytose kam zuerst“, und sie lieferten sich in wissenschaftlichen Zeitschriften eine hitzige Debatte. Die Funktion der Endozytose wurde bei Prokaryoten jedenfalls schon lange nicht mehr beobachtet. Erst vor Kurzem entdeckten Forscher bei einer Bakterienart eine „Quasi-Endozytose“. Laura Eme kommentierte: „Viele Menschen glauben, dass Prokaryoten nicht endozytieren können und die Vorfahren der Mitochondrien daher nicht von Zellen verschluckt werden können. Aber jetzt wissen wir zumindest, dass Prokaryoten endozytieren können.“ Das ist es, was Fächer wie Biologie und Chemie so qualvoll macht: Anders als Mathematik, Physik und andere Fächer mit einfachen und klaren Formeln sind Chemie und Biologie immer voller Ausnahmen. Beispielsweise könnte die Beschreibung von „Pekingern“ in Mathematik und Physik lauten: „Personen mit ID-Nummern, die mit 110 beginnen, sind Pekinger.“ Unabhängig davon, ob diese Aussage richtig oder falsch ist, gibt es zumindest einen klaren Maßstab für die Beurteilung. Die Theorien aus Chemie und Biologie ähneln eher der Aussage „Menschen, die gerne Douzhi trinken, sind Beijinger. Wir haben jedoch festgestellt, dass manche Menschen in Beijing geboren wurden, aber nicht gerne Douzhi trinken. Deshalb definieren wir sie als ‚breite Beijinger‘ und nennen die traditionell definierten Beijinger ‚klassische Beijinger‘. Jetzt haben wir den ‚Super-Beijing-Bereich‘, der in ‚klassische Beijinger‘ und ‚breite Beijinger, die keine klassischen Beijinger sind‘ unterteilt werden kann. Dann haben wir einige Leute gefunden, die auch gerne Douzhi trinken, aber keine Beijinger sind. Deshalb nennen wir sie ‚Pseudo-Beijinger‘ …“ Darüber hinaus haben vorläufige Beobachtungen des Asgard-Supersystems einen zusätzlichen Einschlussmechanismus enthüllt. Als Wissenschaftler Candidatus Prometheoarchaeum syntrophicum zum ersten Mal kultivierten, bemerkten sie einige lange, dünne Fortsätze auf der Oberfläche des Zellkörpers – Ausläufer von Membranstrukturen, die als „Vesikel“ bezeichnet werden. Mithilfe der oben beschriebenen Aktinhomologe können diese Bläschen möglicherweise einen externen Gegenstand umgeben und miteinander verschmelzen, wodurch der Fremdkörper eingeschlossen wird. Infolgedessen wird das Problem der Phagozytose „immer weniger problematisch“. Mit anderen Worten: α-Proteobakterien werden höchstwahrscheinlich von Prokaryoten „verschluckt“ und in Mitochondrien umgewandelt. 02Wie ist der Zellkern entstanden? Doch wenn es um den Zellkern geht, ist die Sache nicht so klar. Es wird allgemein angenommen, dass das typischste Merkmal, das Eukaryoten von Prokaryoten unterscheidet, das Vorhandensein eines Zellkerns ist. Die Spekulationen über die Entstehung von Zellkernen reichen von „in Amöben lebenden Bakterien“ bis hin zu „Überresten urzeitlicher Riesenviren“. In den 1990er Jahren schlug López-García die „Hypothese der trophischen Symbiose“ zur Entstehung der Eukaryoten vor, die von einer symbiotischen Beziehung zwischen zwei Bakterien und einem Archaeon ausging. López-García und ihre Kollegen haben diese Hypothese vor einigen Jahren aktualisiert, nachdem das Asgard-Supersystem entdeckt wurde. Anstatt Archaeen als ursprünglichen Wirt zu betrachten, schlugen sie das Konzept der „Urbakterien“ vor. Ihrer Hypothese zufolge handelt es sich bei den „Archaeobakterien“ um ein Archaeon, das den Organismen im Asgard-Supersystem ähnelt, Wasserstoff produzieren kann und zugleich der ursprüngliche Zellkern ist. Der Wirt, der einen solchen „Zellkern“ akzeptiert, ist höchstwahrscheinlich eine Art δ-Proteobakterien, die der Vorfahr der Mitochondrien und α-Proteobakterien sind. Ihre Hypothese wird durch die Tatsache gestützt, dass die meisten Gene moderner Eukaryoten tatsächlich von Bakterien und nicht von Archaeen stammen. und dass die Lipide, aus denen die Zellmembranen eukaryotischer Zellen bestehen, in Struktur und Zusammensetzung denen von Bakterien ähnlicher sind als denen von Archaeen (ein Phänomen, das als „Lipidkluft“ bekannt ist). Ihre Hypothese ist die bislang einzige, die sowohl die Entstehung des Zellkerns als auch das Phänomen der Lipidtrennung erklären kann. Michelle Leger ist Postdoc für Evolutionäre Mikrobiologie am Institut für Evolutionsbiologie in Barcelona, wo sie die Ursprünge bestehender Archaeengenome verfolgt, um aktuelle Hypothesen zu stützen oder zu widerlegen. In Bezug auf die von López-García und anderen vorgeschlagene „Hypothese der trophischen Symbiose“ sagte Leger, dass es in den Mitochondrien klare genomische Signale von α-Proteobakterien gebe, er jedoch keine ähnlichen Signale von δ-Proteobakterien im Zellkern gefunden habe. Leger ist außerdem der Ansicht, dass die aktuellen Erkenntnisse die Schlussfolgerung stützen, dass der Zellkern von Archaeen stammt. Obwohl archäische Gene nur einen kleinen Teil des heutigen Kerngenoms ausmachen, sind viele dieser Gene hochkonserviert. Beispielsweise stammen die für die DNA-Replikation und -Transkription verantwortlichen Gene größtenteils von Archaeen. Leger ist daher der Ansicht, dass „diese Hypothesen Sinn ergeben, wir aber immer noch nicht wissen, welche anderen Organismen an diesen Evolutionsprozessen beteiligt sind.“ Entdeckung eines neuen Weges für die Entwicklung von Eukaryoten Viele Forscher meinen, dass es bedauerlich sei, dass viele Fragen auf diesem Gebiet wohl nie eine vollständige Antwort finden werden, auch wenn die Zahl der sequenzierten Bakterien- und Archaeenarten rapide zunimmt und neue Hinweise zur Aufklärung der Beziehung zwischen diesen Organismen und der frühen Entstehung der Eukaryoten liefert. Eukaryoten gibt es schon zu lange und es wurden zu viele Gene zwischen zu vielen Arten ausgetauscht und weitergegeben. Für Wissenschaftler ist es unmöglich, alle Teile zusammenzusetzen, aber sie versuchen es trotzdem. Zu den derzeit in der Wissenschaft weit verbreiteten Forschungsmethoden zählen Omics, Molekularbiologie und Fossilienforschung. Der nächste gute Ausgangspunkt wären funktionelle Studien moderner eukaryotischer Genome und Proteome. Die Untersuchung der Funktion kann Hinweise darauf liefern, wie sich einzelne Gene und Proteine bei frühen Vorfahren verhielten. Vor einigen Jahren gab es nur ein Asgard-Superliniengenom, doch heute gibt es Hunderte solcher Gruppen und Forscher bringen ihre Details ans Licht. „Wir wissen jetzt genau, welche Gene in Eukaryoten von Asgard-Archaeen vererbt wurden, und das ist sehr neuartig“, sagt Laura Eme, „aber was wir nicht wissen, ist, was diese Gene in der Asgard-Superlinie getan haben und tun – und das ist der Trick.“ Erinnern Sie sich an meine frühere Erwähnung, dass es vermutlich homologe Gene gibt, die eukaryotische Aktin-Gene in Archaeen kodieren? Im Jahr 2020 synthetisierten Forscher diese homologen Gene im Asgard-Superliniengenom. Sie injizierten diese Homologe in Kaninchenzellen und stellten fest, dass sie an eukaryotisches Aktin binden und ähnliche Funktionen erfüllen konnten, beispielsweise indem sie Kalziumionen dabei halfen, Membranen zu durchqueren. Dies lässt darauf schließen, dass das kalziumgesteuerte Aktin-Zytoskelett möglicherweise schon in Archaeen vor der Entstehung der Eukaryoten existierte. Neben der Kultivierung von Archaeen zur Untersuchung ihrer Funktionen untersuchen manche Menschen auch direkt „Mikrofossilien“. Sogenannte Mikrofossilien sind mikroskopische Abdrücke früher Zellen in Gesteinen. Susannah Porter, Paläontologin an der University of California in Santa Barbara, glaubt, dass Fossilienstudien auch den Weg der eukaryotischen Evolution aufzeigen könnten. Mit dem Aufkommen der metagenomischen Sequenzierung schienen Fossilien in Ungnade gefallen zu sein, sagt sie, doch viele phylogenetische Bäume beruhen auf einer Methode namens „molekulare Uhr“, bei der Fossilien als Grundlage für den Zeitpunkt der Analyse dienen. Fossilien können auch an sich nützlich sein, indem sie Wissenschaftlern dabei helfen, den Zeitpunkt des ersten Auftretens bestimmter äußerer Merkmale zu bestimmen. Die von Porter untersuchten Proben könnten dabei helfen, die Abfolge der Ereignisse in der frühen eukaryotischen Evolution zu bestimmen. „Wir verfügen über Fossilien aus den letzten zwei bis einer Milliarde Jahren, und sie werden nicht vollständig genutzt. Vielleicht können wir diese Merkmale der Fossilien nutzen, um die Ursprünge eukaryotischer Zellen zu rekonstruieren.“ Kurz gesagt: Obwohl Genomik und Molekularbiologie inzwischen ein gewisses Niveau erreicht haben, spielen traditionelle Fossilienfunde noch immer eine wichtige Rolle bei der Erforschung der mikrobiellen Evolution und des eukaryotischen Ursprungs. 750 Millionen Jahre altes Mikrofossil Valeria lophostriata MIT FREUNDLICHER GENEHMIGUNG VON SUSSANAH PORTER Um zu vermeiden, dass „ein einzelnes Beweisstück nicht ausreicht, um die Beweise zu stützen“, suchen Wissenschaftler auch nach anderen Beweisen, die die fossilen Beweise stützen. So hat beispielsweise Berend Snel, ein Computerbiologe an der Universität Utrecht in den Niederlanden, vor kurzem für seine Forschung eine Methode namens „Genduplikation“ eingesetzt. Dieser Ansatz geht davon aus, dass die Länge einzelner Zweige eines phylogenetischen Baums mit ihrer Entwicklungszeit zusammenhängt. Allerdings war die Methode so umstritten, dass sogar Snel selbst zugeben musste, dass sie möglicherweise Mängel aufweist. Snel sagte jedoch auch, dass die Evolution ein kontinuierlicher Prozess sei und dass den Menschen nur dann die wahre und vollständige Evolutionskarte präsentiert werde, wenn die Menschen die kleinen Fragmente dieses langen Prozesses miteinander verknüpften. Auch Michelle Leger stimmt zu, dass das Verständnis des Menschen vom eukaryotischen Ursprung in diesem Stadium noch dem Verständnis eines Babys von der Welt entspricht. „Es liegt in der Natur dieser tiefgreifenden evolutionären Fragen, dass wir es nie wissen und nie einen endgültigen Beweis für unsere Hypothese haben werden, aber das hält uns nicht davon ab, unsere Ideen weiter zu verfeinern. Alternativhypothese: Viren sind die Vorfahren Über den Ursprung des Zellkerns gibt es viele Spekulationen. Eine Hypothese besagt, dass der Zellkern moderner Eukaryoten aus einer Partnerschaft zwischen einem prokaryotischen Wirt und einem Virus entstanden sein könnte. In den frühen 2000er Jahren stellte der Molekularbiologe Masaharu Takemura von der medizinischen Fakultät der Universität Nagoya in Japan fest, dass die DNA-Polymerasen einer Gruppe von Viren (Pockenviren) denen von Eukaryoten sehr ähnlich waren und dass sich Pockenviren in Wirtszellen replizieren, indem sie „isolierte Kompartimente“ bilden. Philip Bell, Leiter für Forschung und Entwicklung beim Biotechnologieunternehmen MicroBioGen, war unterdessen ähnlich verwirrt über die Unterschiede zwischen Eukaryoten und Bakterien. Beispielsweise sind eukaryotische Chromosomen linear, während bakterielle Chromosomen kreisförmig sind. Viele Merkmale des Zellkerns sprechen nicht für einen bakteriellen Ursprung. Beide Forscher veröffentlichten ihre Arbeiten etwa zeitgleich im Jahr 2001. Nachdem sie vom Asgard-Supersystem und seinen Forschungsergebnissen erfahren hatten, aktualisierten die beiden Forschungsgruppen ihre Hypothesen zum Ursprung des Virus. Seitdem haben Forscher Riesenviren identifiziert, die erstmals 2003 entdeckt wurden. Sie sind viel größer als die meisten Viren und verfügen über Genome, die groß genug sind, um Gene zu enthalten, die mit verschiedenen Stoffwechselprozessen in Zusammenhang stehen. Nun vermuten Masaharu Takemura, Philip Bell und andere, dass dieser Riesenvirus der ursprüngliche Zellkern gewesen sein könnte. Riesenviren replizieren sich in komplexen Kompartimenten, die modernen Zellkernen sehr ähnlich sehen. Sie sind beide groß, beide enthalten innere und äußere Membranen und beide tragen Gene, die Proteine kodieren, die die Wirtszelle zum Funktionieren benötigt. Allerdings war die Vorstellung, dass der Zellkern von einem Virus stammen könnte, schwer zu vermitteln. Es mangelt an strukturellen Beweisen und der Unterstützung durch vorhandene Daten. Valerie De Anda, eine Mikrobiologin, die den Stoffwechsel früher Prokaryoten erforscht, lässt sich jedoch vom derzeitigen Mangel an Beweisen zur Unterstützung der „Virushypothese“ nicht abschrecken. Sie und ihre Kollegen suchen derzeit nach mRNA-Capping-Genen, die an der Transkription und Translation beteiligt sind. Sie glauben, dass die Gene von einem lange zurückliegenden „Vorfahren des ersten eukaryotischen Zellkerns“ stammen. Valerie De Anda ist etwas frustriert, wenn sie darüber spricht, dass ihre Theorie von der wissenschaftlichen Gemeinschaft nicht allgemein akzeptiert wird. Dies erinnerte sie an ein altes chinesisches Gedicht, das ihr ihr Lehrer in der Schule beigebracht hatte: Seit meiner Kindheit bin ich im hohen Gras. Jetzt spüre ich, wie allmählich das Unkraut sprießt; Den hoch aufragenden Baum kannten die Menschen damals noch nicht. Erst wenn Sie den Himmel erreichen, erkennen Sie, wie hoch Sie sind. Verweise [1] Shiratori, T., Suzuki, S., Kakizawa, Y. et al. Phagozytoseähnliche Zellaufnahme durch ein Planctomyceten-Bakterium. Nat Commun 10, 5529 (2019). https://doi.org/10.1038/s41467-019-13499-2 [2] Martin William F., Garg Sriram und Zimorski Verena (2015) Endosymbiotische Theorien zum Ursprung von EukaryotenPhil. Übers. R. Soc. B3702014033020140330 http://doi.org/10.1098/rstb.2014.0330 [3] Moreira, D., López-García, P. Symbiose zwischen methanogenen Archaeen und δ-Proteobakterien als Ursprung der Eukaryoten: Die syntrophe Hypothese. J Mol Evol 47, 517–530 (1998). https://doi.org/10.1007/PL00006408 [4] Caforio, Antonella et al. „Umwandlung von Escherichia coli in ein Archaebakterium mit einer hybriden heterochiralen Membran.“ Proceedings der National Academy of Sciences der Vereinigten Staaten von Amerika, Bd. 115,14 (2018): 3704-3709. doi:10.1073/pnas.1721604115 [5] Vosseberg, J., van Hooff, JJE, Marcet-Houben, M. et al. Zeitliche Abgrenzung des Ursprungs der eukaryotischen Zellkomplexität anhand früherer Duplikationen. Nat Ecol Evol 5, 92–100 (2021). https://doi.org/10.1038/s41559-020-01320-z [6] Chaikeeratisak, Vorrapon et al. „Zusammenbau einer kernähnlichen Struktur während der Virusreplikation in Bakterien.“ Science (New York, NY) Bd. 355,6321 (2017): 194-197. doi:10.1126/science.aal2130 [7] Mills, Daniel B et al. „Eukaryogenese und Sauerstoff in der Erdgeschichte.“ Naturökologie & Evolution, Bd. 6,5 (2022): 520-532. doi:10.1038/s41559-022-01733-y Die Zusammenstellung dieses Artikels ist autorisiert aus: Dieser Artikel wird vom Science Popularization China Starry Sky Project unterstützt Produziert von: Chinesische Vereinigung für Wissenschaft und Technologie, Abteilung für Wissenschaftspopularisierung Hersteller: China Science and Technology Press Co., Ltd., Beijing Zhongke Xinghe Culture Media Co., Ltd. Besondere Tipps 1. Gehen Sie zur „Featured Column“ unten im Menü des öffentlichen WeChat-Kontos „Fanpu“, um eine Reihe populärwissenschaftlicher Artikel zu verschiedenen Themen zu lesen. 2. „Fanpu“ bietet die Funktion, Artikel nach Monat zu suchen. Folgen Sie dem offiziellen Account und antworten Sie mit der vierstelligen Jahreszahl + Monat, also etwa „1903“, um den Artikelindex für März 2019 zu erhalten, usw. Copyright-Erklärung: Einzelpersonen können diesen Artikel gerne weiterleiten, es ist jedoch keinem Medium und keiner Organisation gestattet, ihn ohne Genehmigung nachzudrucken oder Auszüge daraus zu verwenden. Für eine Nachdruckgenehmigung wenden Sie sich bitte an den Backstage-Bereich des öffentlichen WeChat-Kontos „Fanpu“. |
>>: Schock! Der Prototyp von „Patrick Star“ ist so unbeschreiblich!
Artikel empfehlen
Neuigkeiten zu Elektroautos: Geelys neues Auto Lynk & Co feiert Premiere. Warum konzentrieren sich inländische Autos auf die Förderung hochwertiger Untermarken?
In den letzten zwei Jahren haben inländische Mark...
Um zu verhindern, dass der Vogel "rücksichtslos" wird, tun Sie dies jetzt
Vögel sind die häufigsten „tierischen Nachbarn“ d...
Herzschmerz! Die längste noch existierende Holzbogenbrücke meines Landes fing Feuer. Kann es wieder aufgebaut werden?
Am frühen Morgen des 7. August gab die Presseabte...
Die Geschwindigkeit der Hochgeschwindigkeitszüge übersteigt 300 Kilometer pro Stunde und das Anlegen eines Sicherheitsgurts ist nicht sicher!
Gutachter: Wang Shengwei, leitender Ingenieur, Be...
China Automobile Dealers Association: Eine kurze Analyse des Gebrauchtwagenmarktes im April 2022
Gesamtentwicklung des Gebrauchtwagenmarktes im Ap...
Möchten Sie die „Gesetze der Funktionsweise des Universums“ ausprobieren? Dann musst du einen Bissen von diesem Gemüse nehmen
Der vor einiger Zeit erschienene inländische Film...
China Academy of Information and Communications Technology: Im ersten Quartal 2022 lag die inländische 5G-Zugangs-Downlink-Rate in Shanghai bei 462,93 Mbit/s und belegte damit den ersten Platz
Vor Kurzem hat die China Academy of Information a...
Yoga ist ein guter Weg, um Gewicht zu verlieren
Was soll ich tun, wenn ich eine Topftaille habe? ...
Die Ozeane überqueren und eine Brücke zwischen China und Singapur bauen
Tianjin Eco-City, eine grüne neue Stadt, die aus ...
Das Geheimnis des hohen Energieverbrauchs und des niedrigen Verbrauchs von HoloLens: 24-Kern-HPU
Obwohl es schon seit langer Zeit auf dem Markt ist...
Welche Aerobic-Übungen sind für Frauen geeignet?
Ich glaube, jeder weiß, dass man regelmäßig Sport...
Snowboard-Tipps
Wenn Sie beim Skifahren einige wissenschaftliche ...
Schulterübungen im Fitnessstudio
Normalerweise gehen wir zum Trainieren ins Fitnes...
[Smart Farmers] Ein Bild zum Verständnis: Die „unbeliebte“ invasive gebietsfremde Art: Moskitofisch
[Smart Farmers] Ein Bild zum Verständnis: Die „un...