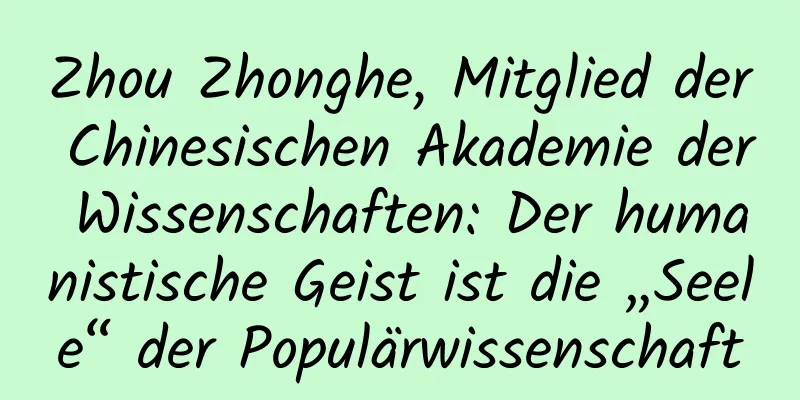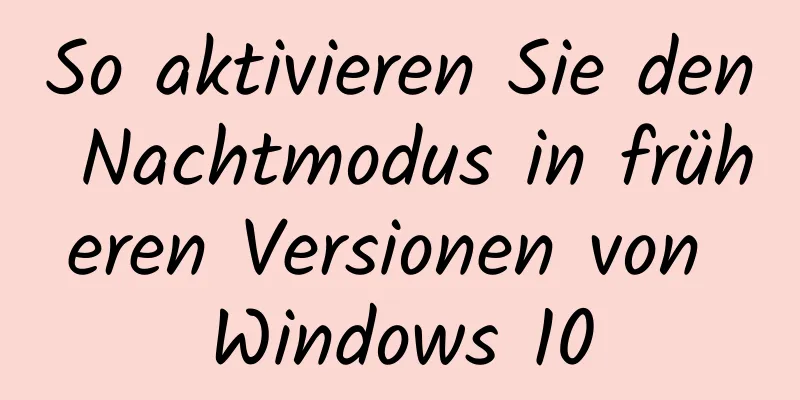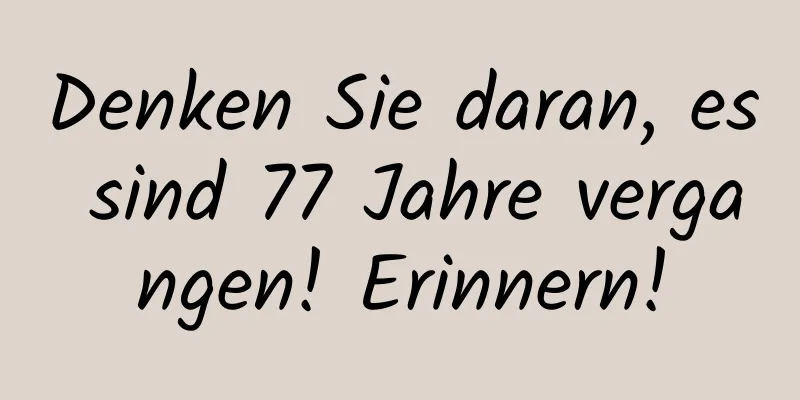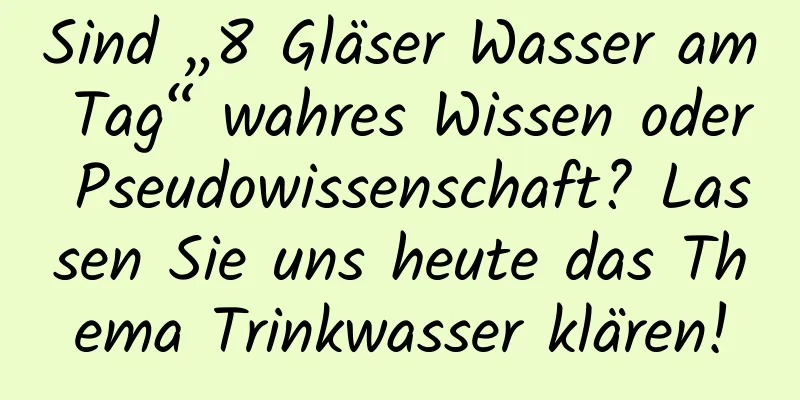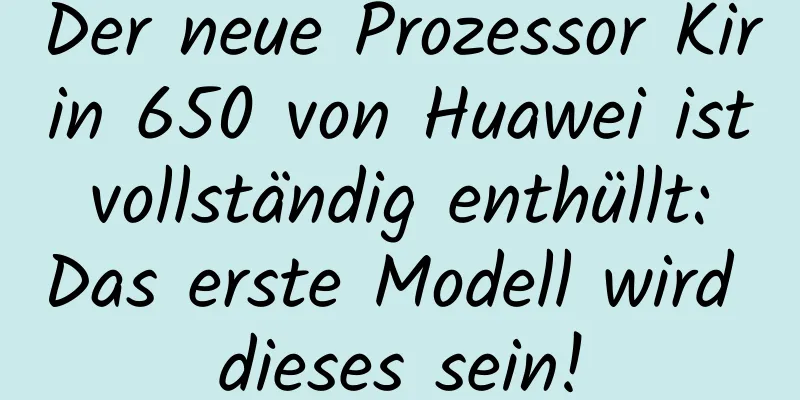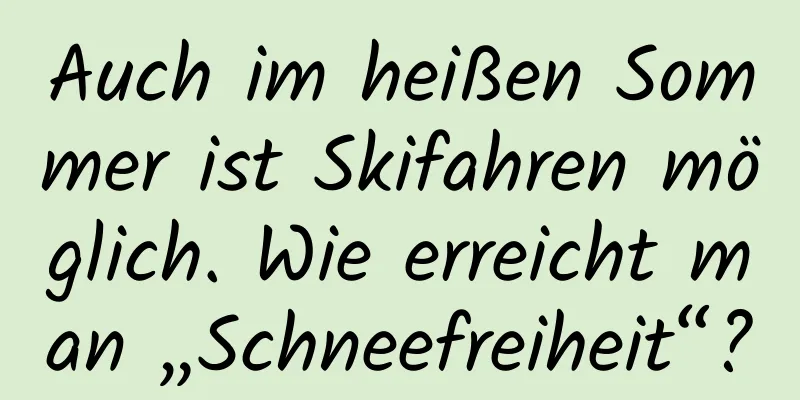Das Geheimnis des Plejaden-Sternhaufens: Der Plejadennebel
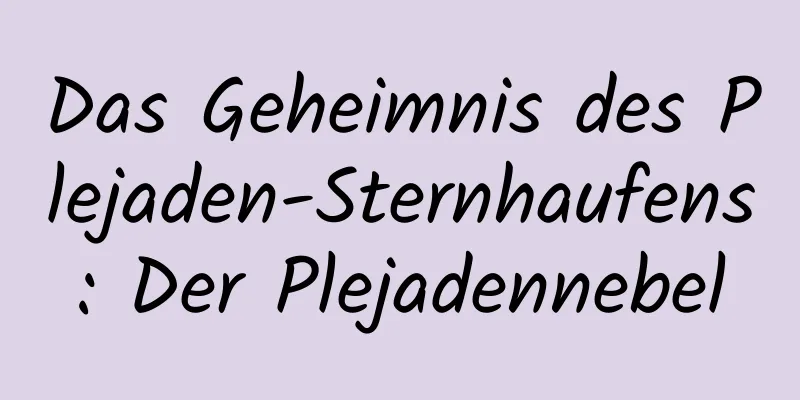
|
Autor | Wang Siliang Rezension | Zheng Chengzhuo Herausgeber | Zhao Jingyuan Die Plejaden, ein heller Sternhaufen, der mit bloßem Auge sichtbar ist, ziehen seit der Antike die Aufmerksamkeit der Menschheit auf sich. Das Geheimnis des Plejadennebels, der im Sternhaufen der Plejaden verborgen ist, wurde jedoch erst im 19. Jahrhundert gelüftet. Lassen Sie uns heute die Geschichte des Plejadennebels (NGC 1435) in der Geschichte der Astronomie erkunden. Sternhaufen der Plejaden. Bildnachweis: ESA Der Plejadennebel wurde erstmals am 19. Oktober 1859 vom deutschen Astronomen Wilhelm Tempel in Venedig, Italien, mit einem 10,5 cm großen Steinheil-Refraktorteleskop entdeckt. Temple dachte zunächst, es handele sich um einen Kometen, doch in der zweiten Nacht seiner Beobachtungen stellte er fest, dass sich die Position des „Kometen“ nicht verändert hatte. Daraus wurde ihm klar, dass es sich nicht um einen Kometen, sondern um einen Nebel handelte, der in der Nähe von Alcyone kreiste. Er legte seine Ergebnisse im Dezember 1860 der Fachzeitschrift „Astronomische Nachrichten“ vor und veröffentlichte sie im folgenden Jahr. Ausführlichere Studien wurden jedoch erst 1862 veröffentlicht. Temples Entdeckung erregte schnell das Interesse anderer Astronomen, löste aber auch Kontroversen aus. Im Jahr 1862 konnte der deutsche Astronom Heinrich d'Arrest den Plejadennebel nicht sehen, als er ihn mit dem 11-Zoll-Merz-Refraktorteleskop am Kopenhagener Observatorium beobachtete. Dies brachte ihn zu der Annahme, dass die Helligkeit des Nebels variabel sein könnte, und er stellte die Hypothese auf, dass es sich möglicherweise um einen „veränderlichen Nebel“ handele. Drests Ansichten wurden teilweise vom deutschen Astronomen Johann Schmidt unterstützt. Allerdings wurde der Nebel auch unabhängig voneinander vom deutschen Astronomen Arthur Auwers und dem französischen Astronomen Jean Chacornac beobachtet und zeigte keine Helligkeitsänderungen. Dies stützt die Ansicht, dass Teleskope mit großer Apertur bei der Beobachtung diffuser Nebel schlecht abschneiden und dass kleinere Teleskope bei geringerer Vergrößerung Nebeldetails leichter erfassen können. Temples Darstellung der Sternwolke der Plejaden. Bildquelle: Referenz 1 Im Laufe der Zeit beteiligten sich immer mehr Astronomen an der Beobachtung der Sternwolke der Plejaden. Im Jahr 1863 beobachtete der britische Astronom Thomas Webb den Nebel mit einem 5,5-Zoll-Clark-Refraktorteleskop und bestätigte damit seine Existenz. Im Jahr 1873 schlug der britische Astronom Charles Grover vor, dass es sich bei den Helligkeitsänderungen von Nebeln möglicherweise um eine Illusion handele, die durch Leistungsunterschiede verschiedener Instrumente verursacht werde. Teleskope mit geringer Vergrößerung und größeren Sichtfeldern können diffuse Nebel deutlicher erkennen, während eine hohe Vergrößerung das Sichtfeld des Teleskops verkleinert, was zu Fehleinschätzungen führen kann. Im März 1874 beobachteten die französischen Astronomen Benjamin Baillaud und Charles André den Plejadennebel mit einem 31,6 cm großen Sécretan-Refraktorteleskop und stellten fest, dass der Nebel zwei „Kerne“ hatte. Der dänische Astronom John Dreyer versuchte mehrmals, den Plejadennebel auf Schloss Birr mit dem 72-Zoll-Teleskop zu beobachten, das damals das größte der Welt war, scheiterte jedoch jedes Mal. Am 10. Dezember 1877 versuchte Dreyer, inspiriert vom irischen Amateurastronomen Lawrence Parsons, es erneut, diesmal verwendete er jedoch ein Okular mit einem größeren Sichtfeld. Schließlich gelang es ihm, und Dreyer hinterließ diesen Bericht: „Zuerst sah ich die Linie zwischen den beiden Sternen, der Hintergrund war offensichtlich blasser als diese Linie; als ich Lawrence Parsons darauf aufmerksam machte, sah er sie auch und konnte eine schwache Grenze erkennen, die einen Winkel von etwa 40° bildete.“ Am 27. Dezember beobachtete Parsons es erneut und schrieb: „Es fiel mir auf den ersten Blick auf, als ich es in die Mitte des Sichtfelds stellte.“ Nebel in der Nähe des Sternhaufens der Plejaden, fotografiert von den Henry-Brüdern im Jahr 1888. Bildquelle: Referenz 1 Die französischen Astronomen Paul Henry und Prosper Henry fotografierten am 16. November 1885 mit einem 33-cm-Teleskop am Pariser Observatorium den Nebel, der die Plejaden umgibt. Am 8. und 9. Dezember folgten zwei weitere Bilder. Die aufgenommenen Bilder zeigten nicht nur deutlich die Nebelstruktur in der Nähe von Alcyone, sondern entdeckten auch einen neuen Nebel – den Alcyone-Nebel. Der Plejadennebel trägt im Neuen Gesamtkatalog der Nebel und Sternhaufen die Nummer NGC 1432. Es handelt sich um den einzigen Nebel im Katalog, der durch Fotografie entdeckt wurde. Es ist etwas bedauerlich, dass die Bilder, die die Henry-Brüder 1885 aufgenommen haben, verloren gegangen sind und wir jetzt nur noch die Bilder sehen können, die sie 1888 aufgenommen haben. Bald darauf sagte der amerikanische Astronom Edward Pickering, er habe diese Nebel am 3. November 1885 fotografiert, doch bis er das Bild der Henry-Brüder bemerkte, dachte er, es handele sich lediglich um Defekte in der Fotoplatte und verpasste so die Entdeckung des Plejadennebels. Am 24. Oktober 1886 machte der britische Amateurastronom Isaac Roberts drei Stunden lang Fotos von den Plejaden. Seine Beobachtungen zeigten, dass fast die gesamten Plejaden von Nebeln umgeben waren. Zwei Monate später machte Roberts ein weiteres Foto, das die Existenz der Nebel bestätigte. Der Sternhaufen der Plejaden, fotografiert von Roberts am 8. Dezember 1888. Bildquelle: Referenz 1 Die Entdeckung und Kontroverse um den Plejadennebel zeigt, wie die Astronomen des 19. Jahrhunderts trotz ihrer begrenzten Instrumentierung auf sorgfältige Beobachtungen und umfangreiche Erfahrungen angewiesen waren, um ihr Verständnis der Natur von Nebeln schrittweise zu vertiefen. Darüber hinaus zeigt sie, wie wichtig der wissenschaftliche Austausch ist. Von Temples Entdeckung bis zur Einführung der Fotografie durch die Henry-Brüder war jeder Schritt von technologischen Innovationen und methodischer Weiterentwicklung begleitet. Diese Kontroversen und Dialoge haben die Entwicklung der Beobachtungstechnologie gefördert und das Verständnis der Menschen für Beobachtungsbedingungen, Instrumentenleistung und andere Aspekte verbessert. Dies zeigt auch, dass die wissenschaftliche Erforschung ein sich entwickelnder Prozess ist, der von ständigem Hinterfragen und Überprüfen begleitet wird und inmitten von Kontroversen zu einer Bereicherung der Erkenntnisse führt. Jede technologische Innovation, jede methodische Verbesserung und jeder Meinungskonflikt ist für die Menschheit eine wichtige Triebkraft, die Geheimnisse des Universums zu erforschen. Verweise 1. Wolfgang Steinicke, Beobachtung und Katalogisierung von Nebeln und Sternhaufen, von Herschel bis Dreyers neuem Gesamtkatalog (2010), S. 535–575. 2. Stephen James O'Meara, Der supergeheime Himmel, Astronomie, https://www.astronomy.com/science/the-super-secret-sky/ Wenn Sie weitere Fragen zum Plejadennebel haben, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht im Kommentarbereich und Xiaoxing wird sie Ihnen nacheinander beantworten~ Folgen Sie dem öffentlichen WeChat-Konto/Sina Weibo/Science Popularization China „Xingming Observatory“ und spazieren Sie mit Xiaoxing durch die Sterne, um Romantik zu ernten~ |
<<: Wie nutzen Luxusreisende soziale Medien?
>>: Es isst nicht einmal Zucker. Wie wählerisch ist dieser Pilz?
Artikel empfehlen
Sind die sogenannten Akupunktur-Massagegeräte sinnvoll?
Wenn Menschen älter werden, treten viele versteck...
Was sind die neuen Ballspiele?
Viele Menschen sind es gewohnt, viele Ballsportar...
Welche Trainingsmethoden gibt es für Grundschüler im Kugelstoßen?
Unter den vielen Wettbewerben ist Kugelstoßen ein...
Das iPhone 6s ist nahezu perfekt, wenn es diese 6 Dinge tut
Ob es nun „iPhone 6s/6s Plus“ oder „iPhone 7/7 Pl...
Wie entstand der größte Vulkan der Welt? Chinesische Wissenschaftler schlagen ein neues Modell zur Entstehung unterseeischer Vulkane vor!
Kürzlich ist Zhang Jinchang, einem Forscher am So...
Chinas neueste Entdeckung mit „Smart Eyes“! Das von der Fakultät für Astronomie der Universität Wuhan geleitete Team hat neue Erfolge in der Schwarzlochforschung erzielt!
Am 1. September veröffentlichte die weltweit führ...
Im Qinling-Gebirge sind wieder braune Große Pandas aufgetaucht. Könnte es sein, dass Verwandte aus Qizis Heimatstadt gekommen sind?
Produziert von: Science Popularization China Auto...
Von der unbekannten zur Starart: Es dauerte nur fünf Jahre, bis der Marderhund in Shanghai berühmt wurde
Von Wildschweinen in Nanjing bis hin zu Wieseln i...
Welche Vorteile hat es, jeden Tag zu schwimmen?
Heutzutage sind die Lebensbedingungen der Mensche...
Es ist nicht schlimmer als eine Kamera. Wie macht man mit einem Mobiltelefon qualitativ hochwertige Fotos?
Im Vergleich zu Spiegelreflexkameras weist die Han...
Wiley: Studie zeigt angeborene biologische Unterschiede zwischen Männern und Frauen, die die Anfälligkeit für Krebs beeinflussen
Warum sind Männer von den meisten Krebsarten häuf...
Alles im Jahr des Hasen! Auf diese berühmten Szenen der chinesischen Wissenschaft und Technologie können wir stolz sein
◎ Sun Yu, Praktikant bei Science and Technology D...
Machen Sie diese gesunden Bewegungen jeden Morgen?
Heute möchte ich Ihnen einige kleine Maßnahmen ze...
Kurze Dramen für Menschen mittleren und höheren Alters werden viral! Fallen unsere Eltern auf das „50-jährige dominante Chef-Süßigkeiten-Drama“ herein?
In den letzten Monaten sind Kurzdramen über Mensc...
Bericht: Verbraucherstimmung in den USA während der Coronavirus-Pandemie
Resonate hat einen neuen Bericht mit dem Titel „U...