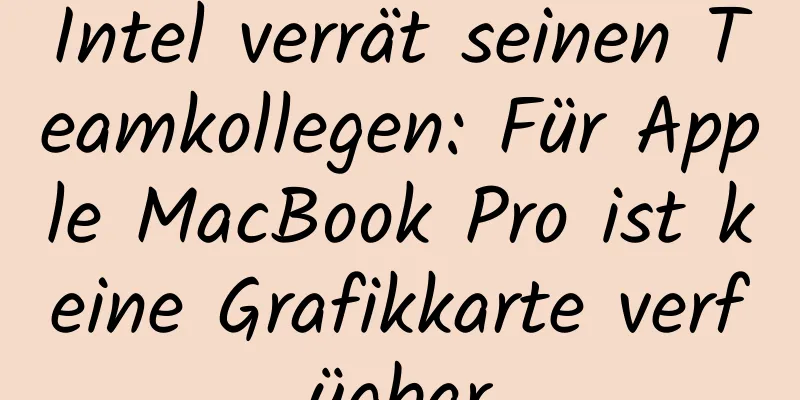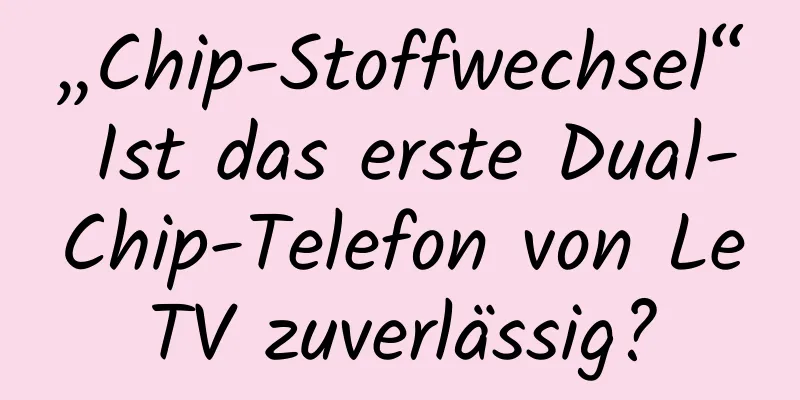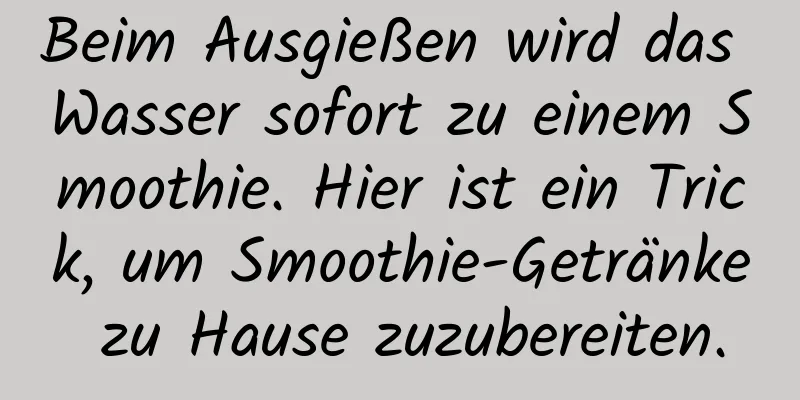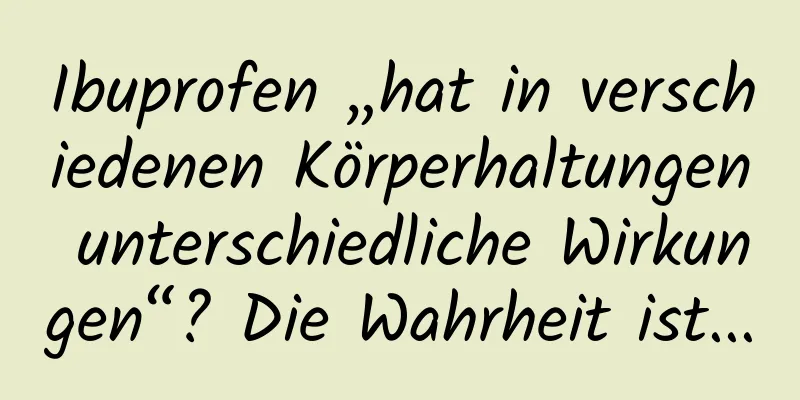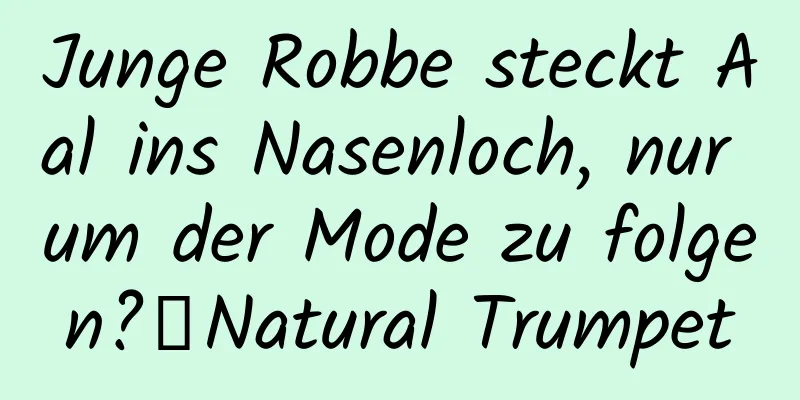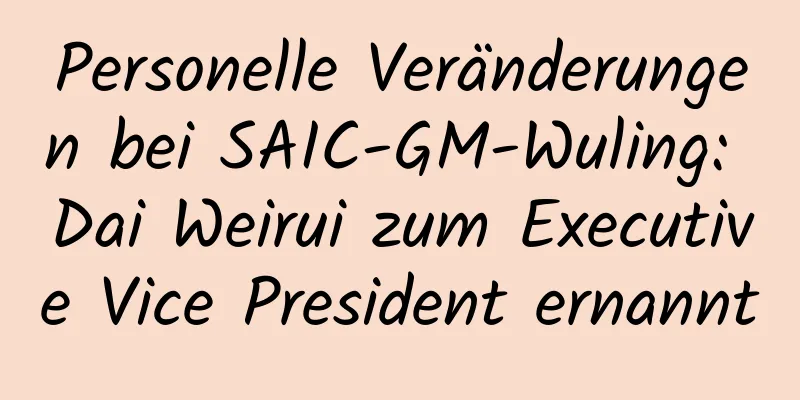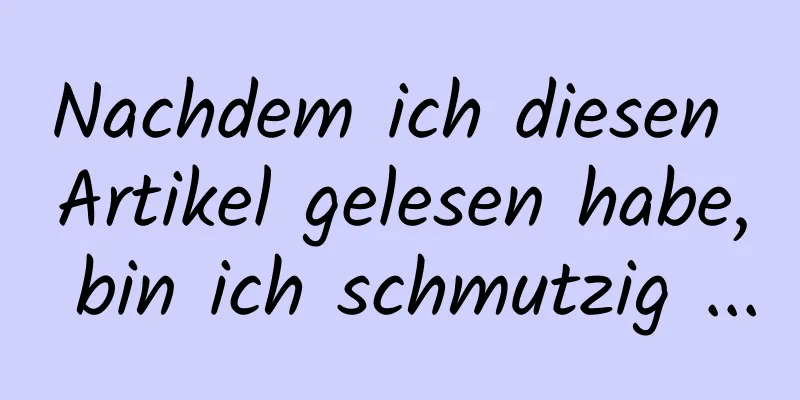In 1 Sekunde sterben im menschlichen Körper 1 Million Zellen! Die Art zu sterben ist anders...
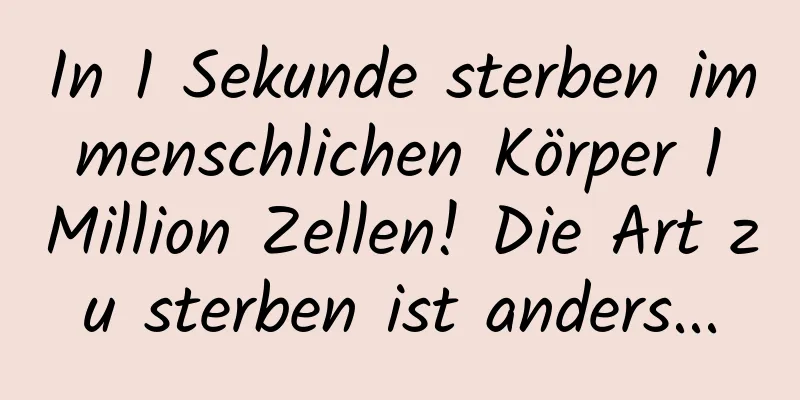
|
Der Tod mag wie ein reiner Verlust erscheinen, aber wenn wir auf die Zellebene hinauszoomen, bekommt der Tod eine andere und differenziertere Bedeutung. Allein die Definition dessen, was eine Zelle „lebendig“ oder „tot“ macht, ist eine Herausforderung. Heute arbeiten Wissenschaftler daran, die verschiedenen Wege und Gründe für das Verschwinden von Zellen zu verstehen und welche Bedeutung diese Prozesse für biologische Systeme haben. Der Zellbiologe Shai Shaham diskutiert mit Podcast-Moderator Steven Strogatz die verschiedenen Formen des Zelltods, ihre Rolle in der Evolution und bei Krankheiten und warum die richtige Art und das richtige Muster des Zelltods für unsere Entwicklung und Gesundheit so wichtig sind. In dieser Sekunde, in der Sie dieses Programm streamen, sterben eine Million Zellen in Ihrem Körper. Einige dieser Zellen sind so programmiert, dass sie durch natürlich regulierte Prozesse wie Apoptose absterben . Einige Zellen beenden nach einer Infektion aktiv ihr Leben, um die weitere Ausbreitung der Virusinvasion zu verhindern. und einige Zellen erleiden aufgrund physikalischer Schäden eine Nekrose , was zum Reißen der Zellmembran und zum Austreten des Inhalts führt. Wir wissen, dass es fast ein Dutzend verschiedene Arten des Zelltods gibt. Und wenn Patienten lernen, diese Prozesse zu kontrollieren, kann das einen gewaltigen Unterschied machen. Apoptose von Präadipozyten der Maus. © wikimedia Strogatz: Ich bin sehr neugierig, mehr über den Zelltod zu erfahren. Also dachte ich, wir könnten vielleicht mit dem Leben der Zelle beginnen. Anhand welcher Merkmale einer Zelle können wir erkennen, dass sie lebt? Shaham: Diese Frage ist eigentlich ziemlich kompliziert. Es hängt wirklich davon ab, welche Kriterien oder Tests Sie verwenden, um zu bestimmen, ob eine Zelle lebendig oder tot ist. Wenn sich eine Zelle beispielsweise bewegt, könnten wir sagen, dass sie lebt. Wenn die Zellen jedoch bewegungslos sind, muss man sich fragen: Was bedeutet es, am Leben zu sein? Verstoffwechselt es Nahrung? Oder sendet es Signale an andere Zellen? Andere wiederum glauben, dass eine solche Aktivität auch in Zellen auftreten kann, die chemisch aktiv sind, aber keine biologische Funktion erfüllen. Auf dem Gebiet der Zelltodforschung ist die Frage, wie „tote Zellen“ definiert werden sollen, ein Problem, das uns schon lange beschäftigt. Und ich stimme zumindest der Definition am meisten zu: Wenn eine Zelle vollständig verschwindet, ist sie tot. Darüber hinaus ist es schwer zu beurteilen. SB: Es ist interessant, dass diese Frage so subtil ist. Viele Menschen glauben, dass Zellen durch Teilung am Leben bleiben. Ich habe mich gefragt, ob die Zellteilung ein Schlüsselmerkmal des Lebens ist. Müssen sich Zellen teilen, um als lebendig zu gelten? SHA: Wenn sich eine Zelle teilt, ist sie offensichtlich lebendig. Die Frage ist jedoch: Wenn es sich nicht spaltet, ist es dann zwangsläufig tot? Die Antwort hierauf hängt wiederum von der jeweiligen Situation ab. Beispielsweise können manche Bakteriensporen jahrelang ohne Teilung auskommen, doch wenn die Zeit reif ist, erwachen sie aus ihrem Sporenzustand und beginnen erneut, sich zu teilen und zu vermehren. Ist die Zelle also während dieses Zeitraums, der Jahrzehnte dauern kann, tot oder lebendig? © Heiti Paves/SPL/Science Source Hier ist ein Beispiel, das mir sehr gefällt, weil unser Labor C. elegans untersucht. Kürzlich wurde ein Fadenwurm aus dem sibirischen Permafrostboden geborgen, der vor etwa 40.000 Jahren eingefroren und anschließend im Labor wiederbelebt wurde [1]. Man kann also nicht anders, als sich zu fragen: War dieses Geschöpf während dieser 40.000 Jahre tot oder lebendig? SB: Unglaublich! Das ist so interessant. In unserer Alltagssprache gibt es ein Konzept namens „Scheintod“. Die von Ihnen erwähnten Sporen scheinen, um es in Laiensprache auszudrücken, darauf zu warten, „wiederbelebt“ zu werden. Doch was ist ihre Natur, während sie sich in diesem Zustand der Schwebetotheit befinden? Dies wirft die Frage der Irreversibilität auf. Sha: Ja, das Problem, über das Sie sich jetzt Sorgen machen, ist auch in unserem Bereich schon lange ein Problem. Letztendlich kommt es auf die Messmethode an. Nehmen wir beispielsweise an, dass eine Spore 100 Jahre wartet, bevor sie sich teilt. Wenn man es in seinem 30. Jahr betrachten und seine Aktivität einige Wochen lang beobachten würde, wäre es nach allen Maßstäben tot. Erst wenn es 100 Jahre später wieder zum Leben erweckt wird, werden Sie sagen: Ah, es hat gelebt. Wenn wir jedoch die Kriterien ändern und seine Stoffwechselaktivität, die Ansammlung von Mutationen in seinem Genom oder die Signale, die es an andere Zellen sendet, messen, würden Sie es als lebendig betrachten, solange es in Ihrem Test „Aktivität“ zeigt. Dies ist jedoch nur eine operative Definition. Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, in diese Angelegenheit ein mystisches Element einzubringen. S: Sie machen sehr deutlich, dass wir einige operationale Definitionen verwenden können, um zu bestimmen, ob eine Zelle lebt oder nicht. Diese Methode ist relativ objektiv, sie kann beispielsweise erkennen, ob es sich um einen Stoffwechsel oder eine Teilung handelt. Um Leben und Tod besser zu definieren, möchte ich einige neue Perspektiven einführen, beispielsweise bestimmte Teile der Zelle. Kann ein Teil einer Zelle sterben? Oder muss der Tod in der gesamten Zelle stattfinden? Sand: Natürlich. Wenn Sie sich an meine früheren Ausführungen erinnern, lautet meine bevorzugte Definition von „toten Zellen“, dass eine Zelle tot ist, wenn sie vollständig verschwindet. Es gibt jedoch Fälle, in denen Teile von Zellen verschwinden. Dies kann ein Verfahrensereignis (ein normaler biologischer Prozess) sein oder durch eine Verletzung oder einen anderen Unfall verursacht werden. © Cell Press Während der Entwicklung von Tieren beispielsweise erstrecken sich von den Neuronen Nervenzellen, sogenannte Axone. Axone sind lange, dünne Fortsätze, die von Neuronen ausgehen und sich mit anderen Neuronen verbinden, um die ordnungsgemäße Funktion des Gehirns aufrechtzuerhalten. Während der normalen Entwicklung können einige Axone beginnen, sich zurückzuziehen, ein Phänomen, das als „Absterben“ bekannt ist [2]. Funktionell gesehen hatten die zurückgezogenen Axone ihre Funktion verloren und verschwanden tatsächlich. Man könnte also sagen, dass ein Teil der Zelle „stirbt“. SB: Sie haben also den programmierten Zelltod erwähnt, ein Thema, über das ich als nächstes sprechen wollte. Ich habe von einer Form des Zelltods namens „Nekrose“ gelesen. Was passiert, wenn eine Zelle stirbt? SHA: Lassen Sie mich hier zwischen zwei verschiedenen Arten des Zelltods unterscheiden. Eine Art des Zelltods wird durch ein genetisches Programm bestimmt, das aus einer Reihe spezifischer Gene in der DNA der Zelle besteht, die speziell dafür entwickelt wurden, die Zelle in Richtung Tod zu steuern. Dieser Prozess wird durch die Evolution ausgewählt und an nachfolgende Zellgenerationen weitergegeben, um der Zelle die Selbstvernichtung zu ermöglichen. Eine andere Todesart ähnelt dem, was passiert, wenn man auf eine Zelle tritt. Es gibt unzählige unnatürliche Arten, wie Zellen geschädigt werden können, und Nekrose ist eine davon. Der Begriff „Nekrose“ ist vage definiert, wird aber im Allgemeinen als eine unkontrollierte Form des Zelltods beschrieben , die nicht unter genetischer Kontrolle steht und sich typischerweise als Zellschwellung, abnormale Bildung von Zellmembranen und schließlich als Austreten von Zellinhalt in die Umgebung äußert. SB: Ich nehme an, das löst eine Reaktion im Immunsystem aus? Sand: Ja, grundsätzlich besteht der Unterschied zwischen genetisch programmiertem Zelltod und durch äußere Einflüsse verursachtem Zelltod darin, dass ersterer sehr „sauber“ angelegt ist, um beim Absterben die Umgebung möglichst wenig zu stören. Tatsächlich unternimmt der Sterbeprozess alles, um die Schädigung der umliegenden Zellen so gering wie möglich zu halten. Die andere Todesart löst jedoch typischerweise eine starke Reaktion sowohl von benachbarten Zellen als auch – sofern das Tier über ein Immunsystem verfügt – von Immunzellen aus, die ebenfalls versuchen, mit dem Schaden fertig zu werden, den die platzende Zelle in ihrer Umgebung angerichtet hat. S: Ich habe vorhin das Wort „Apoptose“ erwähnt, also diese relativ „saubere“ Art des programmierten Todes. Habe ich recht? Ist es das, worüber wir jetzt sprechen? Sha: Ich würde sagen, dass Leute, die dieses Gebiet erforschen, den programmierten Zelltod oft mit Apoptose gleichsetzen, aber das ist eigentlich nicht ganz richtig. Apoptose ist nur eine Form des programmierten Zelltods. Unser eigenes Labor entdeckte eine andere Art des Zelltods, den sogenannten „Linker-Zell-Typ-Tod“ (LCD)[3]. Es gibt außerdem mindestens eine weitere mir bekannte Form des Zelltods, die meine Kollegen an Fruchtfliegen untersucht haben. Es gibt also drei echte genetisch programmierte Zelltodwege, die uns derzeit bekannt sind. SB: Können Sie beschreiben, wie sie für uns aussehen? Wie müssen wir uns vorstellen, wenn eine Zelle eine dieser drei Todesarten erleidet? Sand: Der Begriff Apoptose wurde erstmals Anfang der 1970er Jahre von John F. R. Cole und Andrew Wylie in einem Artikel geprägt (das Wort stammt aus dem Griechischen und bedeutet „von einem Baum fallende Blätter“, was den Sterbeprozess beschreibt). Es ist durch die Kondensation der DNA oder des Chromatins im Zellkern gekennzeichnet, die so kompakt werden, dass sie ihre Funktion nicht mehr erfüllen können. Darüber hinaus schrumpft das Zytoplasma, das den Hauptteil der Zelle ausmacht. Oftmals zerfallen Organellen wie Mitochondrien im Zytoplasma, dies geschieht jedoch meist erst spät im Sterbeprozess. Insgesamt verlief der Vorgang sehr schnell. Erst wenn man dasitzt und die Zahl der Zellen zählt, die diesen Prozess durchlaufen, wird einem bewusst, wie häufig diese Art des Sterbens vorkommt. © Universität Kyoto Es handelt sich also um einen sehr kompakten Abbauprozess, bei dem die Zellen gereinigt werden. Auf der Oberfläche dieser sterbenden Zellen erscheinen spezielle Signale, sogenannte „Friss-mich“-Signale, die benachbarten Zellen oder professionellen Phagozyten signalisieren, zu kommen, die toten Zellen zu verschlingen und abzubauen. Der programmierte Zelltod verläuft in den meisten Fällen über diesen Weg, und die Apoptose weist die gerade erwähnten Merkmale auf. Der Zelltod der Verbindungszellen ist in gewissem Maße fast ein „Spiegelbild“ der Apoptose. Während dieses Sterbeprozesses kommt es selten zu einer Chromatinkondensation. Tatsächlich ist das Kennzeichen dieses Zelltods sehr lockeres Chromatin. Darüber hinaus neigen Organellen dazu, von Anfang an anzuschwellen, anstatt Defekte erst spät im Sterbeprozess zu zeigen, wie dies bei der Apoptose der Fall ist. Wichtig ist jedoch, dass diese sterbenden Zellen auf ihrer Oberfläche immer noch „Friss mich“-Signale anzeigen und immer noch von benachbarten Zellen oder professionellen Phagozyten beseitigt und abgebaut werden. BS: Ich bin sehr an dieser zweiten Art des Zelltods interessiert. Erstens hatte ich noch nie davon gehört und zweitens befasste sich meine erste wissenschaftliche Arbeit in meiner Karriere mit der mathematischen Modellierung der Chromatinfaserstruktur. Wenn Sie also „Linker“ erwähnen, meinen Sie die verbindende DNA zwischen Nukleosomen? Sand: Eigentlich nicht. Wir haben diesen Zelltod beim Fadenwurm Caenorhabditis elegans entdeckt. Dies geschieht, wenn eine einzelne Zelle im männlichen Fadenwurm stirbt, die sogenannte Linkerzelle. Sie wird als „Verbindungszelle“ bezeichnet, da sie die sich entwickelnde männliche Keimdrüse mit dem Spermienfreisetzungsweg verbindet. Diese Zelle fungiert als „Pfropf“ zwischen dem Fortpflanzungskanal und dem Austrittskanal. Die Tiere eliminieren es durch dieses neue Todesprogramm vom Typ Linker-Zellen, wodurch die beiden Kanäle miteinander verschmelzen und Spermien freigesetzt werden können. © Cell Press Mithilfe der Elektronenmikroskopie konnten wir beobachten, dass dieses Zeichen des Zelltods nicht auf diese Zelle in C. elegans beschränkt war, sondern auch während der Entwicklung bei Säugetieren und Menschen häufig auftrat. Tatsächlich weist ein Großteil der Zelltode in unserem Nervensystem diese Eigenschaft auf. Darüber hinaus gibt es noch ein weiteres bemerkenswertes Merkmal des Zelltods von Linkerzellen: Die Kernmembran weist Vertiefungen auf, die wir „Zinnen“ nennen, und hat ein welliges Aussehen. Es ist außerdem ein Kennzeichen des Zelltods bei vielen menschlichen Erkrankungen. Wir sind sehr gespannt, ob der Tod von Linkerzellen bei bestimmten menschlichen Erkrankungen eine Rolle spielt, beispielsweise bei pathologischen Zuständen, bei denen diese Art des Zelltods fälschlicherweise aktiviert wird. SB: Ich möchte auf die Beziehung zwischen Zelltod und menschlichen Krankheiten zurückkommen. Wenn ich darf, möchte ich nun auf verschiedene Zelltodwege eingehen, die mit Abwehrfunktionen in Zusammenhang stehen, etwa wenn Zellen als Reaktion auf einen Angriff durch ein Virus oder einen anderen Krankheitserreger sterben. SHA: Viele dieser Zustände haben viel mit Apoptose gemeinsam und ihre Namen basieren oft auf dem spezifischen Kontext. Pyroptose ist beispielsweise eine Art apoptotischen Zelltods, der als Reaktion auf eine Entzündung auftritt. Das Wort „Pyro“ bezieht sich auf ein Konzept im Zusammenhang mit Entzündungen oder diesem „heißen“ Zustand. Neutrophile verschlingen Anthrax-Bakterien (orange). © Cell Press Das Grundprinzip besteht darin, dass eine Zelle, wenn sie mit einem Virus oder Bakterium infiziert ist, zum Vorteil des Wirtsorganismus die Selbstzerstörung beschließt, um zu verhindern, dass sich das Virus oder Bakterium im Körper ausbreitet. Neben dem apoptotischen Zelltod gibt es viele Wege, die auf infizierte Zellen abzielen. Beispielsweise setzen zytotoxische T-Zellen Proteine namens Perforine frei, nachdem sie virusinfizierte Zellen erkannt haben . Wie der Name schon sagt, stanzen diese Proteine Löcher in die Membranen der Zielzellen und lösen dadurch Apoptose aus oder führen zum Austreten des Zellinhalts, was schließlich zum Zerfall der Zelle und ihrer Beseitigung durch zirkulierende Phagozyten führt. Eine ähnliche Situation tritt beim Komplement-vermittelten Zelltod auf, einer weiteren Reaktion des Körpers auf von Krankheitserregern befallene Zellen. Normalerweise handelt es sich dabei um eine sehr komplexe Proteinkaskade, die darin gipfelt, dass die infizierte Zelle mit einem Protein bedeckt wird, das als „Iss mich“-Markierung fungiert. Im Unterschied zu den anderen Beispielen wird hier nicht die Zelle selbst von innen heraus zerstört, sondern sie wird als „schädlich“ markiert, um von Fresszellen entfernt zu werden. SS: Mein Eindruck aus diesen Diskussionen ist, dass Zellen im „Gemeinwohl“ handeln, wenn sie diese Programme ausführen oder sich das Etikett „Friss mich“ aufdrücken lassen. Dies soll umliegende Zellen oder Gewebe unterstützen. Dies scheint ein Phänomen zu sein, das nur bei mehrzelligen Organismen auftritt. Wenn es sich um einen einzelligen Organismus handeln würde, hätte er möglicherweise nicht die Motivation, diese Dinge zu tun. Diese Prozesse finden im Kontext mehrzelliger Organismen statt. Habe ich das richtig verstanden? Sand: Deine Idee ist grundsätzlich richtig, ich würde sie aber nicht auf mehrzellige Organismen beschränken. Dieses Prinzip gilt immer dann, wenn sich eine Zellpopulation in einer Umgebung befindet, in der sie zum Überleben voneinander abhängig ist. In mehrzelligen Organismen müssen einzelne Zellen dem Prinzip folgen: „Ich muss möglicherweise Opfer für das Wohl der Gruppe bringen“, aber das Gleiche gilt auch für Bakterien. Beispielsweise neigen Bakterien dazu, sogenannte Biofilme zu bilden, bei denen viele Bakterien in Schichten angeordnet sind. Unter Hungerbedingungen, wenn der Biofilm nicht genügend Nahrung bereitstellen kann, entscheiden sich einige Bakterien für die Selbstzerstörung, um anderen überlebenden Bakterien Nährstoffe bereitzustellen. Dieses Prinzip gilt für alle Zellverbände, sowohl innerhalb eines einzelnen mehrzelligen Organismus als auch in einer größeren mehrzelligen Umgebung. SS: Wir können „Mehrzelligkeit“ also in einem weiten Sinne betrachten, der nicht unbedingt auf einen einzelnen mehrzelligen Organismus beschränkt ist, sondern alle Formen mehrzelligen Lebens einschließt. Sand: Wichtige Beispiele für dieses Prinzip finden wir im Zusammenhang mit Tieren. Beispielsweise spielt in einer Ameisenkolonie, die im Wesentlichen als „Superorganismus“ beschrieben wird, jede Ameise eine wichtige Rolle in der Kolonie. Oft müssen sich Ameisen opfern, um Strukturen zu schaffen, die für das Überleben der Kolonie lebenswichtig sind, oder sogar um Nahrung bereitzustellen. © The Conversation Auf YouTube oder bei National Geographic finden Sie einige erstaunliche Videos, in denen Ameisen gezeigt werden, die Brücken bauen, damit andere Ameisen hindurchkommen können. Ameisen, die als Brücken dienen, sterben oft und ihre Exoskelette werden Teil der Brücke, sodass andere Ameisen laufen können. Solche Beispiele einzelner Tiere, die sich zum Wohle des Ganzen opfern, sind weit verbreitet. SB: Das ist interessant. Ich wollte Sie auch fragen, weil Sie C. elegans erwähnt haben. Dieser kleine Wurm, der nur etwa einen Millimeter lang ist, hat uns in allen Bereichen der Biologie viel gelehrt, einschließlich Entwicklung, Genetik, Verhalten, Neurobiologie und Alterung. Wir haben unglaublich viel von diesem kleinen Geschöpf gelernt. Könnten Sie für diejenigen unter uns, die damit nicht vertraut sind, C. elegans kurz vorstellen und erklären, wie es uns hilft, den Zelltodprozess zu verstehen und warum er wichtig ist? Sand: Natürlich. Wenn Sie den Zelltod untersuchen möchten, ist es hilfreich zu wissen, dass Zellen an einem bestimmten Ort zu einem bestimmten Zeitpunkt sterben. Denn diese Vorhersehbarkeit ermöglicht es, das System im Vorfeld zu manipulieren und alle möglichen Fragen zu stellen. In den meisten Modellsystemen ist diese Vorhersagbarkeit nicht gegeben. Bei Fadenwürmern, insbesondere bei C. elegans, ist dies jedoch möglich. Eine bemerkenswerte Eigenschaft des Fadenwurms Caenorhabditis elegans besteht darin, dass das Muster der Zellteilung von befruchteten Eiern bis hin zu erwachsenen Tieren bei Individuen derselben Population mit nur wenigen Ausnahmen nahezu identisch ist. Gleichzeitig war das Zelltodmuster genau dasselbe. Wir demonstrieren die Konsistenz dieses Musters, indem wir die Zellen des Fadenwurms C. elegans benennen. Wir könnten sagen, diese Zelle heißt „Moi“ und jene heißt „Coli“ (natürlich geben wir ihnen eigentlich viel langweiligere Namen, wie ASE, NSM oder CEP-Hülle). Bei uns oder anderen Wirbeltieren hingegen ist es nicht möglich, eine Zelle zu benennen und in jedem Individuum dieselbe Zelle zu finden. Wir können mit Sicherheit sagen, dass eine Zelle namens „Coley“ 4 Stunden und 20 Minuten, nachdem die befruchtete Eizelle mit der Teilung beginnt, stirbt und der Sterbeprozess 25 Minuten dauert. Diese Details wurden in den späten 1970er und frühen 1980er Jahren von zwei prominenten Wissenschaftlern, Bob Horvitz und John Sulston, ermittelt.[4] Sie kartierten das komplette Zellteilungsmuster von der befruchteten Eizelle bis zum erwachsenen Tier. Als sie diese Teilungen beobachteten, bemerkten sie, dass einige Zellen schließlich verschwanden. Dies waren die Zellen, die starben. © Carolina Biological So wissen wir beispielsweise, dass bei der Entwicklung eines C. elegans-Hermaphroditen 1090 Somiten erzeugt werden, von denen 131 absterben, so dass am Ende insgesamt 959 Somiten übrig bleiben. Mit dieser Präzision können wir alle möglichen genetischen und zellbiologischen Studien durchführen und dabei immer wieder dieselben Zellen untersuchen, um zu verstehen, was den Zelltod verursacht. Ich denke, das ist der größte Vorteil bei der Verwendung von C. elegans zur Erforschung des Zelltods. SB: Wenn also jemand neugierig ist, ist es nicht so schwer, ihn zu fangen, oder? Es ist so, als ob Sie eine Handvoll Erde nehmen würden und darin eine Menge dieser Caenorhabditis elegans wären? Sand: Der Fadenwurm Caenorhabditis elegans ist weltweit weit verbreitet. Als ich meine Arbeit im Labor der Rockefeller University aufnahm, bestand eine meiner ersten Ideen darin, zu versuchen, eine „Rockefeller-Version“ von C. elegans zu finden. Ich ging nach draußen, holte einige Bodenproben, legte sie auf Petrischalen mit Agar (so züchten wir Fadenwürmer) und wartete, bis sie aufkrochen. Und tatsächlich, wir haben sie gefunden. Ich war sehr aufgeregt, die „Rockefeller-Version“ der Fadenwürmer gefunden zu haben, aber später stellte ich fest, dass die Erde an der Rockefeller University tatsächlich aus dem Norden des Staates New York importiert worden war. Bei diesen Nematoden handelt es sich also nicht wirklich um „einheimische Nematoden“, sondern sie stammen aus dem Norden des Staates New York. S: Haha, es ist, als ob die „Landnematoden“ in die „Stadt“ gezogen wären. Die Geschichte, die Sie gerade erzählt haben, ist sehr faszinierend. Der Entwicklungsprozess von C. elegans von der befruchteten Eizelle bis zum erwachsenen Tier verläuft so präzise wie eine Maschine. Sie erwähnen, dass dieses Phänomen bei Menschen oder anderen komplexen Organismen nicht so vorhersehbar ist. Einige von Ihnen fragen sich sicher: Ist dieser spezielle Fadenwurm in der gesamten biologischen Welt einzigartig? Bitte überzeugen Sie uns, dass es für uns tatsächlich Sinn macht, diesen seltsamen Fadenwurm zu studieren. Sandy: Zunächst einmal muss ich sagen, dass sie wirklich etwas Besonderes sind. Sie können Dinge, die andere Organismen nicht können. Dies kann nicht ignoriert werden. Wenn wir jedoch ihre Verwandtschaft mit anderen Tieren betrachten, können wir dies einfach anhand ihrer DNA-Sequenzen und Genome erkennen[5]. Die DNA-Sequenz, das Genom, von C. elegans ist fast identisch mit unserer. Beispielsweise wird der Prozess der Apoptose durch Proteine namens Caspasen durchgeführt. Dieses Protein, das andere Proteine zerschneidet, wird von einem Gen kodiert, das bei C. elegans und Menschen nahezu identisch ist. Wenn wir Nietzsches Standpunkt anwenden, wäre „Der Mensch ist ein Wurm“ vielleicht passender. SB: Dieses Zitat ist mir nicht bekannt. Hat Nietzsche das gesagt? SS: Ja, es war auf Deutsch, aber dies ist die übersetzte Version. SS: Ich hätte nicht gedacht, dass er Zellbiologe ist (lacht). Vielleicht hatte er ja doch eine gewisse Einsicht. Als nächstes möchte ich die verschiedenen experimentellen Systeme untersuchen, die zur Untersuchung des Zelltods verwendet werden, von Bakterien in einer Petrischale über C. elegans bis hin zu komplexeren Organismen. Was ist der optimale Maßstab, um den Zelltod zu untersuchen? Sand: Ich denke, es ist sehr wichtig, auf unterschiedlichen Maßstabsebenen zu beginnen. Die kleinste Ebene ist eine einzelne Zelle. Der Zelltod bei Bakterien ist nicht nur aus gesundheitlichen Gründen von Bedeutung, sondern auch, um grundlegende wissenschaftliche Fragen zu beantworten: Wie entscheidet ein Bakterium, dass es sterben muss? Es ist sehr interessant, dieses Problem bei Bakterien zu untersuchen. Auch Untersuchungen in Zellkulturen können uns viel sagen. Wenn wir beispielsweise Zellen von Menschen oder Mäusen entnehmen, sie in eine Kultur geben und sie sich teilen oder sterben lassen, verstehen wir möglicherweise nicht den Kontext, in dem sie ihr Todesprogramm ausführen. Aber wir können viel über die molekularen Mechanismen und Signalwege lernen, die Zellen sagen, ob sie sterben oder nicht sterben. Nachdem wir einige Prinzipien in diesem vereinfachten Zellkulturmodell etabliert haben, können wir versuchen, diese Erkenntnisse auf lebende Organismen auszuweiten. Beispielsweise kann untersucht werden, welche Auswirkungen ein in einer Zellkultur entdecktes Gen auf Zellen in einem Organismus haben könnte. Auch auf organismischer Ebene gibt es Fragestellungen, die nur in diesem Kontext erforscht werden können, wie etwa das Populationsphänomen des Zelltods. Es handelt sich nicht nur um den Tod einer einzelnen Zelle, sondern um das kollektive Verhalten einer Gruppe von Zellen. Am anschaulichsten wird dies im Bereich der Entwicklungsbiologie untersucht, insbesondere bei Prozessen, die mit der Morphogenese verbunden sind. Morphogenese ist der Prozess, bei dem mehrzellige Organismen ihre spezifische Form entwickeln. Der Bildhauer Rodin sagte einmal, er habe versucht, die im Stein verborgene Statue freizulegen (Anmerkung des Herausgebers: Diese Aussage könnte auch von Michelangelo stammen). Ähnlich funktioniert auch der Zelltod: Wir haben eine Zellmasse, die durch den Tod bestimmter Zellen eine bestimmte Form annimmt. Eines der bekanntesten Beispiele ist die Bildung von Fingern und Zehen bei Wirbeltieren. SS: Sie meinen die Bildung von Fingern oder Zehen? © ResearchGate Sand: Ja. Beispielsweise weisen alle Wirbeltierembryonen während der embryonalen Entwicklung des Menschen sehr ausgeprägte interdigitale Zellmembranen auf[6]. Bei Wirbeltieren wie uns sterben diese membrangebundenen Zellen massenhaft ab und bilden schließlich einzelne Finger. Bei Enten kommt es jedoch kaum zu diesem Zelltod, weshalb sie Schwimmhäute haben. SB: Das ist unglaublich. Es liegt nicht daran, dass die Schwimmhäute der Ente herausgewachsen sind, sondern daran, dass andere Tiere die Schwimmhäute „abgeschnitten“ haben! Ich frage mich auch, ob es genetische Unterschiede gibt? Einige meiner Verwandten sagen immer: „Schau dir meine Zehen an, in der Mitte haben sie Schwimmhäute.“ Sandy: Dabei handelt es sich vermutlich um rudimentäre Strukturen, die während der Embryonalentwicklung nicht vollständig beseitigt wurden. BS: Um auf den menschlichen Aspekt zurückzukommen: Könnte uns dies hinsichtlich des Zelltods dabei helfen, Organversagen rückgängig zu machen oder das Problem des massiven Zelltods anzugehen? SHA: Zelltod ist mit fast allen menschlichen Krankheitszuständen verbunden. Im Großen und Ganzen lassen sich diese Fragen in zwei Kategorien unterteilen. Ein Typ sind Erkrankungen, die mit übermäßigem Zelltod einhergehen, wie etwa Organinfarkte. Beispielsweise das Absterben von Herzmuskelzellen bei einem Herzinfarkt oder das Absterben von Zellen im Gehirn bei neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson. Der andere Typ sind Zellen, die sterben sollten, aber nicht sterben, was das wesentliche Problem bei fast allen Krebsarten ist. In Krebszellen funktionieren bestimmte Prozesse nicht mehr, wodurch die normale Beseitigung dieser schädlichen Zellen verhindert wird und sie nur unzureichend überleben. Die Teilung und Vermehrung von Krebszellen. © Wikipedia Grundsätzlich decken diese Fragen nahezu alle wichtigen Erkrankungen ab. Obwohl der Zelltod nicht die Grundursache jeder Krankheit ist, gibt es Fälle, in denen wir durch die Verhinderung des Zelltods zumindest etwas Zeit gewinnen können, um Zellen zu behandeln, die sonst vollständig verschwinden würden. In Bezug auf die Anwendung gab es einige Arzneimittelstudien, die das Problem durch Hemmung oder Förderung des Zelltods in verschiedenen Krankheitskontexten zu lösen versuchen. So gibt es beispielsweise Medikamente, die sich derzeit im klinischen Einsatz befinden und gezielt den Tod bestimmter Zellen in Tumoren auslösen. Die Entwicklung dieser Medikamente basiert auf unserem Verständnis der Zelltodmechanismen und der damit verbundenen Moleküle. SS: Als Sie vorhin das „Iss mich“-Signal auf der Zelloberfläche erwähnten, fragte ich mich unwillkürlich, ob dieser Mechanismus bei der Krebsimmuntherapie oder ähnlichen Behandlungen angewendet werden könnte? Sha: Derzeit gibt es keine klinischen Studien, die sich speziell auf „Iss mich“-Signale konzentrieren, aber wir können diese Signale künstlich erzeugen. Wenn wir auf der Oberfläche von Krebszellen einzigartige Marker finden, die sich völlig von denen anderer normaler Zellen unterscheiden, können wir einen spezifischen Antikörper erzeugen, um die Apoptose von Krebszellen auszulösen. Dadurch können die Krebszellen gezielt abgetötet werden, ohne andere Körperzellen zu schädigen. Tatsächlich ist auf dem Gebiet der Krebsbehandlung eine bemerkenswerte Revolution im Gange, die als Immuntherapie bekannt ist. Das ist die Grundlage davon. Die Idee besteht darin, dem Körper zu ermöglichen, bestimmte einzigartige Marker auf Tumorzellen zu erkennen, eine Immunantwort gegen diese Marker zu erzeugen und dann die Immunzellen diese Tumorzellen auf die vielen Arten zu zerstören, die wir zuvor erwähnt haben. BS: Wir haben viel Zeit damit verbracht, zu untersuchen, was in den letzten Jahrzehnten über den Zelltod herausgefunden wurde. Ich frage mich, ob es Fragen gibt, auf die Sie im Laufe Ihres Lebens eine Antwort wünschen, oder welche anderen spannenden ungelösten Rätsel es Ihrer Meinung nach auf diesem Gebiet gibt? Sand: Ja, ich denke, wir müssen noch viel studieren und lernen. Wie Sie zu Beginn dieses Gesprächs erwähnt haben, ist die Apoptose einer der am besten erforschten Prozesse des Zelltods. Viele Jahre lang glaubten wir, dass dieser Prozess ausreiche, um viele der mit dem Zelltod verbundenen Ereignisse während der tierischen Entwicklung zu erklären. Im Laufe der Forschung der letzten Jahrzehnte haben wir jedoch herausgefunden, dass wir dieses Zelltodprogramm vollständig aus dem Genom eines Tieres entfernen und dem Tier dennoch ein normales Überleben ermöglichen können. Dies bedeutet, dass es möglicherweise andere Möglichkeiten für den Zelltod gibt. Eine Möglichkeit könnte der von mir erwähnte Tod der Linkerzellen sein, aber das ist wahrscheinlich nicht die einzige Möglichkeit. Daher ist diese „Black Box“ zu anderen Todesprogrammen eine sehr interessante Richtung, insbesondere wenn wir den Zelltod als wichtigen Ansatzpunkt zur Bekämpfung von Krankheiten nutzen möchten. Eine weitere große Frage, die wir zu klären hoffen, ist: Ich habe erwähnt, dass wir bei C. elegans genau wissen, welche Zelle wann stirbt. Bei Wirbeltieren wissen wir es nicht. Wenn zwei menschliche Zellen nebeneinander liegen, warum erleidet dann die eine den Zelltod und die andere nicht? Davon haben wir absolut keine Ahnung. Ich denke, dass sich hier eine viel umfassendere Frage stellt, nämlich wie Zellen auf ihre Umgebung reagieren. An diesem Punkt ist der Zelltod nur eine Manifestation einer Reaktion, aber es bleibt eine sehr faszinierende Frage, auf die es derzeit absolut keine Antwort gibt. Zellbiologe Shahid Shaham. © Die Rockefeller University SS: Das ist großartig! Diese Anweisungen sind sehr spannend. Abschließend: Gibt es etwas an Ihrer Forschung, das Ihnen als Wissenschaftler, der sich für diese große Sache engagiert, besonders viel Freude bereitet? Sand: Ich liebe es, neue Dinge zu entdecken. Ich war schon immer daran interessiert, neue Dinge zu entdecken, von denen andere noch nichts wussten. In gewisser Weise sind die genauen Einzelheiten meiner Entdeckung gar nicht so wichtig. Denn wenn man sich erst einmal mit den Details befasst, sieht alles interessant und aufregend aus. Solange es Probleme zu besprechen gibt und ich mir Lösungen vorstellen kann, motiviert mich das jeden Tag zur Arbeit. Und diese Leidenschaft ist bis heute nicht verschwunden. SB: Ich verstehe dieses Gefühl. Manchmal sage ich meinen Doktoranden, dass es kaum eine Rolle spielt, um welche Frage es sich handelt. Der Entdeckungsprozess selbst ist zutiefst befriedigend. Wenn man tiefer gräbt, wird alles interessant. Sand: Ich stimme vollkommen zu. Dieses Gefühl ist zwar selten, aber erfüllend. SB: Francis Crick hat einmal gesagt, dass es besser sei, ein wichtiges Problem zu untersuchen als ein triviales oder uninteressantes. Hat diese Aussage die von Ihnen gewählten Forschungsziele beeinflusst? Sand: An dieses Zitat denke ich oft, wenn ich über mein nächstes Ziel entscheide. Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich die Arroganz besitze, zu entscheiden, was wichtig ist und was nicht. Die Wissenschaft hat immer wieder bewiesen, dass scheinbar unwichtige und unbedeutende Entdeckungen oft erst Jahrzehnte später populär werden. Dies kann in der Biologie, Physik oder Mathematik der Fall sein. Wenn ich mich also auf den von Crick vorgeschlagenen Rahmen beschränke, schließe ich möglicherweise einige Entdeckungsbereiche aus, die spannender sind, als ich mir vorstelle. Ich denke, dass meine gute Vorstellungskraft zwar nicht ausreicht, um zukünftige Entwicklungen vorherzusehen. S: Ihre Antwort inspiriert mich zutiefst. Diese Art von Bescheidenheit ist nicht nur eine Tugend, sondern kann aus der von Ihnen beschriebenen Perspektive auch eine sehr praktische Einstellung sein. Schließlich können wir die Zukunft nicht wirklich vorhersagen. Das war ein tolles Gespräch, ich könnte den ganzen Tag mit Ihnen reden. SHA: Danke, Stephen. Mir hat dieser Austausch sehr viel Spaß gemacht. Von Steven Strogatz Übersetzt von gross Korrekturlesen/tamiya2 Originalartikel/www.quantamagazine.org/how-is-cell-death-essential-to-life-20241205/ Dieser Artikel basiert auf der Creative Commons License (BY-NC) und wird von Gross auf Leviathan veröffentlicht. Der Artikel spiegelt nur die Ansichten des Autors wider und stellt nicht unbedingt die Position von Leviathan dar |
<<: Indischer E-Commerce-Marktbericht 2022–2030
>>: Wie kann man Kakerlaken in Guangdong bekämpfen?
Artikel empfehlen
Können Yoga und Pilates die Körpergröße steigern?
Heutzutage sind überall viele Yogastudios aus dem...
Welche Vorteile bietet Pilates?
Pilates ist eine Körperfitnessübung, die Yoga, Ta...
Ein Tesla Model 3 fing auf einer Autobahn in China Feuer: Offiziell: Ursache war ein Kratzer am Chassis
Bei heißem Sommerwetter kommt es häufig zu Brände...
Vorsicht vor dem heftigen Frühlingswind - Blick nach Nordwesten, sehen wir den Wolf
1. Sanfte Frühlingsbrise vs. heftige Frühlingsbri...
Welche Vorteile hat der Handstand für Frauen?
Handstand ist eine Übung, die vielen Menschen gef...
Welche Aerobic-Übungen kann man drinnen machen?
Denken Sie bei Dauerregen immer noch darüber nach...
Eindrucksvoll! Diese Offshore-Windkraftanlage kann bis zu 17 Taifunen standhalten
Am 7. Dezember um 13:37 Uhr wurde die weltweit er...
Das Rendering des vor 20 Jahren von Apple gebauten Internetcafés wird enthüllt: voller Technologie
Der Eindruck von Internetcafés hat einen sehr lan...
Welche Dehnübungen gibt es nach dem Laufen?
Nach dem Laufen spüre ich, dass meine Wadenmuskul...
Das Dentsu Digital-Team wurde entlassen: Mitarbeiter zeigten CEO Zhang Zhexiang kollektiv wegen Bestechung von GAC-Führungskräften an
Am 8. Januar wurde berichtet, dass es bei Dentsu ...
Wie trainieren Menschen mittleren Alters?
Wenn Menschen das mittlere Alter erreichen, begin...
Wo wird Kohlendioxid platziert? Diesmal gibt es viele neue Ziele!
Rezensionsexperte: Gan Qiang, Dozent am Beijing I...
Ist Sonnenschutzkleidung Geldverschwendung? Diejenigen, die Angst vor dem Bräunen haben, machen sich keine Sorgen
Tratsch Das Wetter wird von Tag zu Tag heißer und...
Was sind die Aufwärmübungen vor dem Fitness?
Mit der kontinuierlichen Entwicklung der Gesellsc...