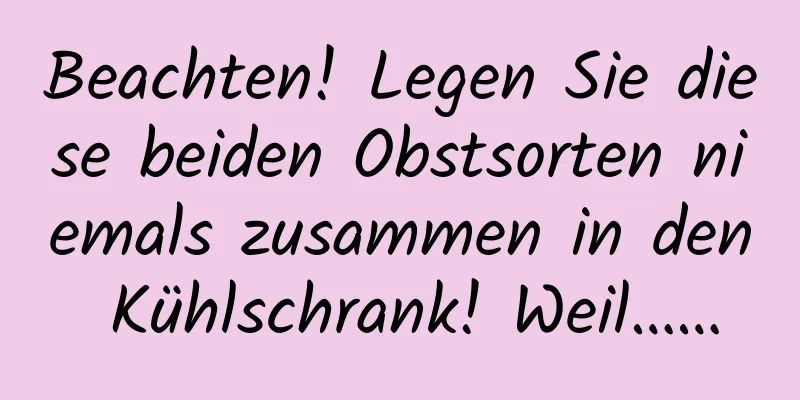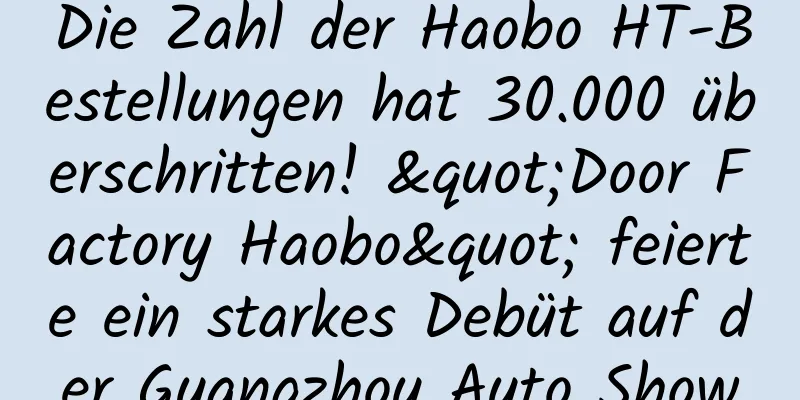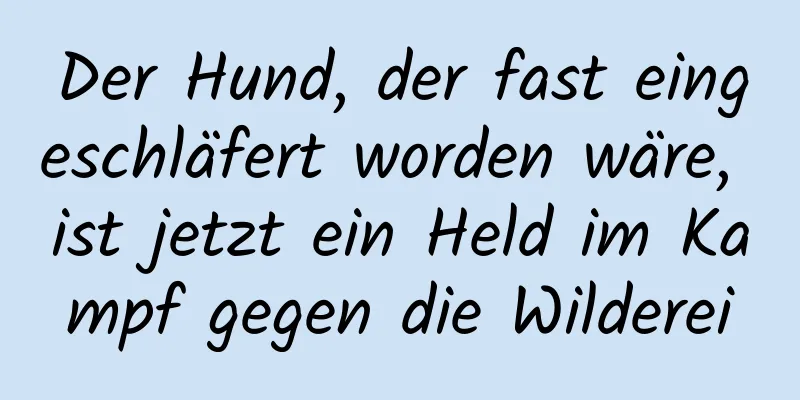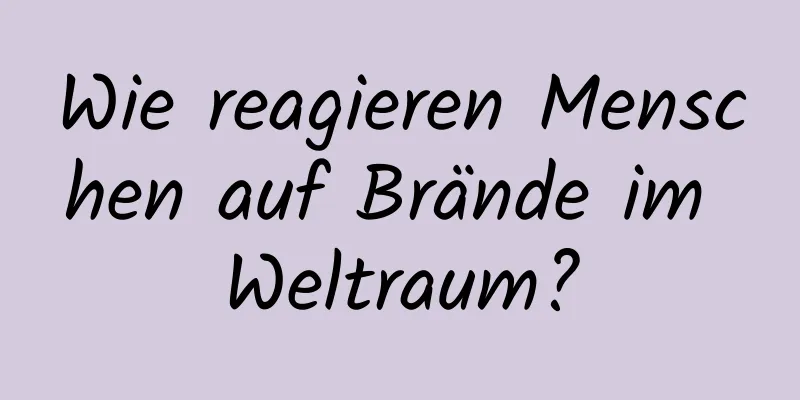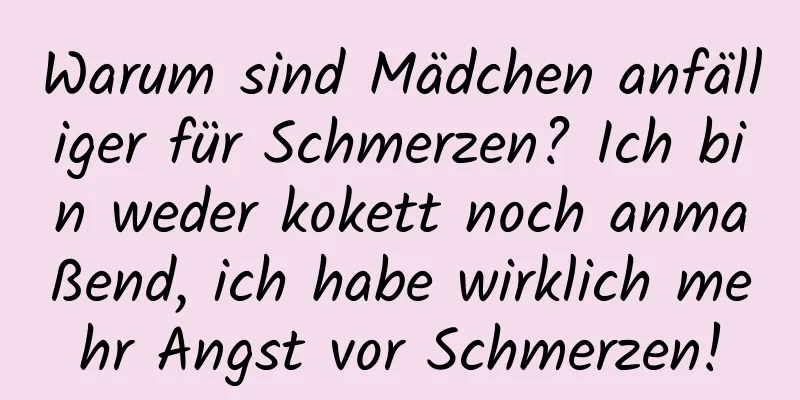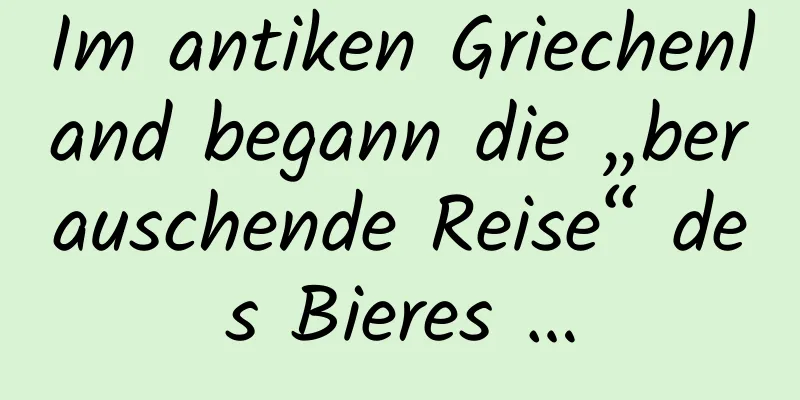Kann man Flüssigkeit einatmen?
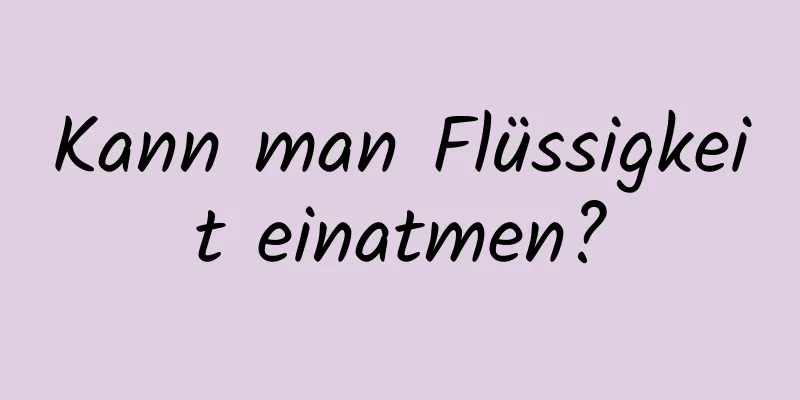
|
© Looper Leviathan Press: Obwohl es nur eine Stunde dauerte (und das spezielle flüssige PFC eingeatmet wurde), sind die Ergebnisse offensichtlich aufregend. Bis zur glücklichen Zukunft, in der wir direkt im Wasser atmen können, ist das jedoch noch weit entfernt. Selbst wenn das heikle Problem der Kohlendioxidemissionen gelöst werden kann und eine zuverlässige Methode zur direkten Sauerstoffgewinnung aus Meer- oder Süßwasser vorgeschlagen wird, ist es wahrscheinlich wirklich schwer vorstellbar, wie drastisch die Auswirkungen auf die gesamte Zivilisation sein werden, wenn sich die Menschen in Richtung der tiefen Gewässer bewegen. Am Ende von James Camerons Unterwasserthriller „The Abyss“ aus dem Jahr 1989 zieht der Bohrarbeiter Bud Brigman, gespielt von Ed Harris, einen Taucheranzug an. Er atmet anstelle von Luft eine spezielle sauerstoffhaltige Flüssigkeit, um die tödlichen Nebenwirkungen des extremen Unterwasserdrucks zu vermeiden und auf den Grund des Tiefseegrabens zu sinken, um den Atomsprengkopf zu zerlegen. Sie denken vielleicht, dass dies nur eine einprägsame Filmhandlung ist und dass diese Technologie nur in der Science-Fiction existieren kann. Stimmt das wirklich? © Douban Movies Die Fakten können anders sein als Sie denken. Die atmungsaktive Flüssigkeit im Film – sauerstoffhaltige Perfluorcarbonflüssigkeit – ist echt. Obwohl Harris beim Dreh der Szenen im Taucheranzug den Atem anhielt, sind die Szenen zu Beginn des Films, in denen die Mäuse in der Flüssigkeit frei atmen, echt. „The Abyss“ ist zweifellos der berühmteste Film, der die seit über einem Jahrhundert erforschte Technologie der Flüssigkeitsatmung zeigt. Zwar ist es noch nicht für das Tiefseetauchen geeignet, im medizinischen Bereich könnte es aber dennoch Leben retten. Die Experimente mit der Flüssigkeitsatmung begannen kurz nach dem Ersten Weltkrieg, als Ärzte begannen, sauerstoffhaltige Salzlösungen als Behandlungsmethode für Soldaten zu untersuchen, deren Lungen durch Giftgas geschädigt worden waren. Doch erst in den späten 1950er Jahren, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, begannen echte Forschungen, als die US-Marine versuchte, eine Möglichkeit zu finden, wie die Besatzungsmitglieder aus einem sinkenden U-Boot entkommen konnten, ohne an der Dekompressionskrankheit zu erkranken. Die Dekompressionskrankheit, auch Taucherkrankheit genannt, ist eine Krankheit, die durch das Atmen unter Wasser (hoher Luftdruck) in einer bestimmten Tiefe verursacht wird. Beim Abtauchen der Taucher löst sich mit zunehmendem Wasserdruck immer mehr Stickstoff im Körpergewebe. Wenn sie schnell an die Oberfläche steigen, kann die plötzliche Druckänderung dazu führen, dass Stickstoff in Form kleiner Bläschen aus der Lösung entweicht, was zu starken Gelenkschmerzen, Luftembolien, Schlaganfällen und zum Tod führen kann. © New England Journal of Medicine Daher müssen Taucher langsam aufsteigen und mehrere Stopps einlegen, um den Druck abzulassen und den Stickstoff nach und nach aus dem Körper ausscheiden zu lassen. Wenn der Taucher oder die Person, die aus dem U-Boot flieht, jedoch in der Lage ist, sauerstoffhaltige Flüssigkeit statt Luft zu atmen, ist eine Dekompression nicht erforderlich. Flüssigkeitsatmungstechniken können auch andere Gefahren des Tieftauchens verringern oder sogar eliminieren, wie etwa eine Stickstoffvergiftung (auch bekannt als „Ekstase der Tiefe“, die berauschende Reaktion, die durch das Einatmen von Stickstoffgas bei hohem Druck entsteht). In bestimmten Tiefen kann auch Sauerstoff selbst Gefahren wie beispielsweise eine Sauerstoffvergiftung verursachen. Um diese Situationen zu vermeiden, verwenden Taucher verschiedene Gaskombinationen zur Tiefseeatmung, beispielsweise Helium-Sauerstoff-Gemische oder Sauerstoff-Stickstoff-Helium-Gemische. Trotzdem funktioniert es nur bis zu einem gewissen Grad. Beispielsweise kann das Einatmen von Helium in 160 Metern Tiefe schweres Zittern und neurologische Erkrankungen wie das Hochdruck-Neurologische Syndrom verursachen. Die tiefste Tiefe, die ein Taucher mit komprimiertem Gas erreichen kann, beträgt 701 Meter (2.300 Fuß) – und zwar in einem landgestützten Tauchboot. Im Jahr 1962 ermöglichte ein Team unter der Leitung von Dr. Johannes Klystra von der Duke University Mäusen und anderen kleinen Tieren, sauerstoffhaltige Salzlösungen zu atmen, die auf einen Druck von 160 Atmosphären komprimiert waren (nur bei so hohen Drücken kann genügend Sauerstoff in der Flüssigkeit gelöst werden). Das Experiment dauerte etwa eine Stunde, doch die Tiere starben bald an einer respiratorischen Azidose (also einer Kohlendioxidvergiftung). Dies verdeutlicht einen großen Nachteil der Flüssigkeitsatmungstechnologie, der Forschern schon seit langem Kopfzerbrechen bereitet: Zwar kann die Atemflüssigkeit den Körper problemlos mit Sauerstoff versorgen, Kohlendioxid wird jedoch weit weniger effizient ausgeschieden. Um einer Azidose vorzubeugen, müssen im Ruhezustand durchschnittlich 5 Liter Atemflüssigkeit pro Minute durch die Lunge fließen, bei Aktivität sind es 10 Liter Atemflüssigkeit pro Minute – eine Flussrate, die die menschliche Lunge nicht alleine erreichen kann. Daher muss jedes praktische Flüssigkeitsbeatmungssystem Flüssigkeit effizient in die Lunge hinein und aus ihr heraus pumpen, genau wie die in Krankenhäusern verwendeten Beatmungsgeräte. Im Jahr 1966 gelang den amerikanischen Forschern Leland Clark und Frank Gollan ein bedeutender Durchbruch in der Forschung zur Flüssigkeitsatmung, als sie Klestras sauerstoffhaltige Salzlösung durch eine neue Flüssigkeit, Perfluorkohlenwasserstoffe (PFCs), ersetzten. (www.annalsthoracicsurgery.org/article/S0003-4975(02)03733-5/fulltext) PFC ist eine farblose Flüssigkeit aus Kohlenstoff und Fluor. Es wurde ursprünglich als Teil des Manhattan-Projekts während des Zweiten Weltkriegs entwickelt. Die Kombination dieser beiden Elemente ist extrem stark, daher ist PFC sehr stabil und zersetzt sich nicht so leicht. Es hat die doppelte Dichte von Wasser, ist aber nur halb so zähflüssig und kann daher fast 20-mal mehr Sauerstoff und Kohlendioxid speichern als Wasser. (link.springer.com/article/10.1007/s00424-020-02482-2) © SpringerLink Gerade aufgrund dieser Eigenschaft wird PFC zu einem idealen flüssigen, atmungsaktiven Material. In den frühen Experimenten von Clark und Golan tauchten sie Mäuse und Ratten einfach in sauerstoffhaltiges PFC und ließen sie frei atmen. Obwohl die Tiere in der dickflüssigen Flüssigkeit Atemprobleme hatten, überlebten sie alle und keines von ihnen zeigte nach 20 Stunden Eintauchen irgendwelche gesundheitlichen Schäden. Bei größeren Tieren kann eine Zwangsabsaugung erforderlich sein, um eine Kohlendioxidansammlung zu verhindern. Atemexperimente an Hunden unter Narkose zeigten außerdem die Wirksamkeit von PFC als Atemflüssigkeit. © Science Direct Die Erkenntnisse von Clark und Golan zu PFC wurden bald von Klestra übertroffen. Letzterer schloss zwischen 1969 und 1975 die als umfassendste Studie zur Flüssigkeitsatmung in der Geschichte geltende Studie ab. Zu seinen Versuchspersonen zählten sowohl Tiere als auch Menschen. Während der Forschung war der US-Navy-Taucher Francis J. Falejcyk der erste Mensch, der sauerstoffhaltige Kochsalzlösung und PFCs atmete. Außer einer Lokalanästhesie zur Erleichterung der Intubation erhielt er während des gesamten Vorgangs keine weitere medizinische Hilfe und verspürte keine starken Beschwerden. Beim Ablassen der Flüssigkeit aus seiner Lunge ging jedoch etwas schief und er bekam eine Lungenentzündung. Im Jahr 1971 hielt Falk einen Vortrag über diese Erlebnisse. Im Publikum saß der damals 17-jährige Cameron. Dieser Vortrag inspirierte ihn zu der Kurzgeschichte, die schließlich zum Drehbuch für „The Abyss“ wurde. Klestras Forschung zeigt, dass Menschen unter normalen Umständen PFC bis zu einer Stunde lang einatmen können, ohne eine Kohlendioxidvergiftung zu erleiden. Daher ist die Technologie der Flüssigkeitsatmung für Menschen, die aus einem sinkenden U-Boot entkommen, praktikabel. Um die Technologie breiter anzuwenden, experimentierte Klestra auch mit einer Emulsion aus PFCs und Natriumhydroxid, die Kohlendioxid besser aus dem Blut absorbieren kann. (www.scientificamerican.com/index.cfm/_api/render/file/?method=inline&fileID=C71A44ED-B140-4670-8AD72D6F46692A6E) Letztendlich wurde jedoch keine dieser Technologien in die Praxis umgesetzt. Berichten zufolge führten die US Navy SEALs in den 1980er Jahren Experimente zur Flüssigkeitsatmung durch, stellten jedoch fest, dass das Einatmen von PFC für die Menschen sehr anstrengend war. Mehrere Taucher haben sich bei Testübungen aufgrund übermäßiger Krafteinwirkung Rippen verstaucht und gebrochen. Eine vorgeschlagene Lösung für das Problem der Azidose besteht darin, Taucher mit einem Venenshunt auszustatten, der Kohlendioxid direkt aus dem Blut entfernt. Leider ist dieser Ansatz mit erheblichen medizinischen und logistischen Problemen verbunden und bis die Technologie der Flüssigkeitsatmung beim Tiefseetauchen eingesetzt werden kann, ist noch ein weiter Weg zurückzulegen. Aber auch in der Medizin, insbesondere bei der Betreuung von Frühgeborenen, kann es eine wichtige Rolle spielen. © Wattpad Die menschliche Lunge verfügt über etwa 500 Millionen Alveolen und durch diese winzigen Bläschen wird Sauerstoff ins Blut aufgenommen. Um zu verhindern, dass die Alveolen wie nasse Papiertüten kollabieren, produziert der Körper eine Substanz namens Lungensurfactant. Dabei handelt es sich um eine Lipidmischung, die die Oberflächenspannung des Wassers senkt und so dafür sorgt, dass die Alveolen offen bleiben. Frühgeborene können jedoch nicht genügend Lungensurfactant produzieren und die meisten ihrer Alveolen kollabieren nach der Geburt, was zu Atembeschwerden führt. Herkömmliche Beatmungsgeräte helfen Frühgeborenen seit Jahrzehnten beim Atmen, doch der hohe Druck, den diese Geräte erzeugen, kann die empfindlichen Lungen schwer schädigen. Wenn Atemflüssigkeit in die Lunge injiziert wird, kann diese Flüssigkeit die Fruchtwasserumgebung in der Gebärmutter wiederherstellen, wodurch sich die Alveolen öffnen und die Effizienz des Gasaustauschs erheblich gesteigert wird. Darüber hinaus können Ärzte diese Technologie auch nutzen, um Medikamente direkt in die Lunge zu verabreichen. JS Greenspan vom Temple University Hospital in Philadelphia ist ein Pionier auf dem Gebiet der Flüssigkeitsbeatmung bei Neugeborenen. Im Jahr 1989 schloss er 13 Frühgeborene für Zeiträume zwischen 24 und 96 Stunden an Flüssigkeitsbeatmungsgeräte an. Alle Kinder konnten später wieder Luft atmen und bei elf von ihnen zeigte sich eine deutliche Verbesserung der Lungenfunktion, sechs starben jedoch an Faktoren, die nichts mit dem Experiment zu tun hatten. Im Jahr 1995 führte RB Hirschl ähnliche Experimente an 19 Personen durch, darunter sowohl Erwachsene als auch Säuglinge und Neugeborene. Schließlich verbesserte sich die Lungenfunktion von elf Patienten und sie überlebten, was die Wirksamkeit der Flüssigkeitsatmungstechnologie weiter bestätigte. © Die Sicherheitszone Allerdings ist die unterstützende Ausrüstung für die Flüssigkeitsatmungstechnologie sehr komplex und teuer. Aus diesem Grund erfand BP Fulman 1991 eine vereinfachte Version der „Partial Liquid Breathing“-Technologie, die PLV (Partial Liquid Ventilation). Dabei muss die Lunge nur teilweise mit Atemflüssigkeit befüllt werden, der Rest kann über ein herkömmliches Beatmungsgerät mit Luft gefüllt werden. Dadurch werden etwa 40 % der Lungenbläschen geöffnet und eine effizientere Ausscheidung von Kohlendioxid ermöglicht. Eine weitere vorgeschlagene Option ist die Umstellung von Atemflüssigkeiten auf luft- oder sauerstoffhaltige Aerosole, die eine ähnliche Wirkung haben und für den Patienten deutlich angenehmer zu atmen sind. Im Jahr 1995 demonstrierten Mike Darwin und Steven Harris, wie Flüssigkeitsatmungstechniken zur Herbeiführung einer therapeutischen Hypothermie eingesetzt werden können. Dabei geht es darum, Schäden am Gehirn und anderen Geweben durch die Senkung der Körpertemperatur nach einem Herzstillstand zu verringern. Indem sie ihre Lungen mit flüssigen PFCs füllten, konnten die beiden Männer einen beispiellosen Temperaturabfall von 0,5 Grad Celsius pro Minute erreichen, was viel effizienter ist als unsere derzeitige Technologie. Nach großen und kleinen Durchbrüchen hat die US-amerikanische Food and Drug Administration die Flüssigkeitsinfusionstechnologie einer „Fast-Track-Prüfung“ unterzogen, um diese potenziell lebensrettende Technologie so schnell wie möglich in die Klinik zu bringen. Wenn Cameron also auch in Zukunft den Marianengraben erkunden möchte, wird er weiterhin auf ein komplexes U-Boot angewiesen sein. Doch die oben genannten Durchbrüche können Trost spenden – die Technologie, die ihn als Kind inspirierte, könnte in Zukunft zahllose Leben retten. Von Gilles Messier Übersetzt von Yord Korrektor/Apotheker Originalartikel/www.todayifoundout.com/index.php/2021/08/can-humans-breathe-liquid-like-in-the-abyss/ Dieser Artikel basiert auf der Creative Commons License (BY-NC) und wird von Yord auf Leviathan veröffentlicht Der Artikel spiegelt nur die Ansichten des Autors wider und stellt nicht unbedingt die Position von Leviathan dar |
>>: Folgen Sie dem Satelliten, um nach Ningbo zu reisen. Sehen Sie das Meer entlang des Kanals
Artikel empfehlen
Welche Indoor-Trainingsmethoden gibt es?
Sport ist eine unverzichtbare Aktivität, aber auf...
Wofür hat Didi seine 3,5 Milliarden US-Dollar ausgegeben? Liu Qing: Den chinesischen Markt bedienen
Am 8. Juli gab Didi Kuaidi bekannt, dass es eine ...
Das wilde Biest, das dich so bezaubernd macht, muss ich sein!
Wenn es um das süßeste Tier geht, denken die meis...
Dianca sammelt 2 Milliarden Yuan, die Finanzierungsrunde A hat begonnen und wird eine High-End-Marke auf den Markt bringen
Berichten zufolge hat Diancha Automobile vor Kurz...
Warum sind Scope-3-Emissionen der Schlüssel zur Dekarbonisierung?
Die Scope-3-Emissionen, also die Emissionen, die ...
Welche drei Bewegungen gibt es für die Dehnung des Tractus iliotibialis?
Wenn Sie nicht viel über den Aufbau des menschlic...
Übermäßiges Muskeltraining kann dazu führen, dass die Haare dort frühzeitig ausfallen
Ein muskulöser Körper ist beneidenswert, aber übe...
Kann man durch die Einnahme von Medikamenten seine Gesundheit erhalten? Mit ein paar kleinen Maßnahmen bleiben Sie ein Leben lang gesund
„Möchten Sie Ihren Problemen entfliehen? Pigmentf...
Spezifische Trainingsmethoden für das Eightpack-Bauchmuskeltraining
Wie können Sie schnell einen sexy Achterpack beko...
So trainieren Sie die Beckenbodenmuskulatur
Bei vielen Menschen, die ein Kind zur Welt gebrac...
Welche Yoga-Übungen können Ihnen helfen, Ihre Willenskraft zu stärken?
Mit der Verbesserung des Lebensstandards legen vi...
US-Energieministerium: Blaupause zur Dekarbonisierung des Verkehrssektors
Die US-Regierung hat den Nationalen Plan zur Deka...
Mikroplastik im menschlichen Blut gefunden. Wie gelangt es in unseren Körper?
Gutachter: Zhou Jiaojiao, Außerordentlicher Profe...
Können Sie den ersten Eindruck vorhersagen, den die Leute von Ihnen haben, wenn sie Ihr Foto zum ersten Mal betrachten?
Dieser Artikel stammt aus: Big Data Digest Jeder ...
Kennen Sie die Gefahren, wenn Sie den Kühlschrank nicht reinigen? Bakterien siedeln sich an und der Geruch lässt sich nicht vertreiben!
Für viele Familien ist der Kühlschrank die „Schat...