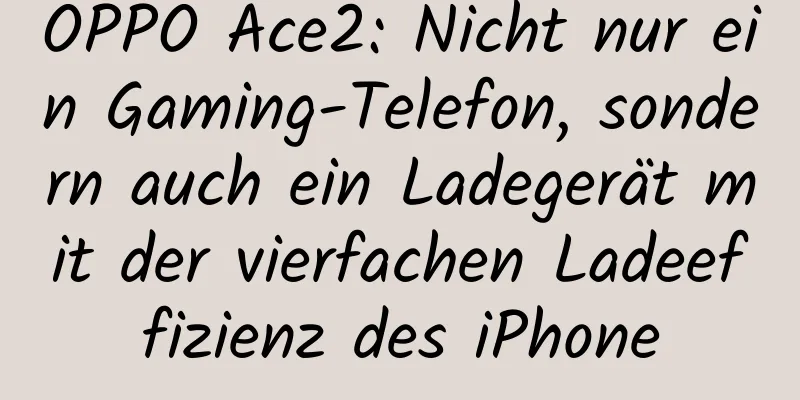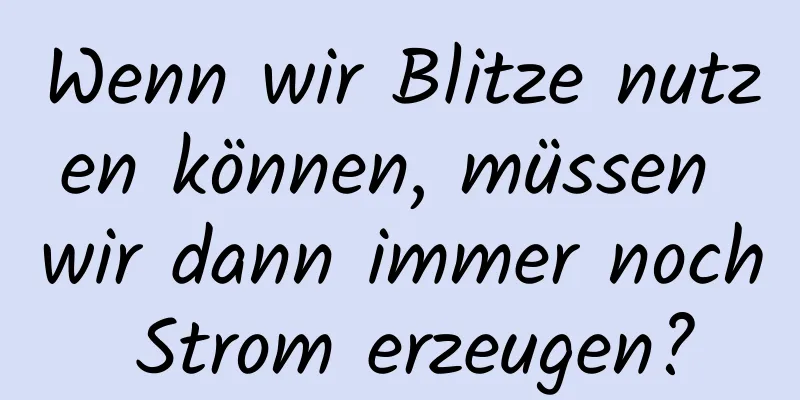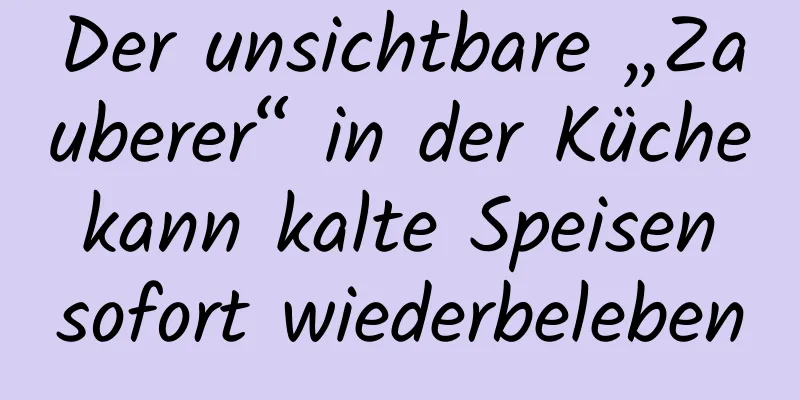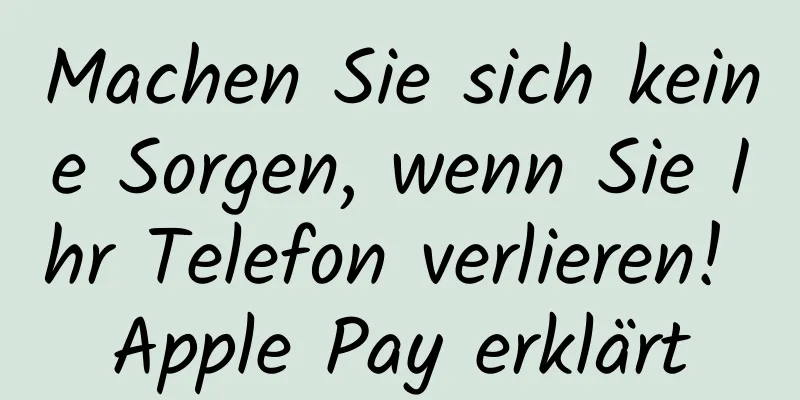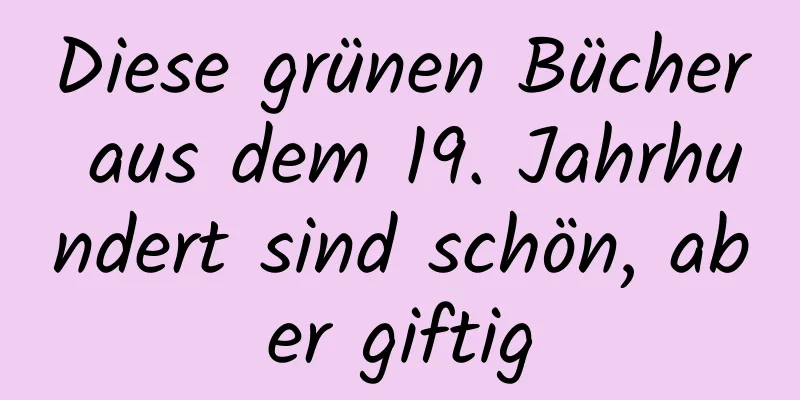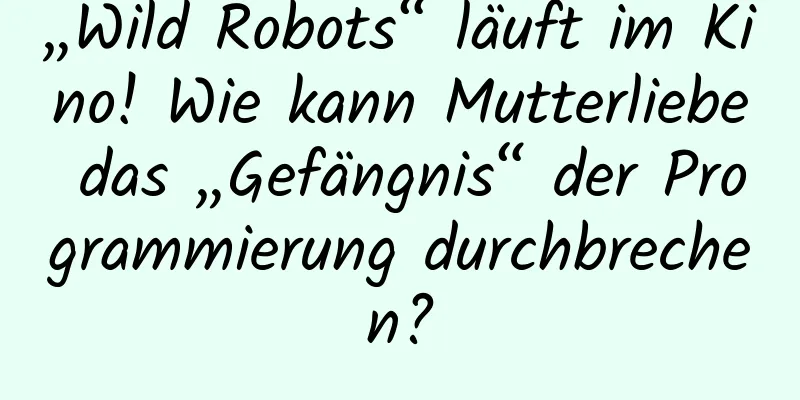Was genau ist Ockhams Rasiermesser?
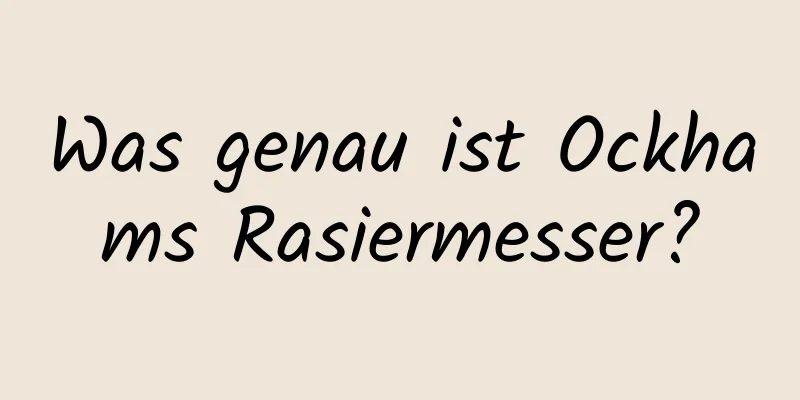
|
© Ness Labs Leviathan Press: Das Prinzip von Ockhams Rasiermesser ist eigentlich nicht schwer zu verstehen. Es besagt, dass unter sonst gleichen Bedingungen einfachere Erklärungen (im Vergleich zu komplexeren) normalerweise richtig sind. Wissenschaftler nutzen es täglich, um zwischen konkurrierenden Theorien zu wählen. Das Problem besteht darin, dass es keine empirischen Beweise dafür gibt, dass die Welt einfach ist, und dass viele wissenschaftliche Theorien mit der Zeit immer komplexer werden. Das Ockhamsche Rasiermesserprinzip muss mit Vorsicht angewendet werden, insbesondere wenn es um verschiedene Disziplinen geht. Beispielsweise lautet der im Artikel erwähnte allgemeine Ausspruch des Arztes: „Wenn Sie hinter sich Hufschläge hören, denken Sie an Pferde, nicht an Zebras.“ Dieses Ockhamsche Reduktionsprinzip scheint im Allgemeinen in Ordnung zu sein, es gibt jedoch auch ein entsprechendes Hickam-Diktum, das einfach bedeutet: „Ein Patient kann so viele Krankheiten haben, wie er möchte.“ Was bedeutet das? Damit ist gemeint, dass bei vielen Patienten ein breites Spektrum an Symptomen vorliegt, die nicht durch eine einzelne Erkrankung (Reduktion) erklärt werden können. Letztendlich kann Ockhams Rasiermesser als kognitives Werkzeug/Modell nicht unfehlbar sein. Wenn Sie schon einmal online in einen Streit mit jemandem verwickelt waren, sind Sie wahrscheinlich schon auf Ockhams Rasiermesser gestoßen. Das Ockhamsche Rasiermesserprinzip ist das beliebteste Argument der Tastaturkrieger. Die Menschen verstehen die Theorie von Ockhams Rasiermesser im Allgemeinen so: „Das einfachste Argument ist oft das richtigste.“ Woher kommt dieser seltsame Name? Ist dieses Prinzip wirklich so magisch, wie die Leute denken, oder ist es nur eine Möglichkeit für die Leute, ihre Intelligenz zur Schau zu stellen und Argumente zu gewinnen? Bevor wir beginnen, eine kurze Hintergrundgeschichte. Ockhams Rasiermesser ist nach Wilhelm von Ockham benannt, einem englischen Franziskanermönch und Theologen, der im 13. und 14. Jahrhundert lebte. Er wurde 1285 in der kleinen Stadt Ockham geboren und trat im Alter von 14 Jahren dem Franziskanerorden bei. Über sein frühes Leben ist sehr wenig bekannt. Es überrascht nicht, dass seine Entscheidung für den Mönchsorden seine philosophischen Ansichten und theologischen Debatten tiefgreifend beeinflusste. Ockham erhielt seine Ausbildung zunächst im Franziskanerkloster in London, wo er allgemeine akademische Fächer wie Logik, Naturphilosophie und Theologie studierte. Von 1310 bis 1317 studierte er Theologie an der Universität Oxford und begann, Vorlesungen über die Vier Sentenzenbücher des Bischofs Peter von Lombard zu halten. Dieses Werk ist ein von Theologen hochgeschätztes Standardwerk. Wilhelm von Ockham (1285-1347). © GoHighBrow Ockham hielt Vorlesungen und kommentierte das Tetrabiblos. Aufgrund dieser Aktivitäten geriet er erstmals in philosophischer und theologischer Hinsicht in Konflikt mit der katholischen Kirche. Ockham, ein Franziskanermönch, hatte theologische Meinungsverschiedenheiten mit dem damals vorherrschenden Dominikanerorden, dessen Ansichten in den Schriften des Heiligen Thomas von Aquin verankert waren. Zwischen den Franziskanern und Dominikanern herrschte in vielen Fragen Uneinigkeit. Eine davon war die Frage, ob Jesus und seine Anhänger Eigentum besaßen. Der heilige Franz von Assisi glaubte, dass Jesus kein Privateigentum besaß, und nahm ihn als Vorbild für die Gründung des Franziskanerordens, der von den Mönchen verlangt, ihr Leben lang in Armut zu leben und sich bei der Versorgung mit Nahrung, Obdach und anderen Lebensnotwendigkeiten auf die Hilfe anderer zu verlassen. Er ließ sogar das neue Haus, das eigens für seinen Orden errichtet worden war, abreißen. Ockham war ein energischer Anhänger dieser Ideen und im Jahr 1324 berichtete einer seiner Rivalen in Oxford die Angelegenheit Papst Johannes XXII., der Ockham zu einer Anhörung vor das päpstliche Tribunal zitierte, das sich damals im französischen Avignon befand. Papst Johannes XXIII. (1244-1334). © Lapham's Quarterly Ockham glaubte, dass die katholische Kirche großen Reichtum und große Macht angehäuft habe, was im Widerspruch zu den Lehren Jesu stehe. Er erklärte den Papst sogar zum Ketzer und forderte seine Abdankung. Die nächsten vier Jahre lebte Ockham in Avignon. Die Anhörungen verzögerten sich und der Konflikt zwischen Dominikanern und Franziskanern verschärfte sich immer mehr. Schließlich floh er 1328 aus der Stadt. Ockham reiste durch Italien und Deutschland, bevor er sich in München niederließ, wo er den Rest seines Lebens verbrachte und 1347 starb. Occam widmete sein gesamtes Leben dem Studium der Metaphysik und Logik und entwickelte das berühmte Prinzip von Ockhams Rasiermesser. Die Schule der mittelalterlichen Philosophie, der Ockham angehörte, auch als Scholastik bekannt, unterschied sich stark von unseren modernen Konzepten der Philosophie und Logik und konzentrierte sich hauptsächlich auf die Theologie und die Werke des Aristoteles. Eine übermäßige Konzentration auf die Theologie könnte die Scholastik von der modernen Philosophie entfremden, die Studierenden verwirren und das Fach in Verruf bringen. Die Wahrheit ist jedoch komplizierter, und Ockhams Werk ist eine hervorragende Fallstudie darüber, wie die scholastische Philosophie dazu beitrug, die Grundlagen für den modernen Empirismus und die analytische Philosophie zu legen. (Empirismus, auch Empirismus genannt, ist eine Theorie, die besagt, dass Wissen ausschließlich oder hauptsächlich aus Sinneserfahrungen stammt. Er ist eine von mehreren Sichtweisen der Erkenntnistheorie, weitere Sichtweisen sind Rationalismus und Skeptizismus. Die analytische Philosophie, eine Schule der Philosophie, ist seit dem frühen 20. Jahrhundert in den anglo-amerikanischen philosophischen Kreisen populär und stellt die traditionelle Philosophie in Frage und konterkariert sie. Die analytische Philosophie konzentriert sich auf die Klärung von Sprache und Logik sowie die Analyse vorhandenen Wissens und steht im Gegensatz zur traditionellen kontinentalen Philosophie. Anmerkung des Herausgebers.) Ein Großteil von Ockhams Forschung beschäftigte sich mit dem Problem der Universalien, also Entitäten, die sich auf andere Entitäten beziehen und ähnliche Entitäten als allgemeine Eigenschaften vereinen. In diesem Rahmen können wir das Beispiel eines Stuhls nehmen, der seine Existenz der Eigenschaft „Stuhlhaftigkeit“ verdankt, die bestimmt, was in der materiellen Welt ein Stuhl ist und was nicht. Unter den philosophischen Schulen besteht ein Streit darüber, ob Universalien unabhängig von den Objekten sind, die sie repräsentieren, oder ob es sich bei ihnen um grundlegende Eigenschaften der Objekte selbst handelt. Als Nominalist (der Nominalismus geht davon aus, dass reale Dinge keine universelle Essenz haben, sondern nur substantielle Individuen existieren; Universalien existieren in der Realität nicht, sondern sind Namen, die die Eigenschaften von Dingen darstellen, daher der Name „Nominalismus“. Die Position des Nominalismus ist der des Realismus entgegengesetzt, aber aufgrund des Einflusses der christlichen Lehre entwickelte sich der Nominalismus etwas später als der Realismus. Anmerkung des Herausgebers) glaubte Occam nicht an die tatsächliche Existenz des Universums. Für ihn ist ein Stuhl einfach nur ein Stuhl – nicht Teil einer universellen metaphysischen Eigenschaft, sondern einfach ein Konzept des Geistes, das zur Beschreibung einer Gruppe verwandter Objekte verwendet wird. Obwohl ein Stuhl Merkmale mit anderen Stühlen gemeinsam hat, bestehen diese Ähnlichkeiten nur in der Vorstellung des Betrachters und sind keine grundlegenden Eigenschaften der physischen Welt. Dies alles mag zwar wie Haarspalterei einiger Insider klingen, doch Ockhams Weigerung, die außermetaphysischen Aspekte der alten aristotelischen Philosophie – darunter auch das Konzept des Universums – zu akzeptieren, führte zur Entwicklung einer einfacheren, rationalisierten Weltsicht, die den Empirismus und die wissenschaftliche Methode hervorbrachte und direkt zu dem führte, was heute als Ockhams Rasiermesser bekannt ist. Ockhams Rasiermesser wird oft wie folgt beschrieben: „Entitäten sollten nicht über das Notwendige hinaus vervielfältigt werden.“ Mit anderen Worten: Wenn man zwei Argumente vergleicht und alle anderen Bedingungen gleich sind, ist das einfachste Argument höchstwahrscheinlich richtig. Obwohl dieses Prinzip oft mit Occam in Verbindung gebracht wird, hat Occam selbst in keinem seiner bekannten Werke die moderne Form seines berühmten „Rasiermesser“-Prinzips dargelegt. Tatsächlich tauchte die Grundidee von Ockhams Rasiermesser, das „Prinzip der Sparsamkeit“, erstmals Jahrhunderte vor Ockham in den Schriften des Aristoteles auf: „Der Himmel hat alle Dinge zum Nutzen geschaffen und die Guten zum Nutzen ausgewählt, und das gilt für alle Insekten.“ (Die Natur tut nichts umsonst, sondern tut immer das Beste aus den Möglichkeiten für das Wesen jeder Tierart.) Theologe und Astronom Liberty Froymont (1587–1653). © Wikipedia Das Gesetz des Geizes tauchte auch in den Werken vieler griechischer, jüdischer, muslimischer und christlicher europäischer Philosophen vor dem 14. Jahrhundert auf. Warum also bringen die Leute es mit Wilhelm von Ockham in Verbindung? Es wird allgemein angenommen, dass dieses Prinzip von späteren Gelehrten entwickelt wurde, wie zum Beispiel vom Theologen und Astronomen Libert Froidmont, der 1649 in seinem Werk „Zur christlichen Philosophie der Seele“ schrieb: „Ich nenne dieses Prinzip Ockhams und Nominalisten-Rasiermesser, weil wir damit alle verschiedenen Entitäten abrasieren und nur den Plural des Namens übrig lassen.“ Unabhängig von seinen Ursprüngen oder spezifischen historischen Formulierungen bleibt das Grundprinzip von Ockhams Rasiermesser unverändert: Der Zweck einer Theorie besteht darin, Naturphänomene zu erklären. Je weniger Annahmen und Wendungen eine Theorie also enthält, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie haltbar ist. Oder, wie es unter Ärzten bei ihren Konsultationen heißt: Wenn Sie Hufschläge hören, denken Sie an Pferde, nicht an Zebras. (Das bedeutet, dass Ärzte bei der Diagnose einer Krankheit oder Verletzung versuchen sollten, die einfachste mögliche Ursache aller Symptome zu finden. Anmerkung des Herausgebers) Als die westliche Philosophie in die Zeit der Aufklärung eintrat, wurden alte Konzepte des Universums in Frage gestellt, und Ockhams Rasiermesser gewann dabei besondere Bedeutung. Beispielsweise glaubten Philosophen jahrtausendelang, dass die Erde der Mittelpunkt des Universums sei und dass sich das Universum um die Erde drehe. Diese Theorie ist jedoch grundsätzlich fehlerhaft, da manche Himmelskörper, wie etwa Planeten, scheinbar periodisch anhalten und sich drehen, ein Phänomen, das als retrograde Bewegung bekannt ist. Ptolemäus' Diagramm des Universums. © Wikipedia Tatsächlich stammt das Wort „Planet“ vom griechischen Wort „planetai“, was „Wanderer“ bedeutet. Im 3. und 2. Jahrhundert v. Chr. versuchten die griechischen Philosophen Hipparchos und Ptolemäus, diesen scheinbaren Widerspruch aufzulösen. Sie entwickelten ein Modell des Universums, in dem die Planeten nicht nur die Erde umkreisten, sondern auch kleinere Bahnen, sogenannte Epizykel, aufwiesen, die zusammen die retrograde Bewegung erklärten. Ein Modell des geozentrischen Universums aus dem Jahr 1568 des portugiesischen Kosmographen und Kartografen Bartolomeu Velho. © Wikipedia Als die Astronomen jedoch immer offensichtlichere und widersprüchlichere Himmelsphänomene entdeckten, wurde das ptolemäische Modell zu einem problematischen und komplizierten „Kreis im Kreis“. Im Gegensatz dazu vertraten Nikolaus Kopernikus und Galileo Galilei das heliozentrische Weltbild, das davon ausging, dass der Mittelpunkt des Universums die Sonne und nicht die Erde sei, was die Rückwärtsbewegung besser erklären würde. Nach diesem Modell wird das Phänomen dadurch verursacht, dass die Planeten die Sonne mit unterschiedlicher Geschwindigkeit umkreisen, was dazu führt, dass sich einige Planeten regelmäßig gegenseitig überholen und so die Illusion einer umgekehrten Bewegung entsteht. Mangels anderer Beweise musste das kopernikanische Modell weniger Annahmen und Wendungen aufbringen, um dieselben Naturphänomene zu erklären, und wurde schließlich von den Menschen akzeptiert. Kopernikus' Sicht des Universums in „Über die Umdrehungen der Himmelssphären“. © Wikipedia Obwohl Ockhams Rasiermesser ein nützliches Mittel zum Vergleich konkurrierender Theorien ist, handelt es sich dabei nicht um die ultimative Regel, die oft behauptet wird. Schließlich ist die einfachste Erklärung nicht immer die richtige, insbesondere in der Wissenschaft. Aristoteles glaubte beispielsweise, dass alle Objekte die natürliche Tendenz hätten, zum Mittelpunkt des Universums zu fallen. Da die Menschen glaubten, die Erde sei der Mittelpunkt des Universums, erklärte diese Philosophie auf clevere Weise das Phänomen der Schwerkraft. Isaac Newton zeigte jedoch später, dass die Schwerkraft tatsächlich eine Anziehungskraft ist, die von allen Objekten mit Masse ausgeübt wird. Später enthüllte Albert Einstein, dass die Schwerkraft dadurch entsteht, dass die Masse eines Objekts das Raum-Zeit-Gefüge verzerrt. Jedes Beispiel macht die Erklärung der Schwerkraft komplexer und verbessert gleichzeitig die Genauigkeit der Modellierung und Vorhersage natürlicher Phänomene. Tatsächlich hat die Einfachheit einer wissenschaftlichen Theorie wenig damit zu tun, wie wahr sie ist; Entscheidend ist, ob die Theorie experimentelle Ergebnisse genau vorhersagen kann. Dies beweist, dass die Mahnung in der traditionellen Formulierung von Ockhams Rasiermesser, „alle anderen Dinge sind gleich“, von entscheidender Bedeutung ist. In den allermeisten Fällen sind konkurrierende Theorien nicht „identisch“ und es gibt immer eine große Menge empirischer Beweise, die eine Seite stützen, was die Anwendung von Ockhams Rasiermesser sinnlos macht. Dennoch findet Ockhams Rasiermesser in der Wissenschaft Anwendung, insbesondere im Hinblick auf das Prinzip der Falsifizierbarkeit. Das Falsifizierbarkeitsprinzip wurde erstmals 1935 vom österreichischen Philosophen Karl Popper in seinem Buch „Zur Logik der Forschung“ vorgeschlagen. Popper sah darin einen grundlegenden Unterschied zwischen den Naturwissenschaften und anderen Wissenschaftsbereichen, insbesondere zwischen Einsteins Relativitätstheorie und Freuds psychoanalytischen Theorien. Philosoph Karl Popper (1902-1994). © Adam Smith Institut Popper spürte instinktiv, dass Ersteres wissenschaftlicherer Natur war als Letzteres, konnte jedoch zunächst nicht genau erklären, warum. Der Unterschied, so erkannte er später, bestand darin, dass jede Theorie durch experimentelle Beweise widerlegt werden konnte. Er stellte fest, dass psychoanalytische Theorien nicht widerlegt werden könnten; Wenn ein beobachtbares Verhalten einer von Freuds Theorien widersprach, wurde sofort eine andere Theorie vorgeschlagen, um den Widerspruch zu erklären. In der Wissenschaft wird dies als Ad-hoc-Hypothese bezeichnet . Obwohl es unmöglich ist, dass alle Theorien gleichzeitig richtig sind, gibt es keinen Mechanismus, um festzustellen, welche Theorie richtig ist. Im Gegensatz dazu war Einsteins Theorie von Natur aus „gefährlicher“, da sie durch Experimente widerlegt werden konnte. Beispielsweise sagt die allgemeine Relativitätstheorie voraus, dass die Schwerkraft der Sonne das Licht weit entfernter Sterne in einem anderen Ausmaß ablenkt als von der Newtonschen Mechanik vorhergesagt. Könnte man diese Auslenkung also messen, wie es der Physiker Arthur Eddington 1919 versuchte, gäbe es zwei mögliche Ergebnisse: Das eine würde Einsteins Theorie stützen, das andere würde sie widerlegen. 【Wissenschaftler stehen Theorien, die auf unbewiesenen und unbegründeten Beweisen beruhen, im Allgemeinen skeptisch gegenüber. Ad-hoc-Hypothesen sind daher häufig ein Merkmal der Pseudowissenschaft. Viele wissenschaftliche Erkenntnisse basieren auf Änderungen an bestehenden Theorien oder Hypothesen. Dies ist jedoch etwas anderes als der Versuch, Erklärungen aufzuzwingen. Obwohl die Ad-hoc-Hypothese von der Wissenschaft nicht anerkannt wird, ist ihre Annahme selbst nicht unbedingt völlig falsch. Einstein schlug einst eine externe Annahme namens „kosmologische Konstante“ für die allgemeine Relativitätstheorie vor, um die Existenz eines statischen Universums zuzulassen, wobei es sich um eine Ad-hoc-Hypothese handelt. Obwohl Einstein diese Hypothese später als seinen „größten Fehler“ betrachtete, kann seine Hypothese zur Erklärung der dunklen Energie verwendet werden. Anmerkung des Herausgebers All dies zeigt uns, dass eine Theorie, die alles erklären kann und einwandfrei ist, entgegen unserer Intuition in Wirklichkeit von Natur aus schwach ist und zur Pseudowissenschaft gehört. Eine starke Theorie enthält also eine minimale Anzahl von Annahmen und Ad-hoc-Hypothesen und ist grundsätzlich überprüfbar und – was am wichtigsten ist – falsifizierbar. Auf einer grundlegenderen Ebene glauben viele Philosophen, dass der Missbrauch von Ockhams Rasiermesser die Kreativität ersticken und dazu führen kann, dass Menschen zu engstirnig denken. Walter Chatton (1285-1343), ein Zeitgenosse von Wilhelm von Ockham, schlug sogar das „Anti-Rasiermesser“-Prinzip vor, auch bekannt als Prinzip der Fülle : „Wenn eine bejahende Aussage als eine tatsächlich existierende Sache bewiesen werden soll, muss man, wenn zwei Dinge, wie auch immer sie in der Reihenfolge ihrer Anordnung und Dauer existieren, nicht ausreichen, um die Aussage zu beweisen, dass die andere Sache fehlt, das andere Ding annehmen.“ (Kurz gesagt: Wenn eine Erklärung die Wahrheit einer Aussage nicht zufriedenstellend bestimmt und Sie davon überzeugt sind, dass die bisherige Erklärung richtig ist, dann muss eine andere Erklärung verfügbar sein. Anmerkung des Herausgebers) Ähnlich äußerte sich der deutsche Philosoph Immanuel Kant: „Reduzieren Sie Entitäten nicht, es sei denn, es ist notwendig.“ Überraschend ist, dass das „Rasiermesser“ und das „Anti-Rasiermesser“ nicht wirklich im Widerspruch zueinander stehen, sondern vielmehr eine Rolle bei der Verhinderung extremer Ideen im Prozess der Theoriebildung spielen. Das „Rasiermesser“ wendet sich gegen die unnötige Erhöhung der Komplexität, während das „Anti-Rasiermesser“ sich gegen die unnötige Eliminierung von Komplexität wendet. In der Philosophie und in der Wissenschaft sind, wie in allen Bereichen, Mäßigung, Vernunft und Reflexion der Schlüssel zur Aufdeckung der Wahrheit. Ockhams Rasiermesser ähnelt daher im physikalischen Sinne stark einem Rasiermesser: Sie können gründlich rasieren, müssen jedoch darauf achten, nicht zu gründlich zu rasieren. Von Yehia Amin Übersetzt von Zhao Hang Korrekturlesen/Links zu Originalartikel/www.todayifoundout.com/index.php/2022/07/is-ockhams-razor-actually-valid-or-just-something-people-say-to-sound-smart/ Dieser Artikel basiert auf der Creative Commons License (BY-NC) und wird von Zhao Hang auf Leviathan veröffentlicht Der Artikel spiegelt nur die Ansichten des Autors wider und stellt nicht unbedingt die Position von Leviathan dar |
<<: Welche Geheimnisse hat Galileo am 413. Jahrestag der Geburt des Teleskops damit entdeckt?
>>: Nehmen Sie mit, um den "Geist" im Fossil zu fangen
Artikel empfehlen
Wird Peking eine groß angelegte Luftdesinfektion durchführen? Hören Sie auf zu scherzen, schauen wir uns die Strategie der „echten Desinfektion“ an
Kürzlich tauchten im Internet Gerüchte über eine ...
Ist es gut, morgens Seil zu springen?
Seilspringen ist eine weit verbreitete Sportart. ...
Was ist die häufig erwähnte „Blutsauerstoffsättigung“? Mehr erfahren →
Die Sauerstoffsättigung des Blutes ist ein sehr w...
Kann Laufen die Beinmuskelmasse reduzieren?
Laufen ist eigentlich ein sehr guter Sport. Wenn ...
Warum kommt es bei Samsung Tizen-Telefonen immer zu Verzögerungen?
Samsung gab letzten Freitag bekannt, dass die Mark...
Ist ein Laufband zum Abnehmen nützlich?
Abnehmen ist heutzutage eine ganz normale Sache. ...
Worauf sollte man beim Klettern achten?
Klettern ist ein Sport, der gewisse Risiken birgt...
360 Nezha Internet-Automobil-„Veteran“ Zhou Hongyi zum neuen „Produktmanager“ ernannt
„Als Veteran der Internetbranche kann ich an der ...
Genießen Sie den Frühling und erfahren Sie mehr über diesen Leitfaden zur Blumenbetrachtung
Mit dem Beginn des März wird der Frühling kräftig...
Meine Eltern sind ganz verrückt danach, „durch ihre Handys zu scrollen“. Gibt es eine gute Möglichkeit, einer Sucht vorzubeugen?
Die Handysucht älterer Menschen, insbesondere ihr...
Wie kann man nach dem Training seine Nährstoffe wieder auffüllen?
Mit der allmählichen Verbesserung der Lebensbedin...
5,5-Zoll-iPhone 6 lohnt sich zu kaufen: 15 Upgrades
Als größtes iPhone aller Zeiten hat das 5,5 Zoll ...
Ist Yoga gut zum Abnehmen oder für Aerobic?
Viele Menschen haben Fragen dazu. Sie wissen nich...
Dyson gibt 2,5 Milliarden Pfund teures Elektroauto-Projekt auf, da es wirtschaftlich nicht rentabel ist
Ausländischen Medienberichten zufolge hat Dyson, ...