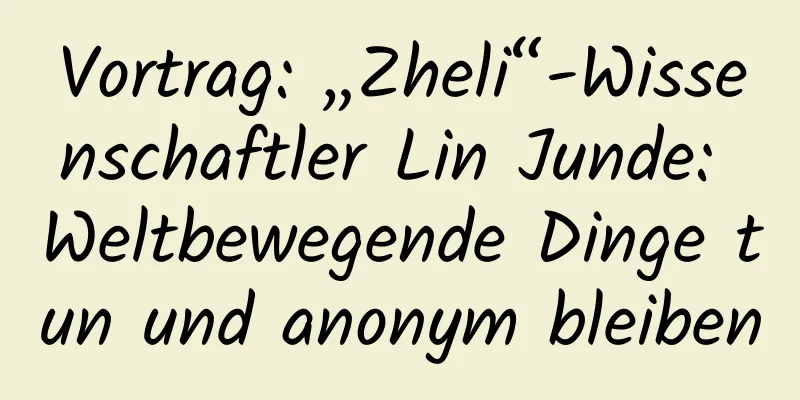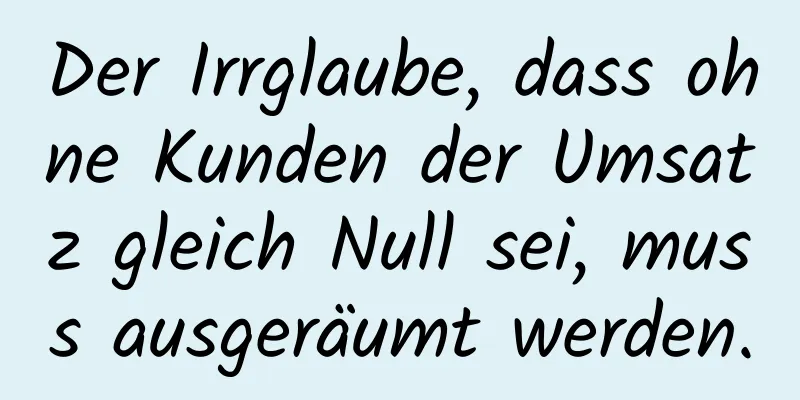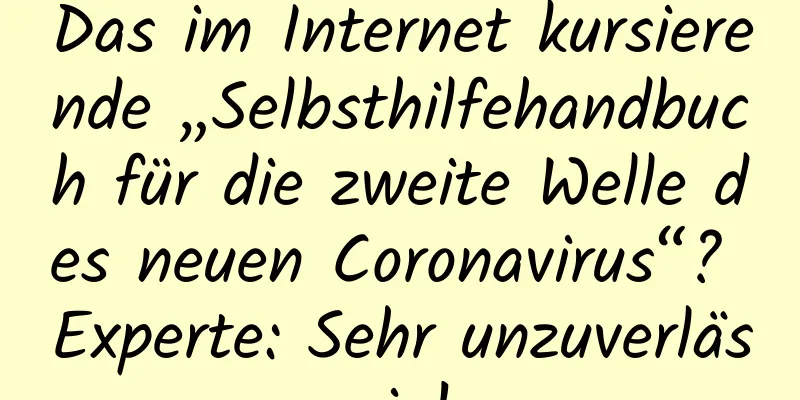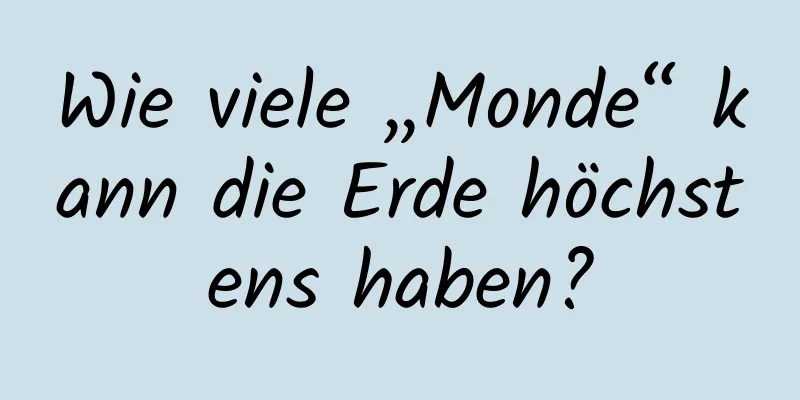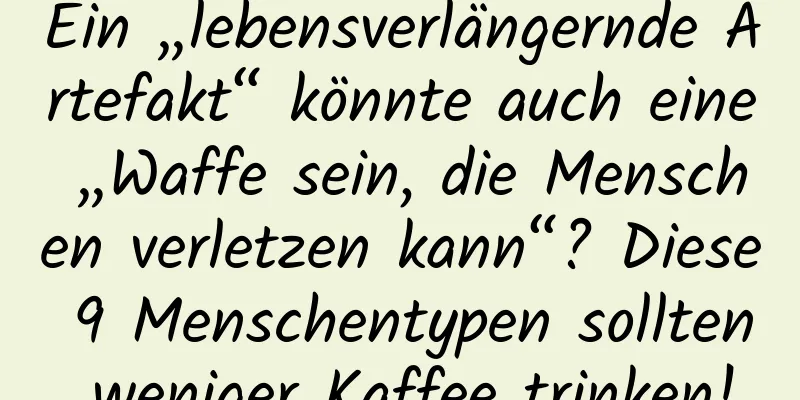Welche Tiere können den Auswirkungen des Klimawandels besser standhalten?
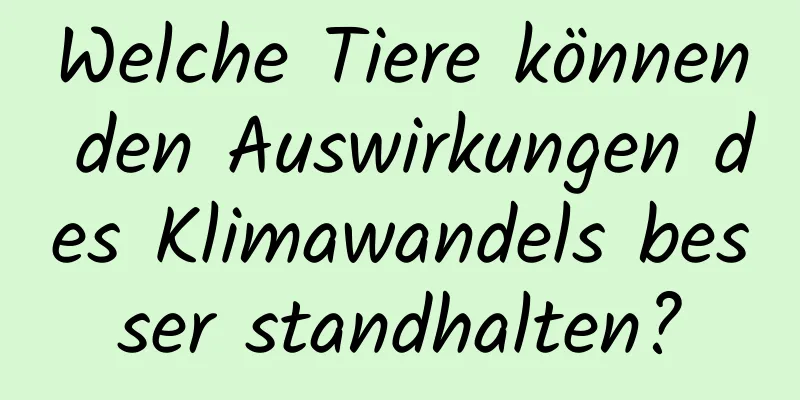
|
Der globale Klimawandel ist heute eine der Haupttriebkräfte für die Verteilung der Artenvielfalt . Um sich an den Klimawandel anzupassen, haben viele Arten ihre ursprüngliche biologische Morphologie und Verbreitung verändert. Gruppen, die sich nicht an den Klimawandel anpassen können, sind aufgrund schrumpfender Lebensräume und knapper Überlebensressourcen vom lokalen Aussterben oder sogar der völligen Ausrottung bedroht. Teil 1 Leben unter dem Klimawandel Der Klimawandel wird sich direkt auf die Morphologie der Arten auswirken. Mit zunehmender Klimaerwärmung werden die Individuen mancher Arten immer kleiner, da kleine Individuen eine relativ große Oberfläche haben (das Bergmannsche Gesetz besagt, dass bei gleichwarmen Tieren mit zunehmender Größe die relative Oberfläche, also das Verhältnis von Oberfläche zu Tiervolumen, kleiner wird, was zu einem geringeren Oberflächenstrahlungsverhältnis führt), wodurch sie Wärme besser ableiten und sich besser an die aktuelle Situation der globalen Erwärmung anpassen können. In den Appalachen ist die Größe von sechs Waldsalamanderarten in den letzten 50 Jahren um durchschnittlich 8 Prozent geschrumpft. Ebenso kam es bei drei Zugvogelarten im Nordosten der USA zu einer durchschnittlichen Verringerung der Flügellänge um 4 %. Mit zunehmender Klimaerwärmung haben die Nachkommen der Langstreckenzieher kleiner werdende Schnäbel, was die Überlebensrate der Jungvögel verringert. Der Klimawandel wirkt sich nicht nur auf Tiere, sondern auch auf Pflanzen aus: In Südaustralien hat die Breite der Keimblätter der Seifenbaumpflanze im Vergleich zu den Aufzeichnungen vor 127 Jahren abgenommen. (Bildquelle: Veer-Fotogalerie) Generell ist mit einer Größenabnahme bei steigenden Temperaturen zu rechnen. Allerdings deuten Erkenntnisse aus kalten, hochgelegenen Lebensräumen darauf hin, dass die Klimaerwärmung zu einer erhöhten Primärproduktivität und längeren Wachstumsperioden führte, was wiederum dazu führte, dass einige Tiere größer wurden, insbesondere Säugetiere wie der Amerikanische Marder und das Gelbbauchmurmeltier. Der Klimawandel hat noch weitere morphologische Auswirkungen, etwa Farbveränderungen bei Schmetterlingen, Libellen und Vögeln sowie eine auffällige Veränderung der Schädelform des Alpenstreifenhörnchens. (Bildquelle: Veer-Fotogalerie) Der Klimawandel kann sich auf die Lebensraumbedingungen von Arten auswirken und ihre Verbreitung kann sich verschieben, wenn sich die optimalen Lebensraumbedingungen ändern. In terrestrischen und aquatischen Ökosystemen breiten sich Arten in polaren oder hohen Meeren 19,7 Kilometer pro Jahrzehnt aus. Dabei legen Meeresarten mit 72 Kilometern pro Jahrzehnt die größte Distanz zurück, während sich terrestrische Arten um 6 Kilometer pro Jahrzehnt ausbreiten. Die Verteilung mariner biologischer Gruppen ändert sich schneller als die terrestrischer Organismen, da die Konnektivität der Meeresumwelt höher ist als die der terrestrischen Umwelt. In den letzten 80 Jahren haben sich die Korallen rund um das Japanische Meer mit einer Geschwindigkeit von 14 Kilometern pro Jahr bewegt. In den Gewässern vor der Südostküste Australiens bewegen sich wirbellose Gezeitenarten mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 29 Kilometern pro Jahrzehnt polwärts. (Bildquelle: Veer-Fotogalerie) Dieser Prozess bringt auch eine Reihe von Problemen mit sich. Als Nebeneffekt der Umverteilung der Arten infolge des Klimawandels wird das stillschweigende Verständnis zwischen „alten Freunden“ zerstört, bestehende Interaktionen zwischen den Arten werden zerstört und neue Interaktionen entstehen. Mit der globalen Erwärmung beginnt sich die Rotfuchspopulation in die Arktis auszubreiten und das Gebiet in der Nähe des Polarkreises wird zu einem neuen geeigneten Lebensraum. Allerdings überschnitt sich die Nordwanderung des Rotfuchses mit dem geeigneten Lebensraum des einheimischen Polarfuchses, wodurch sich die ursprüngliche Beziehung zwischen den Arten änderte. Im Vergleich zum Polarfuchs verfügt der Rotfuchs über eine stärkere Anpassungsfähigkeit. „Überleben des Stärkeren“, daher wird die ökologische Nische des Polarfuchses nach und nach verdrängt und es entsteht eine Situation, in der der Gast zum Gastgeber wird. (Bildquelle: Veer-Fotogalerie) In den Bergen der Sierra Nevada in Kalifornien stellten Wissenschaftler fest, dass es in den letzten 100 Jahren sowohl in den niedrigsten als auch in den höchsten Lagen zu starken Veränderungen der Vogelpopulationen gekommen ist. In Griechenland haben Forscher phänologische Diskrepanzen zwischen Schmetterlingen und ihren Wirtspflanzen entdeckt. Bevor die Insektenlarven bereit sind, in die Diapausenphase einzutreten, ist die Wirtspflanze bereits abgestorben und die Larven werden ohne das „Nährmedium“ unweigerlich sterben. Ebenso ergab die Analyse von 27 Jahre alten Daten zum Raubtier-Beute-Verhältnis in Großbritannien inkonsistente Veränderungen zwischen dem Waldkauz und seiner Hauptbeute, der schwarzen Wühlmaus, was wiederum zu einer geringeren Erfolgsquote der Eulenküken beim Verlassen des Nests führte. (Bildquelle: Veer-Fotogalerie) Auch der in Europa lebende Trauerschnäpper hat mit den Folgen des Klimawandels zu kämpfen. Der Klimawandel hat in Europa zu einem frühen Frühling geführt, der wiederum Klimaveränderungen für die gesamte Region mit sich brachte. Der Trauerschnäpper ist ein Zugvogel. Der Zeitpunkt seines Zuges wird durch das Klima seiner Überwinterungsgebiete bestimmt und wird durch den frühen Frühling in Europa nicht vorverlegt. Dies führt zu einer peinlichen Situation. In den vergangenen Jahren, nachdem der Trauerschnäpper in Europa angekommen war, überschnitt sich seine Brutzeit mit der schnellen Reproduktionsperiode der Raupenpopulation, sodass für seinen Nachwuchs ausreichend Nahrungsressourcen zur Verfügung standen. Allerdings ist es in Europa bereits früher Frühling und die Raupen sind vorzeitig ausgebrochen. Wenn bei den Trauerschnäppern die Brutzeit beginnt, ist die Festmahlzeit der Raupen bereits vorbei. Dies kann als eine alternative Version von „Ich wurde vor dir geboren, und du wurdest geboren, als ich schon alt war“ bezeichnet werden. Infolgedessen wurde die Population des Trauerschnäppers durch die Verschiebung von Zeit und Raum stark beeinträchtigt. Die oben zusammengefassten Belege legen nahe, dass der Klimawandel drei biologische Domänen (terrestrische, Süßwasser- und Meeresbiologie) betrifft, wobei die Auswirkungen von der genetischen bis zur biologischen Gemeinschaftsebene reichen. Von den 94 ökologischen Prozessen weltweit sind 82 % vom Klimawandel betroffen, selbst wenn die Temperatur nur um 1 °C ansteigt. Das Qinghai-Tibet-Plateau, das Dach der Welt, unterliegt einem doppelt so schnellen Wandel wie das globale Klima. In den letzten Jahren hat sich die Situation „In großen Höhen ist es wärmer“ noch verschärft. Veränderungen in den Graslandgruppen werden unweigerlich große Herausforderungen für das Überleben der Huftiere mit sich bringen. Teil 2 Wie kann die Menschheit immun gegen den Klimawandel bleiben? Welche Auswirkungen werden diese Veränderungen auf die Menschheit haben? Der Klimawandel führt zu Veränderungen der Artengröße, Phänologie und Verbreitungsgebiete, was wiederum über die Beziehungen zwischen den Arten zu Veränderungen in den Ökosystemen führt und letztlich Auswirkungen auf die Gesundheit und das Leben der Menschen hat. Die Auswirkungen des Klimawandels auf Meeresfische haben indirekte Auswirkungen auf das menschliche Leben, da sie den Menschen derzeit etwa 17 % des weltweiten Proteinbedarfs decken. Die Klimaerwärmung führt zum Schmelzen von arktischem Eis und Schnee, zu einer Zunahme des Planktons und führt darüber hinaus zu einer Zunahme der Biomasse von Kabeljau und Gelbschwanz-Seelachs. Veränderungen in der Antarktis sind noch nicht erkennbar. In der Schweiz, wo der Klimawandel doppelt so schnell voranschreitet wie die globale Erwärmung, hat sich der Forellenfang in den letzten 20 Jahren aufgrund der steigenden Temperaturen in den Gebirgsbächen halbiert. (Bildquelle: Veer-Fotogalerie) Der Klimawandel wirkt sich durch seine Auswirkungen auf die Genetik und Physiologie der Pflanzen auch auf die landwirtschaftlichen Systeme des Menschen aus. Phänologische Veränderungen durch warme Winter wirken sich auf die Ernte- und Obsterträge aus. In den letzten Jahrzehnten sind die Erträge bei Reis, Mais und Kaffee aufgrund steigender Temperaturen und zunehmender Niederschlagsschwankungen zurückgegangen. Die weltweite Weizenproduktion ist seit Anfang der 1980er Jahre um 6 % zurückgegangen. Die Klimaerwärmung führt in den landwirtschaftlichen Gebieten der gemäßigten Zonen zu weniger Kälte im Winter, verursacht aber auch eine Asynchronität im Auftreten männlicher und weiblicher Blüten, was zu einer verzögerten Bestäubung und einem Rückgang des Fruchtertrags und der Fruchtqualität führt. In manchen Ländern, wie etwa Japan, ist die Erntezeit aufgrund der frühen Knospen-, Blüten- und Fruchtbildung der Pflanzen vorverlegt. Die Bestäubung ist ein Schlüsselprozess, der sich auf den Ertrag einer großen Zahl von Nutzpflanzen auswirkt und von zahlreichen kurzlebigen, hochmobilen Insekten durchgeführt wird. In den letzten 120 Jahren sind die Bestäuberpopulationen jedoch zurückgegangen und die Bestäubernetzwerke vieler Pflanzen sind verschwunden. Dies ist eine Folge der kombinierten Auswirkungen von Lebensraumverlust, Umweltverschmutzung und einer Erwärmung des Klimas. (Bildquelle: Veer-Fotogalerie) Der Klimawandel führt zu Veränderungen auf der Ebene der Ökosysteme , wie beispielsweise dem Waldsterben, die auch offensichtliche Auswirkungen auf den Menschen haben. Mehrere in Nordamerika heimische Insektenarten sind in jüngster Zeit aufgrund von Veränderungen in ihrer Populationsdynamik zu ernstzunehmenden Krankheitserregern für Waldbestände geworden, obwohl zuvor keine ernsthaften Befalle verzeichnet wurden. Unter den bekannten Schädlingen haben der Südliche Kiefernbohrer und der Mitteleuropäische Bergkiefernbohrer in jüngster Zeit ihre Verbreitung und Befallsintensität auf Kiefern und Fichten ausgeweitet. Seit den 1960er Jahren hat sich das Verbreitungsgebiet Hunderter Pflanzenschädlinge und Krankheitserreger jährlich um zwei bis 3,5 Kilometer in Richtung der Pole verlagert, und die Zahl dieser Schädlinge dürfte in Zukunft noch weiter zunehmen. (Bildquelle: Veer-Fotogalerie) Der Klimawandel führt zu einer Zunahme von durch Vektoren übertragenen Krankheiten und schafft neue Bedrohungen für die menschliche Gesundheit. Vektoren, deren Verbreitungsgebiete sich verschoben haben, sind in Meeres-, Süßwasser- und Landsystemen zu finden. In Meeressystemen hat beispielsweise die beispiellose Erwärmung der Ostsee zu Fällen von Vibrio-Infektionen in Nordeuropa geführt. Die Mückenpopulationen nehmen zu und sie kommen heute in wärmeren Gebieten vor als in ihrem ursprünglichen Lebensraum. Mücken sind zu einem immer wirksameren Überträger von Krankheiten wie dem Denguefieber geworden und könnten in Zukunft auch zu einem noch wirksameren Überträger des neu auftretenden Zika-Virus werden. (Bildquelle: Veer-Fotogalerie) Aus dieser Perspektive kann der Klimawandel enorme Auswirkungen auf unser Leben haben! Auf globaler Ebene ist der Klimawandel allzu allgegenwärtig. Extreme Bedingungen mit hohen Temperaturen und extremer Kälte sind in der Erdgeschichte häufig und Arten können sich allmählich daran anpassen. Wenn wir den Menschen ignorieren und nur aus der Perspektive der Erde und der Arten darauf denken, besteht absolut kein Grund zur Sorge. Ganz zu schweigen von einem Temperaturanstieg von zwei Grad. Selbst bei einem Anstieg von zehn Grad wird die Erde noch existieren und nicht alle Arten auf der Erde werden vollständig ausgestorben sein. Daher dient alles, was die Menschen zur Bekämpfung des Klimawandels unternehmen, in Wirklichkeit der Rettung der Menschheit selbst. Quellen: Scheffers, BR, De Meester, L., Bridge, TC, Hoffmann, AA, Pandolfi, JM, Corlett, RT, et al., 2016. Der breite Fußabdruck des Klimawandels von Genen über Biome bis hin zu Menschen. Science 354(6313), aaf7671. https://doi.org/10.1126/science.aaf7671 Produziert von: Science Popularization China Autor: Zhao Xumao (Nachwuchsforscher, Universität Lanzhou), Zhang Xiaoqing Hersteller: China Science Expo Der Nachdruck dieses Artikels ist gestattet. Wenn Sie einen Nachdruck benötigen, wenden Sie sich bitte an den ursprünglichen Autor Der Artikel gibt nur die Ansichten des Autors wieder und repräsentiert nicht die Position der China Science Expo Bitte geben Sie die Quelle des Nachdrucks an. Der Nachdruck ohne Genehmigung ist verboten. Für Fragen zur Nachdruckgenehmigung, Zusammenarbeit und Einreichung wenden Sie sich bitte an [email protected] |
<<: Deorbiting Sails: Der „Fänger“ von Weltraumschrott
Artikel empfehlen
Eine Yoga-Pose kann Männern helfen, ihre Nieren zu ernähren
Wenn es um Methoden zur Nierenernährung geht, den...
Warum sagen wir, dass es auf der Erde Millionen von Jahren lang geregnet hat, bevor der Ozean entstand?
Die Erde ist ein mit flüssigem Wasser gefüllter P...
Ist das Lenden- und Nackenmassagegerät einfach zu bedienen?
Menschen, die in der Computerbranche arbeiten, ve...
Robin Li: Das Serienauto kommt im Juli nächsten Jahres ohne Lenkrad und Fahrersitz auf den Markt
Am 3. Dezember wurde in Wuzhen die vierte Weltint...
Kann winziges Moos dabei helfen, eine „interstellare Migration“ zu ermöglichen?
Produziert von: Science Popularization China Auto...
Was sind die Vorteile des Rollschuhlaufens?
Rollschuhlaufen ist sehr förderlich für die körpe...
Unglaublich! Er hat tatsächlich so viel durchgemacht, bevor er in den Zug gestiegen ist!
Vor einiger Zeit Baumwolle erblüht zu einem Blüte...
Ich war überrascht: Mama vergisst dich vielleicht leichter
Hat Sie vor ein paar Tagen die Nachricht bewegt, ...
Ist die Einnahme von Melatonin gegen Schlaflosigkeit sicher, wirksam und hat keine Nebenwirkungen? Tun Sie das nicht, insbesondere nicht in diesen Situationen.
Tratsch Melatonin ist ein „Wundermittel“ zur Beha...
Wenn man über Su Shi spricht, kann man nicht nur Dongpo-Schweinefleisch kennen
Dieser Artikel wurde zuerst von „Hunzhi“ (WeChat-...
91 Zehn Artikel: Teslas vierte Preiserhöhung in den USA, Apples neues Patent für autonomes Fahren enthüllt
1. Tesla hat die Preise für die US-Versionen von ...
Von China in die USA: Apropos Handy-Displayschutz
Seitdem die Menschen Mobiltelefone verwenden, gibt...
Kann Hula-Hoop beim Abnehmen helfen?
Freundinnen können ihre Taille verschlanken, wenn...
Wie kann man durch Fitness den Po straffen?
Alle Frauen möchten einen knackigen Po haben. Wen...
Wenn Sie faul sind und diese 3 Dinge nicht tun, vermehren sich mindestens 4 Arten von Krankheitserregern in Ihrem Kühlschrank! Der richtige Ansatz ist ...
Ein kalter und luftdichter Kühlschrank ist für di...