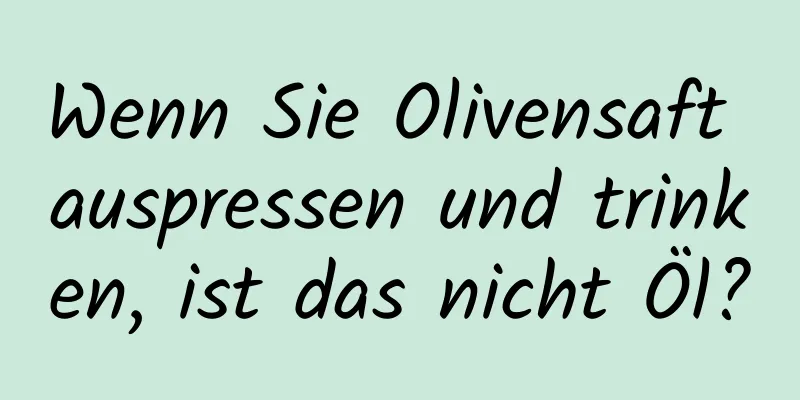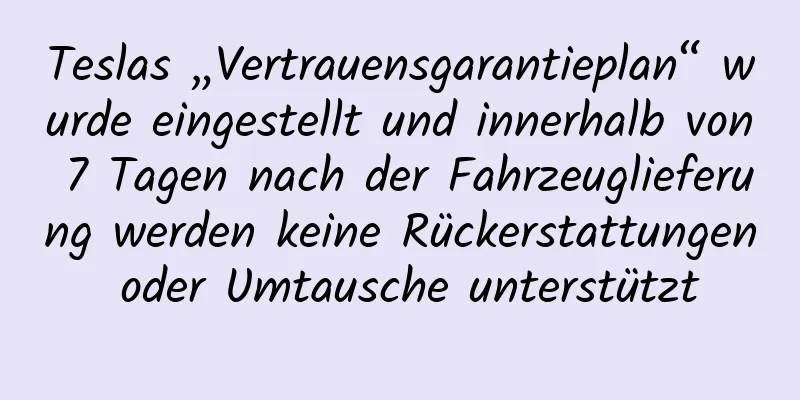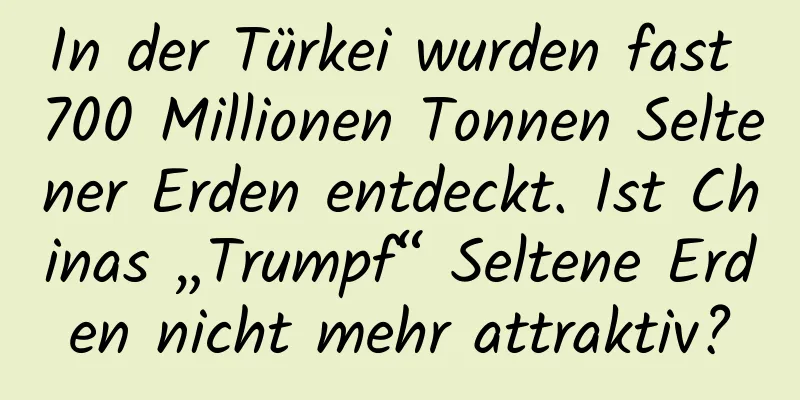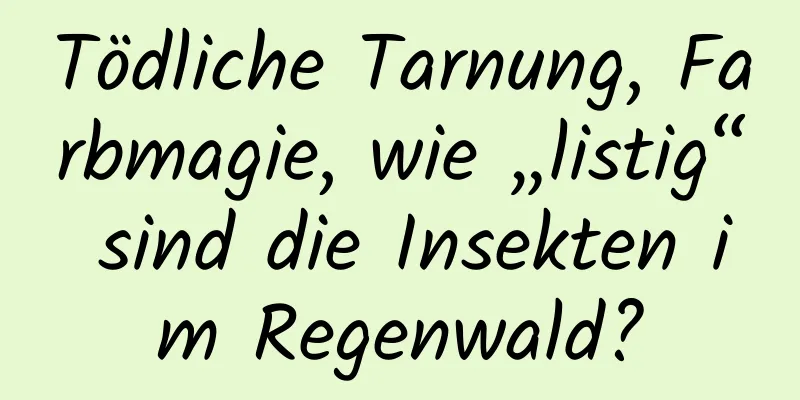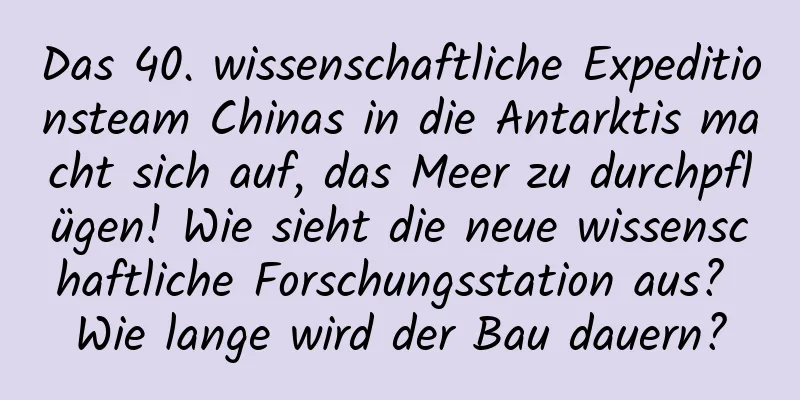Wir könnten das Geheimnis zur Krebsvorbeugung bei Elefanten und Blauwalen entdecken
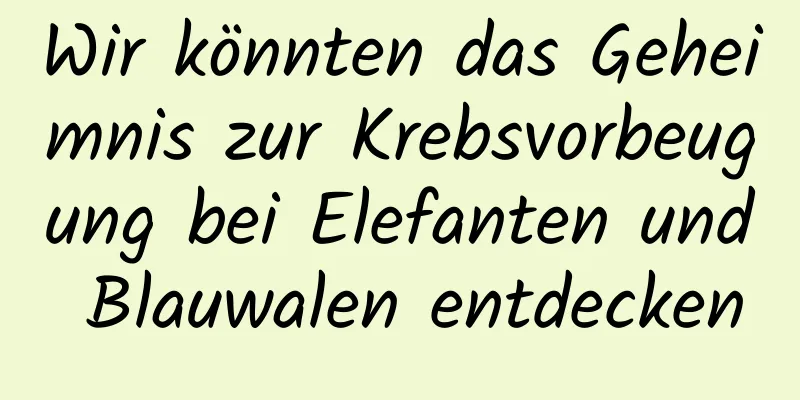
|
Krebs ist im Wesentlichen eine Krankheit, die durch Genmutationen verursacht wird. Bestimmte Mutationen können dazu führen, dass Zellen ihre normale Wachstums- und Teilungskontrolle verlieren und Krebszellen entstehen. Bei jeder Zellteilung besteht das Risiko einer Mutation. Theoretisch gilt: Je größer das Tier, desto mehr Zellen hat sein Körper und desto häufiger teilen sich die Zellen. Daher sollte die Wahrscheinlichkeit einer Mutation höher sein. Allerdings sind Elefanten, die um ein Vielfaches größer sind als Menschen, nicht so anfällig für Krebs. Warum ist das so? Teil 1 TP53 – der Wächter des Genoms Der Epidemiologe Richard Peto erkannte dieses Paradoxon erstmals in den 1970er Jahren : Die Häufigkeit von Krebs scheint nichts mit der Anzahl der Zellen eines Organismus zu tun zu haben . Dieses Paradoxon wird „Peto-Paradoxon“ genannt. Schematische Darstellung des Peto-Paradoxons: Wie erwartet besteht eine lineare Beziehung zwischen Krebshäufigkeit und Körpergröße (orange Linie); Tatsächlich besteht kein Zusammenhang zwischen der Krebshäufigkeit und der Körpergröße (blaue Linie). (Bildquelle: Referenz [9]) Wissenschaftler erklären die Langlebigkeit von Elefanten aus genetischer Sicht. Bei der Untersuchung der Elefantengene stellten Wissenschaftler fest, dass Elefanten bis zu 20 Kopien des TP53-Gens besitzen, während Menschen und die meisten anderen Tiere nur eine Kopie des TP53-Gens haben. Das vom TP53-Gen kodierte p53-Protein spielt eine lebenswichtige Rolle in Zellen und ist als „Wächter des Genoms“ bekannt. Das Protein p53 „überwacht“ ständig die DNA der Zelle, um sicherzustellen, dass bei der Zellteilung keine Fehler auftreten. Es ist im Wesentlichen für folgende drei Aufgaben zuständig: 1. Wenn die DNA von Zellen beschädigt ist, verhindert das Protein p53 die Zellteilung und aktiviert andere Gene, um den DNA-Schaden zu reparieren. 2. Wenn DNA-Schäden nicht sofort repariert werden können, kann p53 den Zellzyklus unterbrechen und den Zellen mehr Zeit geben, den Schaden zu reparieren. 3. Wenn der DNA-Schaden zu schwerwiegend ist, um repariert zu werden, löst das p53-Protein das Selbstzerstörungsprogramm der Zelle aus – die Apoptose. Dadurch wird das weitere Wachstum und die Teilung der beschädigten Zellen verhindert und die Entstehung von Krebs verhindert. Struktur des p53-Proteins (Bildquelle: Wikimedia) Daher könnten die zahlreichen Kopien des TP53-Gens bei Elefanten dazu führen, dass sie über bessere Fähigkeiten zur Reparatur von DNA-Schäden und Mechanismen zur Zellapoptose verfügen, was ein wichtiger Faktor für die geringere Krebsrate bei Elefanten sein könnte. Dieser Mechanismus ist wissenschaftlich als „verstärkte Tumorsuppression“ bekannt . Teil 2 Das zusätzliche TP53-Gen bei Elefanten ist möglicherweise nicht für Langlebigkeit gedacht Ein kürzlich in der Fachzeitschrift „Trends in Ecology and Evolution“ veröffentlichter Bericht erläuterte weitere Gründe, warum Elefanten weniger anfällig für Krebs sind. Die Autoren stellten die Hypothese auf, dass die Lage der Hoden von Elefanten mit dem Vorhandensein mehrerer Kopien des TP53-Genkomplexes in ihrem Körper zusammenhängen könnte. Generell muss die Umgebungstemperatur für die Spermienproduktion bei Säugetieren 2–4 Grad Celsius unter der Körpertemperatur liegen. Beispielsweise beträgt die Körperkerntemperatur einer Maus 36,6 Grad Celsius, während ihre Hoden 34 Grad Celsius erreichen. Aus diesem Grund liegen die Hoden vieler Säugetiere außerhalb des Körpers, im Hodensack. Die Hoden des Elefanten liegen jedoch im Körperinneren und ihre Temperatur liegt nahe an der Körpertemperatur. Studien haben gezeigt, dass die Effizienz der Spermienproduktion in einer Umgebung mit etwas höheren Temperaturen stark abnimmt und sogar Genmutationen verursachen kann. Daher kann sich die höhere Körpertemperatur negativ auf die Spermienqualität auswirken. Die Zunahme der Anzahl der TP53-Gene bei Elefanten ist möglicherweise nicht auf eine selektive Evolution zur Bekämpfung von Krebs im Körper (d. h. in Nicht-Keimzellen) zurückzuführen, sondern dient möglicherweise dem Schutz von Keimzellen – Spermien. Gerade diese hohen Temperaturen können zu DNA-Schäden führen, die die mehrfache Replikation des TP53-Gens im Körper des Elefanten stimulieren und so die Teilung und Ausbreitung der beschädigten Zellen verhindern. Infrarot-Wärmebild eines Elefantenbabys. Der Pfeil zeigt die Lage der Hoden. (Bildquelle: Referenz [2]) Auf den afrikanischen Graslandschaften sind Elefanten lange Zeit dem Sonnenlicht ausgesetzt, wodurch ihre Hauttemperatur steigt und ihr Stoffwechsel Wärme erzeugt. Bei den tonnenschweren Elefanten entsteht durch Muskelaktivität, etwa langsames Gehen oder Bergaufgehen, Wärme. Die Temperatur ihrer Hoden kann mit ihrer Körperkerntemperatur übereinstimmen, also etwa 36–37 Grad Celsius. Der Grund für diese Annahme liegt darin, dass aufgrund der Zellerneuerung und des Zellaustauschs der Selektionsdruck auf Keimbahnmutationen größer ist als auf somatische Zellmutationen. Dies bedeutet, dass Mutationen in Keimzellen die Evolution eines Individuums eher beeinflussen, da sie an die Nachkommen weitergegeben werden können, während dies bei Mutationen in somatischen Zellen nicht der Fall ist. Mit anderen Worten: Die Erhöhung der Anzahl der TP53-Gene bei Elefanten dient dem Schutz der Fortpflanzungszellen, und die krebshemmende Wirkung ist möglicherweise nur ein Nebeneffekt. Teil 3 Langlebigkeit erfordert manchmal Opfer Wale sind ebenfalls große und langlebige Tiere, aber im Gegensatz zu Elefanten besitzen sie nur eine Kopie des TP53-Gens. Was ist also der Grund für ihre Langlebigkeit? Der Grönlandwal (Balaena mysticetus) ist ein Meeressäugetier aus der Familie der Glattwale, das in kalten arktischen und subarktischen Gewässern lebt. Grönlandwale gelten als die langlebigsten Walarten, die bisher bekannt sind. Ihre Lebenserwartung beträgt mehr als 211 Jahre und liegt damit weit über der durchschnittlichen Lebenserwartung anderer Wale, die etwa 60 Jahre beträgt. Die Langlebigkeit der Grönlandwale ist größtenteils auf eine Reihe einzigartiger biologischer Mechanismen in ihrem Körper zurückzuführen, die ihnen helfen, Krebs, Immunalterung, Herz-Kreislauf- und zerebrovaskulären Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen und neurodegenerativen Erkrankungen zu widerstehen. Insbesondere im Hinblick auf die Krebsprävention haben Grönlandwale sehr wirksame Antitumormechanismen gezeigt. Skelett eines Grönlandwals (Bildquelle: Wikimedia) Ein Forschungsteam der University at Buffalo und der State University of New York hat eine eingehende Studie zu den Faktoren durchgeführt, die die Lebensdauer von Grönlandwalen beeinflussen. Sie fanden heraus, dass sich Grönlandwale und Glattwale vor etwa 4 bis 5 Millionen Jahren in zwei verschiedene Arten aufspalteten und dass Grönlandwale im Laufe der Evolution ein einzigartiges Genom entwickelten. Diese spezielle Gengruppe kodiert eine speziesspezifische reverse Transkriptase namens Cyclin-abhängiges Kinase-Inhibitor-Gen (CDKN2C). Dieser Gensatz wird im Gewebe der Grönlandwale stark exprimiert und verlangsamt die Zellteilungsrate, sodass jeder Zelle mehr Zeit bleibt, erlittene Schäden zu reparieren. Auf diese Weise können Zellen mehr Zellen mit denselben Reparaturgenen produzieren und so das Krebsrisiko senken. Dieses einzigartige genetische Merkmal könnte einer der Schlüsselfaktoren für die Langlebigkeit der Grönlandwale sein. Dieser Mechanismus zur Krebsbekämpfung und Lebensverlängerung wirkt sich jedoch negativ auf die Fruchtbarkeit männlicher Grönlandwale aus. Das Vorhandensein des CDKN2C-Gens führt dazu, dass die Hoden männlicher Grönlandwale schrumpfen, was die Spermienproduktion beeinträchtigt. In absoluten Zahlen wiegen die Hoden des Grönlandwals bis zu 200 Kilogramm, was im Vergleich zu denen eines gewöhnlichen Mannes zweifellos riesig ist. Allerdings sind die Hoden des Grönlandwals winzig, wenn man sie mit dem Gewicht ihres nahen Verwandten, des Glattwals vergleicht, der bis zu 1.000 Kilogramm wiegen kann, also fünfmal so viel. Im Laufe der Evolution haben Grönlandwale offenbar eine Überlebensstrategie gewählt, die es ihnen ermöglicht, länger zu leben, auch wenn dies bedeutet, dass ihre Hoden kleiner werden und ihre Fruchtbarkeit leidet. Millionen Jahre evolutionärer Selektion haben es Grönlandwalen ermöglicht, über 200 Jahre alt zu werden, was ebenfalls ein Beweis für die Vielfalt des Lebens und die Vielfalt der Überlebensstrategien ist. Grönlandwal (Bildquelle: Wikimedia) Teil 4 Die Geheimnisse anderer Tiere für ein langes Leben Tatsächlich gibt es im Tierreich viele Lebewesen mit einer recht langen Lebensspanne, und ihre Langlebigkeitsmechanismen sind unterschiedlich, was für die wissenschaftliche Forschung der Biologen wertvolles Referenzmaterial darstellt. Der Nacktmull ist ein Säugetier, das im Durchschnitt nur 35 Gramm wiegt, aber bis zu 35 Jahre alt werden kann, eine für kleinere Nagetiere sehr seltene Lebenserwartung. Nach einer Langzeitstudie an Nacktmullen stellten Wissenschaftler fest, dass ihre Sterblichkeitsrate und ihr Krebsrisiko mit dem Alter nicht ansteigen. Dieses Phänomen kann teilweise auf die Hemmmechanismen zurückgeführt werden, die sie schon früh entwickeln. Sie verfügen über ein einzigartiges Protein, pALTINK4a/b, das eine wichtige Rolle bei der Verhinderung von Zellüberwucherung und Krebsbildung in Gegenwart von Hyaluronan mit hohem Molekulargewicht (HMW-HA) spielt, was ihre Lebensdauer verlängern kann. Kleine Braune Fledermäuse sind zwar klein, haben aber eine sehr lange Lebensdauer. Dies hängt mit der Telomerdynamik und den Reparaturmechanismen von Wachstumsfaktor-bezogenen Genen in ihrem Körper zusammen. Diese Reparaturmechanismen verhindern wirksam altersbedingte DNA-Schäden und tragen so dazu bei, die Lebensdauer der Kleinen Braunen Fledermäuse zu verlängern. Grönlandhaie (Somniosus microcephalus) können bis zu 400 Jahre alt werden, möglicherweise sogar mehr als 500 Jahre. Sie leben in kalten Tiefseeumgebungen, was zu ihrer Langlebigkeit beitragen könnte. Die Stoffwechselrate von Organismen hängt normalerweise von der Umgebungstemperatur ab: Je niedriger die Temperatur, desto langsamer die Stoffwechselrate. Daher kann die niedrige Stoffwechselrate des Grönlandhais dazu beitragen, den Verschleiß seines Körpers zu verringern und seine Lebensdauer zu verlängern. Die Langlebigkeit dieser Organismen liefert Wissenschaftlern, die die Mechanismen des Alterns und Strategien zur Verlängerung der Lebensdauer untersuchen, wertvolle Erkenntnisse. Teil 5 Abschluss Im Laufe der Evolution der Organismen wurden viele „Geheimnisse“ zur Krebsresistenz und Lebensverlängerung entdeckt. Diese Langlebigkeitsmechanismen dienen Wissenschaftlern als Referenz für die weitere Erforschung des genetischen Codes von Organismen. Vielleicht werden wir in naher Zukunft über mehr Waffen zur Bekämpfung von Krankheiten und Alterung verfügen. Quellen: 1. Keane M, Semeiks J, Webb AE, et al. Einblicke in die Evolution der Langlebigkeit anhand des Genoms des Grönlandwals[J]. Cell reports, 2015, 10(1): 112-122. 2. Vollrath F. Entkopplung von Elefanten-TP53 und Krebs[J]. Trends in Ökologie und Evolution, 2023. 3. Vazquez JM, Kraft M, Lynch V J. Eine CDKN2C-Retroduplikation bei Grönlandwalen ist mit der Entwicklung einer extrem langen Lebensdauer und einer aktivierten Zellzyklusdynamik verbunden[J]. bioRxiv, 2022. 4. Padariya M, Jooste ML, Hupp T, et al. Der Elefant entwickelte p53-Isoformen, die der mdm2-vermittelten Unterdrückung und dem Krebs entgehen[J]. Molekularbiologie und Evolution, 2022, 39(7): msac149. 5. Sulak M, Fong L, Mika K, et al. Die Erhöhung der TP53-Kopienzahl ist mit der Entwicklung einer größeren Körpergröße und einer verstärkten Reaktion auf DNA-Schäden bei Elefanten verbunden[J]. elife, 2016, 5: e11994. 6. Nunney L. Der wahre Krieg gegen den Krebs: die evolutionäre Dynamik der Krebsunterdrückung[J]. Evolutionäre Anwendungen, 2013, 6(1): 11-19. 7. Abegglen LM, Caulin AF, Chan A, et al. Mögliche Mechanismen der Krebsresistenz bei Elefanten und vergleichende zelluläre Reaktion auf DNA-Schäden beim Menschen[J]. Jama, 2015, 314(17): 1850-1860. 8. Tejada-Martinez D, De Magalhães JP, Opazo J C. Positive Selektion und Genduplikationen in Tumorsuppressorgenen liefern Hinweise darauf, wie Wale Krebs widerstehen[J]. Proceedings of the Royal Society B, 2021, 288(1945): 20202592. 9. Tollis, M., Boddy, AM & Maley, CC Petos Paradoxon: Wie hat die Evolution das Problem der Krebsprävention gelöst? BMC Biol 15, 60 (2017). 10. Tian, Xiao, et al. „Der INK4-Locus des tumorresistenten Nagetiers, des Nacktmulls, exprimiert eine funktionelle p15/p16-Hybridisoform.“ Proceedings of the National Academy of Sciences 112.4 (2015): 1053-1058. Produziert von: Science Popularization China Autor: Denovo Team Hersteller: China Science Expo Dieser Artikel gibt nur die Ansichten des Autors wieder und repräsentiert nicht die Position der China Science Expo Dieser Artikel wurde zuerst in der China Science Expo (kepubolan) veröffentlicht. Bitte geben Sie beim Nachdruck die Quelle des öffentlichen Kontos an |
<<: Wer gut Pilze isst, kommt früher ins Paradies?
>>: Shennongjia-Nationalpark: Ein Naturwunderland auf 31° nördlicher Breite
Artikel empfehlen
Wie groß war die Energie des Urknalls? Eine unglaubliche Wahrheit ableiten
Ein Freund hat mich gebeten, diese Frage zu beant...
Wird die Begeisterung der Giganten des Silicon Valley für AR in Zukunft Mobiltelefone verdrängen?
„Wenn Sie heute eines mitnehmen“, sagte Facebook-...
#万千IP创科学热门# Schauen Sie sich einfach die Beine an und Sie werden es wissen? Die Minnan zeigen Ihnen, wie Sie die „drei Kopffüßerbrüder“ unterscheiden.
📙Lesetipps: Der Inhalt stammt aus dem Wörterbuch ...
Eine einfache Maßnahme kann das zukünftige Sterberisiko senken! Wer es nicht in 10 Sekunden schafft, sollte aufpassen
In den vom National Physical Fitness Monitoring C...
Die College-Aufnahmeprüfung ist vorbei. Diese 6 Dinge sollten Sie Ihren Kindern nicht antun!
Die intensive Hochschulaufnahmeprüfung ist endlic...
Kameras zu Hause installieren? Nicht empfohlen
In letzter Zeit ist das Thema #Polizei empfiehlt,...
Wie trainiert man die Brustmuskulatur am besten?
Wenn Sie Brustmuskeln aufbauen möchten, gibt es M...
Sie können kein Vitamin C kaufen? Keine Panik, diese Lebensmittel enthalten sehr viel Vitamin C!
Mit der Lockerung der neuen Richtlinien zur Seuch...
Kulturnachrichten: Guzheng + Mode, was lässt die chinesische Kultur „den Kreis durchbrechen“?
„Junge Leute, habt keine Angst. Wenn ihr bereit s...
Worauf sollten Sie beim Schwimmen achten?
Der Sommer ist da und bringt uns Hitze und glühen...
Spinat ist keine zuverlässige Eisenquelle, aber diese Nährstoffe sind ziemlich gut!
Autorin: Xue Qingxin, staatlich anerkannte Ernähr...
Wie man an Gewicht und Muskeln zunimmt
Manche Menschen sind aus bestimmten Gründen dünn ...
Essen Sie es vor dem Training und der Gewichtsverlusteffekt wird um ein Vielfaches gesteigert!
Bewegung ist die bevorzugte Methode, um auf gesun...
Warum wird Ihr Telefon langsamer, je mehr Sie es benutzen? Vielleicht liegt es an diesen kleinen Eingriffen im Alltag.
Planung und Produktion Quelle: Neugieriger Doktor...