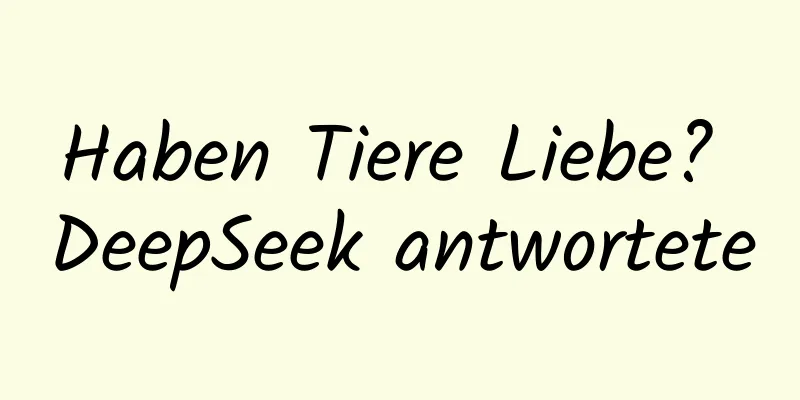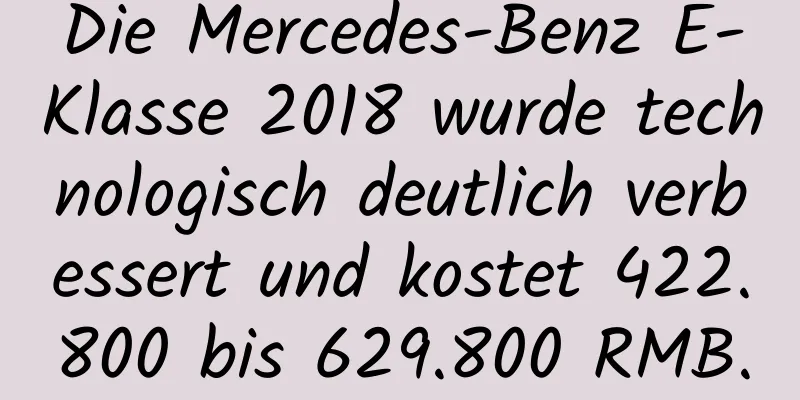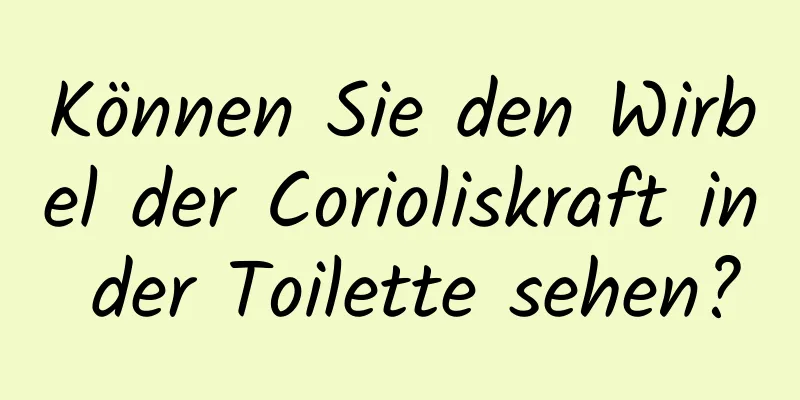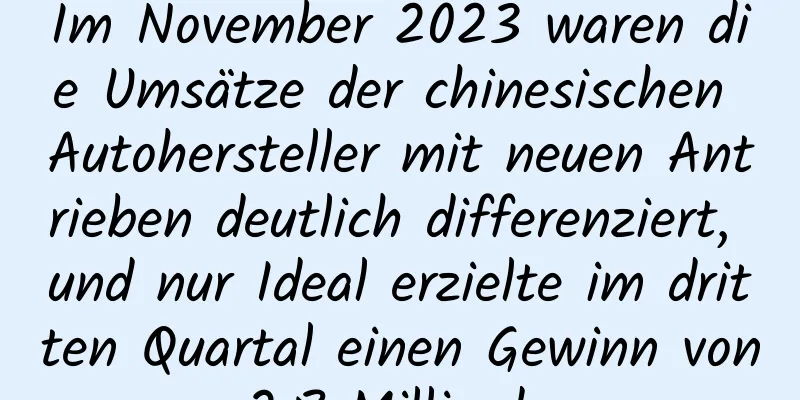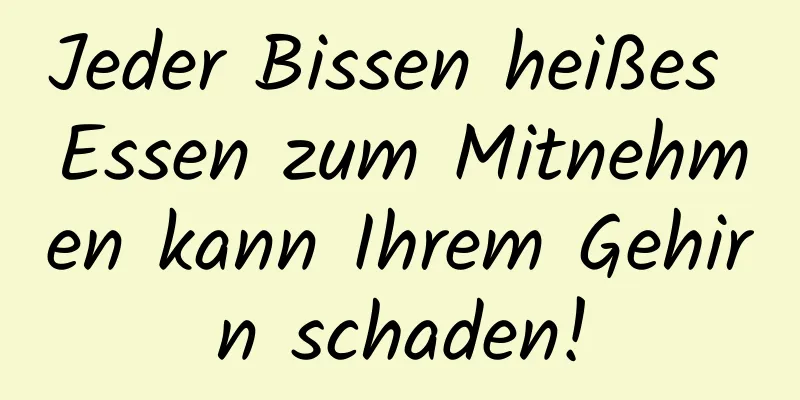Es gibt noch mehr Weltraumschrott, der beseitigt werden muss. Was sollen wir tun?
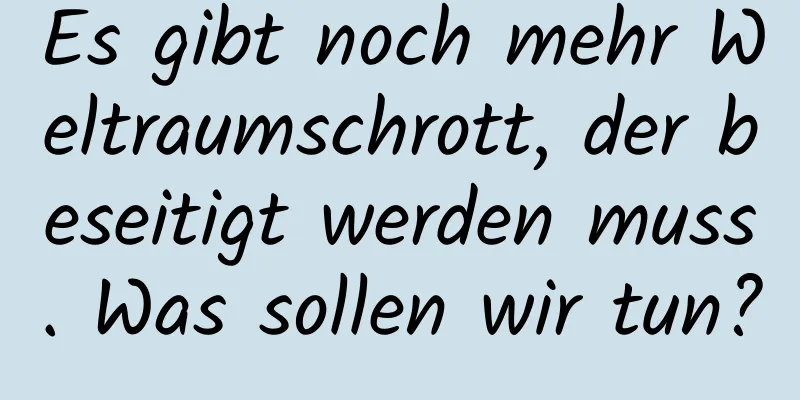
|
Kürzlich gab die Europäische Weltraumorganisation bekannt, dass sie ursprünglich geplant hatte, im Jahr 2026 ein aktives Weltraumschrott-Beseitigungsfahrzeug ins All zu schicken, um dort ein Stück Weltraumschrott zu beseitigen. Doch unerwarteterweise wurde in der Nähe weiterer Weltraumschrott gefunden, von dem man vermutet, dass er durch die Kollision dieses Weltraumschrottstücks verursacht wurde. Welchen Herausforderungen könnten die entsprechenden Missionen der ESA gegenüberstehen? Wie steht es um die Beseitigung von Weltraumschrott und die Verlangsamung der Weltraummüllvermehrung? Welchen Einfluss hat dies auf die Überlegungen der ESA? Ein Unfall ereignete sich vor der Ausbildung Der Grund, warum die unerwartete Zunahme des Weltraummülls die Aufmerksamkeit der ESA erregte, liegt vor allem darin, dass die ESA dieses Stück Weltraumschrott schon seit vielen Jahren im Auge hat. Entstanden ist dieses Stück Weltraumschrott im Jahr 2013. Damals wurde, nachdem die Vega-Rakete der ESA ihre zweite Satellitenstartmission abgeschlossen hatte, eine Satellitenhalterung in der Umlaufbahn zurückgelassen. Es war zugleich das Oberteil des Nutzlastadapters der Vega-Rakete. Die Gesamtform war konisch, mit einem Durchmesser von etwa 2,1 Metern, einer Höhe von etwa 1,3 Metern und einer Masse von etwa 112 Kilogramm. Derzeit befindet sich die Halterung in der Erdumlaufbahn ungefähr in einer Höhe von 800 km × 660 km. Es hat eine relativ einfache Form und eine starke Struktur. Daher wird es von der ESA als „äußerst geeignetes“ Einfangziel für die Durchführung aktiver Missionen zur Beseitigung von Weltraummüll eingestuft. Im Dezember 2020 unterzeichnete die ESA mit dem Industrieteam des Schweizer Unternehmens Clean Space einen Vertrag im Wert von 86 Millionen Euro zur Beschaffung des einzigartigen Clean Space-1-Dienstes. Vereinfacht ausgedrückt wird im Rahmen der Mission ein Weltraumroboter gestartet, der sich der Satellitenhalterung nähert, diese mithilfe von vier Roboterarmen einfängt und sie dann in die Erdatmosphäre zieht, wo sie verglüht. Dabei nutzt der Weltraumroboter künstliche Intelligenz, um die Zielsituation selbstständig einzuschätzen und die Bewegung anzupassen. Die Erfassung erfolgt unter Aufsicht der ESA. Roboterarme werden voraussichtlich zu einem wirksamen Mittel für Raumfahrzeuge werden, um Weltraummüll zu beseitigen Die Systemstruktur dieses Weltraumroboters ist relativ komplex und wurde von vielen westlichen Luft- und Raumfahrtunternehmen entwickelt: Das Antriebssubsystem dient dazu, ihn zu präzisen und stabilen Umlaufbahnänderungen und zur Annäherung an das Ziel anzutreiben; Das fortschrittliche „Nervensystem“ unterstützt bei der Planung des Missionsverlaufs und steuert direkt die elektronische Ausrüstung hinter den vier Roboterarmen. Das integrierte Sensorsystem umfasst ein Langstreckenradarsystem und zwei Mikrokameras, die nicht nur zur Navigation und Positionierung sowie zur Zielerkennung verwendet werden, sondern auch die notwendige visuelle Unterstützung bei der Zielerfassung bieten. Das Prozessorpanel hilft der künstlichen Intelligenz und dem hinteren Team, Zielbilder zu analysieren und zeitnahe und effiziente Entscheidungen zu treffen. Um die Zuverlässigkeit der Mission zu gewährleisten, wird der Weltraumroboter über eine Verbundstruktur und ein effizientes Wärmekontrollsystem verfügen. Man kann sagen, dass dies die erste Mission in der Geschichte der Weltraumforschung sein wird, bei der Weltraummüll durch präzise, komplexe Operationen aus nächster Nähe aus der Umlaufbahn entfernt wird. Anschließend hofft die ESA, komplexere und ehrgeizigere Ziele bei der aktiven Entfernung von Weltraumschrott zu erreichen, den Schwierigkeitsgrad der Mission kontinuierlich zu erhöhen und schließlich die Entfernung mehrerer Ziele in einem einzigen Start zu erreichen. Nach Einschätzung der ESA führte die jüngste versehentliche Kollision mit Weltraummüll zum Verlust einer kleinen Menge an Satellitenhalterungshardware und wird keine wesentlichen Auswirkungen auf die Durchführung der Clean Space-1-Mission haben. Da die Mission jedoch von der Intaktheit der Zielhardware abhängt, führt die ESA eine Bewertung durch, die mindestens mehrere Wochen dauern wird, um die nächsten Schritte festzulegen. Aus einer anderen Perspektive verdeutlicht dieser Unfall die gefährliche Aussicht auf eine „Verbreitung“ von Kollisionen mit Weltraumschrott. Der amerikanische Raumfahrtexperte Donald Kessler hat bereits in den 1970er Jahren den „Kessler-Effekt“ beschrieben. Dieser besagt, dass, wenn die Menge an Weltraummüll einen bestimmten kritischen Punkt erreicht, dies eine Kette von Kollisionen in der Erdumlaufbahn auslöst, die dann nicht mehr von Menschen kontrolliert werden können und letztendlich dazu führen können, dass der Weltraum um die Erde mit Müll gefüllt wird, den der Mensch nicht mehr sicher nutzen kann. Aktive Entfernung ist dringender Da es sich bei dem Weltraummüllproblem um ein internationales Problem handelt, initiierten die Vereinigten Staaten, Russland, Japan und andere Parteien 1993 gemeinsam die Einrichtung eines Inter-Agency Space Debris Coordination Committee, dessen Ziel darin besteht, die gemeinsamen Weltraumaktionen verschiedener Länder zu koordinieren und das Weltraummüllproblem gemeinsam zu lösen. Seitdem sind die Länder zunehmend besorgt über das Thema Weltraummüll und haben eine Reihe von Lösungen vorgeschlagen, um der Bedrohung durch Weltraummüll zu begegnen. Weltraumschrott hat in den letzten Jahren rasant zugenommen Einerseits werden Schutzmaßnahmen für das Raumfahrzeug selbst ergriffen, die hauptsächlich drei Situationen umfassen: Bei Weltraummüll, der kleiner als 1 cm ist, können sich Satelliten und andere Raumfahrzeuge auf Strukturen, Materialien und notwendige Schutz- und Verstärkungsmaßnahmen verlassen, um „festzuhalten“. bei Weltraumschrott von 1 bis 10 cm Größe haben die Länder unterschiedliche Vorstellungen zur Lösung des Problems; Bei größeren Trümmern über 10 cm muss das Bodenteam jederzeit aufmerksam sein, anhand der Bahntrends von Raumfahrzeug und Weltraummüll rechtzeitig die Wahrscheinlichkeit einer Kollision zwischen Raumfahrzeug und Trümmern berechnen und bei Erreichen des Warnwerts das Raumfahrzeug Ausweichmanöver durchführen lassen. Andererseits hoffen wir, das Problem des Weltraummülls an der Quelle zu lösen und die Weltraumumgebung aktiv zu verbessern. Nach vorläufiger Analyse umfassen die relevanten technischen Maßnahmen hauptsächlich drei Kategorien: Passivierungsbehandlung, aktives Deorbit und aktive Entfernung. Unter Passivierung versteht man den Prozess, bei dem Treibstoff, Batterieleistung usw. eines ausgemusterten Raumfahrzeugs im Voraus entladen werden, um eine zukünftige Explosion zu verhindern. Es ist anzumerken, dass sich seit langem jedes Jahr durchschnittlich mehr als 12 Unfälle ereignen, bei denen Raumfahrzeuge im Orbit zerfallen. Von den etwa 550 bekannten Unfällen dieser Art verursacht der Zerfall nicht passivierter Raumfahrzeuge die meisten Trümmer. Aktives Deorbit bedeutet, dass ein Raumfahrzeug seine eigenen Triebwerke, Ballons, Lichtsegel usw. verwendet, um seine Arbeitsumlaufbahn zu verlassen. Satelliten in erdnahen Umlaufbahnen werden in die Atmosphäre abgesenkt und verglühen dort, während Satelliten in geostationären Umlaufbahnen in eine „schwere Umlaufbahn“ gehoben werden. Dadurch werden normal funktionierende Raumfahrzeuge vor dem Einschlag durch Trümmer geschützt oder das Risiko eines versehentlichen Aufpralls zumindest erheblich verringert. Für die aktive Entfernung ist im Allgemeinen der Start eines speziellen Raumfahrzeugs erforderlich, um größere Weltraumtrümmer mithilfe von Methoden wie dem Einfangen mit einem Roboterarm, einem Netzsack oder einer „Harpune“ einzufangen. Anschließend startet das spezielle Raumfahrzeug die Energiezufuhr, um die Weltraumtrümmer aus der Umlaufbahn zu holen. Es ist nicht schwer zu erkennen, dass sowohl die Passivierungsbehandlung als auch die aktiven Deorbit-Maßnahmen erfordern, dass das Raumfahrzeug mit entsprechender Hardware ausgestattet wird oder mehr Treibstoff mitgeführt wird, was kostspielig ist und Zuverlässigkeitsrisiken birgt. Gemäß internationalen Richtlinien müssen Betreiber Raumfahrzeuge innerhalb von 25 Jahren nach Beendigung ihrer Mission aus der erdnahen Umlaufbahn entfernen, doch in Wirklichkeit tun dies nur 60 % der Missionsbetreiber. Daher ist die aktive Entfernung ein wirksames Mittel zur Beseitigung großer Mengen Weltraummüll. Die ESA will die Führung übernehmen Die EU verfügt im Bereich Umweltschutz über eine starke öffentliche Meinung, sodass die Beseitigung des Weltraummülls schon sehr früh breite Unterstützung fand. Im Jahr 2002 veröffentlichten verschiedene Parteien die „Guidelines for Space Debris Mitigation“ und die ESA veröffentlichte gleichzeitig die „European Space Debris Safety and Removal Standards“. Im Jahr 2004 unterzeichneten Italien, das Vereinigte Königreich, Frankreich und Deutschland gemeinsam den Europäischen Verhaltenskodex zur Eindämmung von Weltraummüll. Im Jahr 2014 erließ die ESA eine Durchführungsverordnung zur Politik zur Eindämmung von Weltraummüll. Im Jahr 2015 veröffentlichte die ESA die Leitlinien zur Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften zur Eindämmung von Weltraummüll, die spezifische Überprüfungsmethoden und Maßnahmen zur Eindämmung von Weltraummüll enthielten. In den letzten Jahren hat die ESA jedes Jahr regelmäßig Berichte zur Weltraumumgebung veröffentlicht, in denen die Auswirkungen des globalen Weltraumverhaltens auf die Weltraumumgebung und die Wirksamkeit internationaler Maßnahmen zur Eindämmung von Weltraummüll bewertet wurden. Darüber hinaus hat das Unternehmen seine zukünftigen Nachhaltigkeitsziele im Weltraum öffentlich bekannt gegeben: Bis 2030 wird es über eine Raumfahrzeug-„Flotte“ verfügen, die der Bedrohung durch Weltraummüll standhalten kann; über die Fähigkeit verfügen, den „Weltraumverkehr“ zu überwachen und sicher zu steuern, einschließlich der Reinigung oder Entsorgung von im Orbit vorhandenem Weltraummüll; und entwickeln automatische Kollisionsvermeidungssysteme für Raumfahrzeuge, um die Entstehung neuen Weltraumschrotts zu vermeiden. Konkret hat die ESA im Jahr 2012 Satellitenhersteller aus der EU zusammengebracht, um Missionsdemonstrationen und Technologieentwicklungen zur Entfernung von Weltraummüll durchzuführen, mit dem Ziel, außer Kontrolle geratene Umweltsatelliten zu entfernen. Zu den in Betracht gezogenen aktiven Entfernungstechnologien gehörten Roboterarme, „Tentakel“, fliegende Netze, Ionenstrahlen usw. Ein Bild eines Netzes aus speziellen Materialien, das Weltraummüll auffängt Seit 2016 arbeitet Airbus mit einer Reihe europäischer Partner an der „Selbstreinigungstechnologie für Raumfahrzeuge“ und führt erste Forschungsarbeiten zu kostengünstigen und äußerst zuverlässigen Geräteprototypen durch. Ziel ist es, Raumfahrzeugen dabei zu helfen, die Umlaufbahn automatisch zu verlassen, wenn sie ausfallen, die Kontrolle verlieren oder ihr Lebensende erreichen. Im Juni 2018 wurde ein von SAR Satellite Technologies, einer Tochtergesellschaft von Airbus, entwickelter Testsatellit zur Beseitigung von Weltraummüll auf der Internationalen Raumstation eingesetzt. Von September 2018 bis März 2019 schloss die Mission vier Experimente in einer realen Weltraumumgebung erfolgreich ab, darunter das Einfangen eines kubischen Satelliten mit einem Netzbeutel, das Verfolgen der Bewegung von Weltraumzielen, das Einfangen mit einer „Harpune“ und das Verlassen der Umlaufbahn mit einem geschleppten Segel. Während der Pariser Luftfahrtschau im Juni dieses Jahres erklärten der Direktor der ESA und Führungskräfte mehrerer EU-Luftfahrtunternehmen, dass sie gemeinsam einen „Zero Debris in Space Plan“ entwickeln würden, um die Entstehung von Weltraummüll zu reduzieren, sich auf die Situation in erdnahen Umlaufbahnen zu konzentrieren und die Sicherheit und langfristige Nachhaltigkeit von Weltraumaktivitäten zu fördern. Die ESA plant, in diesem Jahr eine Reihe von Seminaren abzuhalten und den Entwurf des Programmdokuments „Zero Debris Charter“ bis zum Jahresende abzuschließen. Darin wird gefordert, dass Länder und Organisationen, die sich dem Programm anschließen, bis 2030 ihre Raumfahrzeuge am Ende ihrer Lebensdauer umgehend verschrotten und aus der Umlaufbahn nehmen oder von Luft- und Raumfahrtunternehmen Dienstleistungen zur aktiven Entfernung von Weltraummüll erwerben. Offensichtlich werden die Pläne der ESA dazu beitragen, die Sicherheit im Weltraum zu verbessern, und es wird erwartet, dass sie die Entwicklung neuer kommerzieller Luft- und Raumfahrtindustrien fördern, darunter auch Dienste im Orbit, wie Reinigung, Versorgung und Wartung im Orbit. Im November 2022 trafen sich die 22 Mitgliedsstaaten der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) zu einem Treffen in Paris, bei dem sie ihre Ausgaben für Weltraumprojekte um rekordverdächtige 17 % erhöhten und ein Dreijahresbudget von 16,9 Milliarden Euro verabschiedeten. Damit bereiteten sie sich auf den Wettbewerb mit den Supermächten der Welt im Bereich der Luft- und Raumfahrt vor. Mit dem Vorschlag für den „Zero Space Debris Plan“ und der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Missionen wie „Clean Space“ hofft die ESA offensichtlich, die „gerechte Sache“ der Weltraumumweltpolitik nutzen zu können, um neue Märkte für europäische Luft- und Raumfahrtunternehmen zu erschließen und die Führungsposition bei den In-Orbit-Diensten in der Luft- und Raumfahrttechnologie einzunehmen. (Autor: Yu Yuanhang) |
>>: Blauer Ozean, grüne Entwicklung
Artikel empfehlen
Was ist schneller zum Abnehmen, Seilspringen oder Joggen?
Sie können mehr trainieren, wenn Sie Zeit haben. ...
Feiere das Laternenfest und errate Laternenrätsel! Ich verrate Ihnen das Geheimnis, wie Sie das Rätsel lösen …
Das Erraten von Laternenrätseln ist eine lustige ...
Wie trainiert man die Explosivität der Waden?
Explosive Kraft ist die Reaktionsfähigkeit der Kö...
Ist es sinnvoll, während der Menstruation Berge zu besteigen?
Viele Frauen treiben während ihrer Menstruation n...
Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Vielleicht waren die haarigen Dinosaurier-Eier zuerst da!
Es gibt eine legendäre „dunkle Küche“. Manche Leu...
Welche Übungen können Hämorrhoiden vorbeugen?
Für viele Büroangestellte ist es am schmerzhaftes...
Wie trainiert man effektiv die Bauchmuskeln?
Ich glaube, dass eine schlanke Taille der Traum v...
Warum wird der von der „Handmahlpartei“ verachtete Instantkaffee immer milder?
Kaffee ist auf der ganzen Welt ein beliebtes Getr...
Was sind die besten Fitnessübungen?
Wenn Sie beim Treppensteigen Atemnot verspüren, z...
Welche Schuhe eignen sich zum Spinning-Bike-Fahren?
Um bessere Ergebnisse beim Abnehmen zu erzielen, ...
nicht gut! Die mysteriösen "Teigpickel", die von den Wellen angespült wurden丨Environmental Trumpet
Hallo zusammen, dies ist die 25. Ausgabe der Kolu...
Wie wäre es mit Yoga für schlanke Beine im Büro
Normalerweise möchten viele Freundinnen an den Be...
Eine neue Sorte? Es wurde in mehr als 60 Ländern auf der ganzen Welt entdeckt! Kommst du zu uns?
Wenn Sie fragen, worüber sich alle in letzter Zei...
Vorfußlaufmethode
Bewegung ist zu etwas geworden, das jedem sehr am...
Eine lebendige Aufführung einer wunderschönen Show mit Klang und Farbe
Mit der wachsenden Nutzerzahl und dem Kapitalzufl...