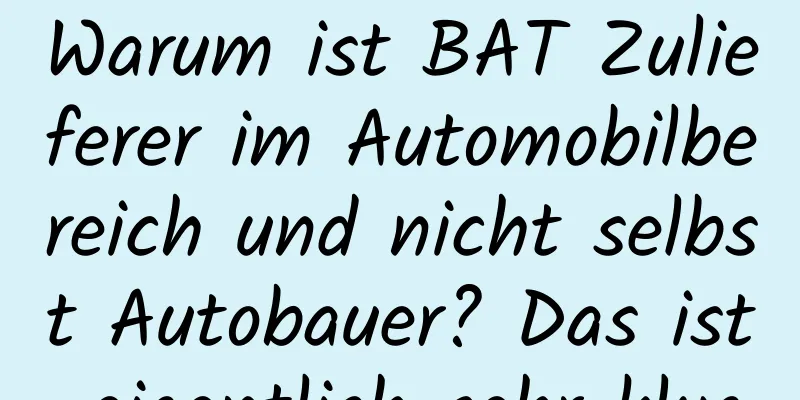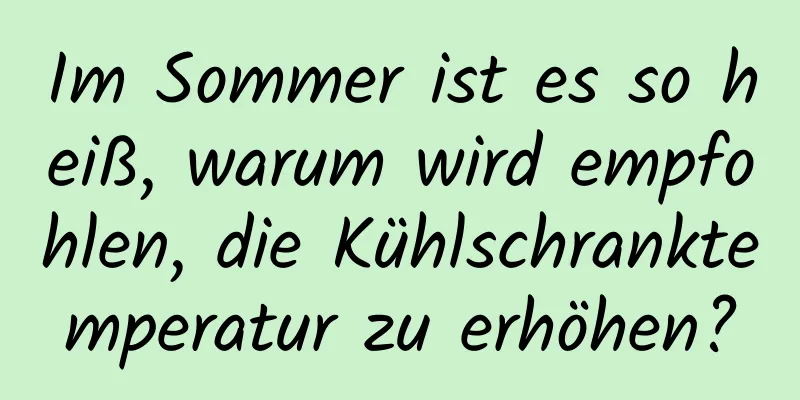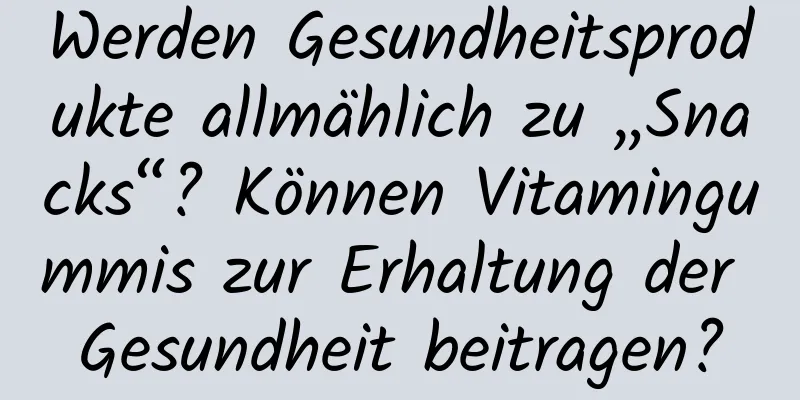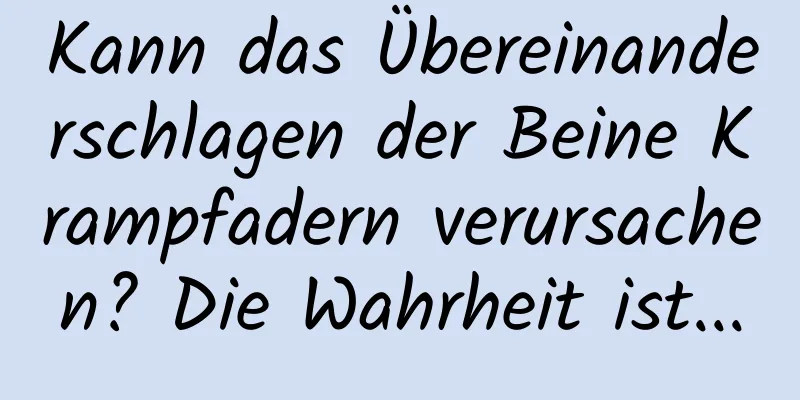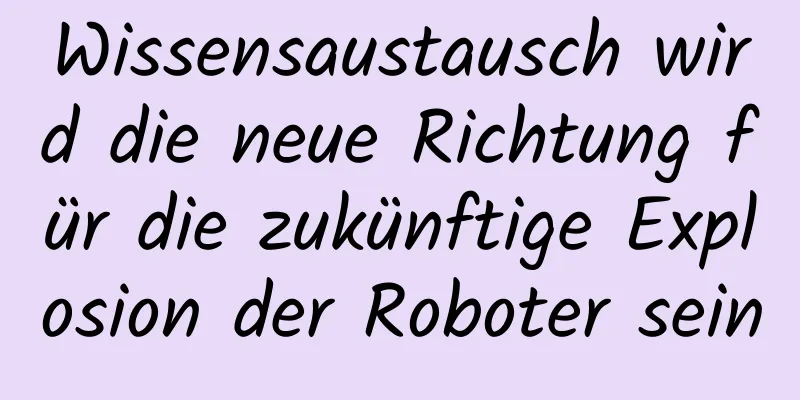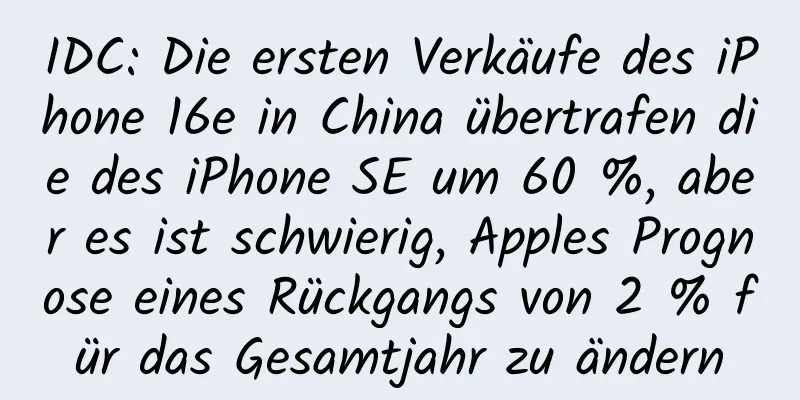Das technische Wunderwerk des Schildtunnelbaus: Die faszinierende Geschichte des Ärmelkanaltunnels
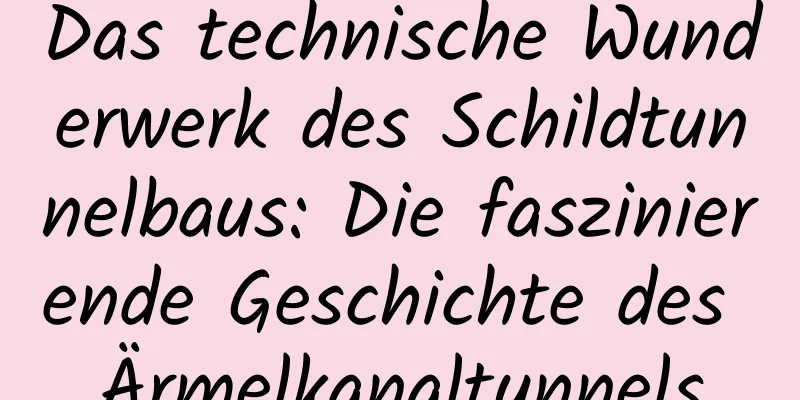
|
Die Idee zum Bau des Ärmelkanaltunnels entstand in den 1950er Jahren. © Der Telegraph Leviathan Press: Der Bau eines Unterwassertunnels zwischen England und Frankreich ist eine enorme technische Herausforderung, und bisher diente nur der Seikan Tonneru in Japan als Präzedenzfall. Eine der ernsthaften Gefahren für Unterwassertunnel besteht darin, dass unter fragilen geologischen Bedingungen aufgrund des Wasserdrucks große Mengen Meerwasser von oben eindringen können. Rückblickend auf die Geschichte ist der Unterwassertunnel nicht nur ein Wunderwerk der Ingenieurskunst; Es geht auch um die komplexen Gefühle und die Haltung des Vereinigten Königreichs gegenüber dem europäischen Kontinent. Der Ärmelkanal (auf Französisch „la Manche“ genannt, was für die Franzosen „der Ärmel“ bedeutet) ist einer der rauesten Seewege der Welt. Die schmalste Stelle ist die Straße von Dover, die nur 20 Meilen (ungefähr 32 Kilometer) breit ist. Doch diese Entfernung ist für diejenigen, die sie überqueren wollen, kein großer Trost. Die Untiefen der Meerenge, ihre besonderen Gezeiten, Strömungen und der ewige Nebel machen die Schifffahrt gefährlich und die dadurch verursachte Seekrankheit ist berüchtigt. Der Ärmelkanal diente jahrhundertelang Großbritannien als Verteidigungslinie gegen ausländische Invasionen. Das schlechte Wetter wurde von den Göttern als der „protestantische Wind“ interpretiert, der 1588 die spanische Armada versenkte. Doch dies war zweifellos ein zweischneidiges Schwert: Handelsschiffe waren ebenso verwundbar wie die riesige Flotte Philipps II. Der Beginn des Industriezeitalters brachte Frieden und Handel und Anfang des 19. Jahrhunderts war Großbritannien der weltweit größte Produzent von Industriegütern. Verbesserungen im Schiffs- und Hafenbereich haben den Handel erheblich erleichtert, es bestehen jedoch weiterhin logistische Probleme beim Transport der Güter vom Schiff an Land. Angesichts dieses Problems begannen die Menschen darüber nachzudenken, wie sie Wasserwege gänzlich vermeiden könnten. Am 7. Januar 1785 überquerte Jean-Pierre Blanchard als erster den Ärmelkanal mit einem Heißluftballon. © Media Storehouse Die erste Überquerung des Ärmelkanals mit einem Ballon fand im Jahr 1785 statt, das erste Flugzeug überflog den Kanal jedoch erst im Jahr 1909. Im Jahr 1851 verband eine Telegrafenleitung London und Paris direkt. Ist Eisenbahn überhaupt möglich? Viele Ingenieure halten dies für möglich: Sie haben ein Tunnelprojekt vorgeschlagen, um Großbritanniens Straßen und Eisenbahnen mit dem europäischen Festland zu verbinden. Dies ist jedoch nicht nur ein technisches und geologisches Problem. Die Idee fester Verbindungen ist eng mit dem britischen Verständnis internationaler Beziehungen und ihrer Stellung in Europa während der Ära des Imperialismus verbunden. Auf der einen Seite stehen die Liberalen, die an ein gemeinsames Europa glauben, einen Liberalismus, der auf dem Glauben an die Einheit „des Volkes“ und an internationale Kommunikation und freien Handel basiert. Für diese Verfechter des Fortschritts verkörperte das große Eisenbahnprojekt den Geist der Zeit: Ein Befürworter drückte es so aus: Die Gleise „verbanden die Herzen der Nationen“. Kupferstich eines unbekannten Künstlers, der Napoleons Invasion Großbritanniens durch Luft-, See- und Unterwassertunnel zeigt, 1803. © meisterdrucke Diesem Ansatz widersetzten sich die pessimistischeren und misstrauischeren Briten, die Europa aufgrund diplomatischer, militärischer und imperialer Spannungen für dauerhaft gespalten hielten. Für sie war die Eisenbahn eine Waffe und der geplante Kanaltunnel eine militärische Front, die ihre wohlhabende, aber unvorbereitete Insel den Armeen des europäischen Festlands aussetzte. Es war dieser Konflikt der Weltanschauungen und nicht die technischen Herausforderungen, der über das Schicksal des Projekts entschied. Französischer Pionier Im Jahr 1802, während einer Pause in den Napoleonischen Kriegen, schlug ein französischer Bergbauingenieur namens Albert Mathieu den vermutlich ersten Plan zur Überquerung des Ärmelkanals vor. Er stellte sich einen Tunnel vor, der durch einen riesigen, ins Meer ragenden Eisenkamin belüftet würde, sowie eine künstliche „internationale Insel“ auf der Varne Bank in der Mitte des Kanals, Umsteigestationen, an denen die Kutschen die Pferde wechseln könnten, und Häfen. Albert Mathieus Plan für eine Pferdekutschenverbindung über den Ärmelkanal, um 1802. © Wikipedia Der Plan wurde an prominenter Stelle in der französischen Bergbauschule und im Parlamentsgebäude ausgestellt, wo Napoleon Bonaparte ihn möglicherweise zum ersten Mal sah. Dies erregte auch die Aufmerksamkeit des britischen Oppositionspolitikers Charles James Fox, der begeistert reagiert haben soll. Mit der Rückkehr des Krieges wurde das Projekt jedoch auf Eis gelegt. Dreißig Jahre später wurde Mathieus Erbe von Aimé Thomé de Gamond übernommen, der den Titel „Vater des Kanaltunnels“ am meisten verdient. De Garmon, ein Renaissancemensch des 19. Jahrhunderts, erwarb neben seinem Studium der Geologie und des Ingenieurwesens auch Doktortitel in Medizin und Recht. Während er die Flüsse Frankreichs studierte, war DeGarmont von der Idee einer Verbindung über den Ärmelkanal fasziniert. In den späten 1830er Jahren hatte er Pläne für alles Mögliche, von riesigen Brücken über Eisenröhren bis hin zu gemauerten Tunneln unter dem Meer. Abbildung des anglo-französischen Unterwassertunnels, den Thomé de Garmon für die Weltausstellung 1867 entworfen hat. Der gelbe Kreis in der oberen linken Ecke stellt eine große Spiralrampe dar, die den Zugang zum Tunnel von der internationalen künstlichen Insel auf Varne Shoal ermöglicht. © Wikipedia DeGarmont war mit seinem Wunsch, Großbritannien mit dem europäischen Kontinent zu verbinden, nicht allein. Aufgrund mangelnder geologischer Kenntnisse wagten jedoch nur wenige seiner Kollegen den Vorschlag, einen Tunnel unter dem Meeresboden zu bauen. Während die Forschung darauf schließen lässt, dass die geologischen Schichten entlang der englischen und französischen Küste dieselben sind, ist unklar, ob die Straße von Dover selbst durch einen Grabenbruch entstand, der die beiden Küsten trennte, oder durch die Erosion einer alten Landbrücke, die einst Kent mit Nordfrankreich verband. Handelt es sich bei der Meerenge um einen Grabenbruch, wäre ein Tunnelbau schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Jeder Versuch würde das Bauen durch unbekannte und uneinheitliche Geologie erfordern, die massives Gestein enthalten könnte und umfangreiche Handarbeit oder Sprengkosten erfordern würde. Illustration des englisch-französischen Vorschlags von Hector Horeau (einem der frühen Tunnelträumer von Tomé de Garmont) für eine unterirdische Röhreneisenbahn. © Archiv Nachdem alle landgestützten Forschungsmethoden ausgeschöpft waren, unternahm Tomé de Garmon 1855 drei außergewöhnliche Solotauchgänge, um das Geheimnis der Meerenge zu lüften. Er trug 72 Kilogramm Feuerstein auf seinem Rücken, verstopfte seine Ohren mit selbstgemachten Schmalzstöpseln und verwandelte seinen Mund in ein Ventil, das er mithilfe von Olivenöl ausstieß, um Luft herauszudrücken und das Eindringen von Wasser zu verhindern. Mit dieser Ausrüstung tauchte er erfolgreich über 30 Meter tief, um Proben vom Meeresboden zu sammeln, und tauchte dann mit Hilfe von einem Dutzend aufgeblasener Schweineblasen wieder auf. Bei seinem letzten Tauchgang musste er die Angriffe eines riesigen Aals abwehren. Tomé de Garmon machte sich allein auf, um den Ärmelkanal zu erkunden. © Wikipedia Das Unterfangen war ein Erfolg. Die Untersuchung der Proben bestätigte, dass Großbritannien und Frankreich einst durch eine Landmasse verbunden waren, die später erodierte, und dass die geologischen Schichten zwischen den beiden Küsten durchgehend waren. Da es sich bei dem Gestein um weiche Kreide handelt, sind für die Arbeiten keine zeitaufwändigen und mühsamen Bohr- und Sprengarbeiten erforderlich. Zum ersten Mal wurden Tunnelpläne realisierbar. Zeitgeist Thomé de Garmons Entdeckung erfolgte zu einem fruchtbaren Zeitpunkt in der Geschichte des europäischen Denkens und der Wissenschaft. Die rasch wachsende technologische, industrielle und wirtschaftliche Macht Europas und die daraus resultierende imperialistische Arroganz führten zu einem berauschenden Kult des wissenschaftlichen Fortschritts, in dem alles möglich schien. Die Eisenbahnen spielten in dieser neuen Welt eine Vorreiterrolle. Die erste kommerzielle Eisenbahnstrecke wurde 1830 zwischen Liverpool und Manchester eröffnet und bis 1850 erstreckten sich mehr als 20.000 km Gleise durch Europa. Kupferstich einer Eisenbahnreise von Liverpool nach Manchester, 1831. © Science and Industry Museum Tunnel waren von Anfang an ein wesentlicher Bestandteil des Eisenbahnbaus, doch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erfolgte der Tunnelbau in einem viel größeren Maßstab. Im Jahr 1871 wurde der Mont-Cenis-Tunnel durch die Alpen gebaut, um Frankreich und Italien zu verbinden. 1882 folgte die Eröffnung des 14,5 Kilometer langen Gotthard-Tunnels, der damals der längste Tunnel der Welt war. Der nördliche Eingang zum Gotthard-Eisenbahntunnel im schweizerischen Göschenen, um 1880. © Wikipedia Vier Jahre später verband ein sechs Kilometer langer Tunnel unter der Severn-Mündung England und Wales. Diese technischen Meisterleistungen „verkörpern den Fortschritt, wie er in der damaligen Zeit verstanden wurde“, schreibt die Technologiehistorikerin Rosalind Williams. Die Fertigstellung jeder dieser Routen wurde als Triumph der Wissenschaft über die Natur angesehen und ihre Designer und Erbauer galten als Pioniere des stetigen Fortschritts der Zivilisation. In diesem Zusammenhang ist das Fehlen einer Kanalverbindung nicht nur eine Anomalie, sondern auch ein Versagen des wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts. Der Ingenieur und Tunnelbefürworter James Chalmers schrieb 1861: Beim Blick auf eine europäische Eisenbahnkarte kann ein aufmerksames Auge viele Linien erkennen, die zu einem bestimmten Punkt und fast immer zu einer Großstadt führen. Es gab jedoch eine bemerkenswerte Ausnahme: Auf dem europäischen Kontinent konnte man sehen, wie die Reihen aus Norden, Osten und Süden und in England aus Süden, Westen und Norden zusammenliefen, die Arme wie zur Umarmung ausgestreckt, und doch ... blieben sie stehen. Titelseitenillustration von James Chalmers‘ „Channel Railway“ aus seinem Werk „The Channel Railway Connecting England & France“ (1861). © wikimedia Die Begeisterung für den technischen Fortschritt ging Hand in Hand mit dem Aufstieg des liberalen Internationalismus, der sich in Ereignissen wie der Londoner Weltausstellung von 1851 und dem englisch-französischen Freihandelsvertrag von 1860 manifestierte. Die Hauptverfasser des Vertrags, Richard Cobden und Michel Chevalier, lehrten, dass die Kräfte der Geschichte unweigerlich auf menschliche Solidarität zusteuerten: Verbesserter Handel und verbesserte Kommunikation würden Kriege eines Tages überflüssig machen. Sie idealisierten „das Volk“ und griffen die „Eigeninteressen“ der Streitkräfte und der Aristokratie an, da sie diese als die wahren Verursacher internationaler Konflikte betrachteten. „Freihandel ist Gottes Diplomatie“, schrieb Cobden einmal. „Anders kann das friedliche Zusammenleben der Menschen nicht gesichert werden.“ Sowohl Cobden als auch Chevalier unterstützten das Kanaltunnelprojekt als einen wichtigen Schritt hin zur endgültigen Vereinigung Europas und als „den wahren Bogen der Union“, ein Satz, den Cobden oft von Tunnelbefürwortern zitierte. De Garmonts Bemühungen trugen 1856 Früchte, als er einen umfassenden Plan für einen zweigleisigen Eisenbahntunnel vorlegte, der East Wear Bay bei Folkestone mit Cap Gris-Nez im Pas-de-Calais verbinden sollte. Wie Mathieu stellte er sich einen internationalen Hafen auf der Insel Vannes vor, komplett mit Lüftungsschächten und Leuchttürmen. Der Bau beginnt auf temporären Steininseln, die in regelmäßigen Abständen über den Ärmelkanal errichtet werden. Von diesen Inseln aus werden Belüftungsschächte gegraben und für den Tunnel wird ein Stahlschild verwendet, das erstmals beim Bau des Themse-Tunnels zum Einsatz kommt. Karte mit Thomas de Garmonts vorläufigem Entwurf für einen Tunnel zwischen England und Frankreich, 1857. © wikimedia Das Projekt wurde von führenden Ingenieuren wie Robert Stephenson und Isambard Kingdom Brunel gelobt und von Königin Victoria, Prinz Albert und Napoleon III. unterstützt. Es schien, als sei es auf dem Weg zu einem – laut seinem Erfinder – „nützlichen und glorreichen Ziel“. Entwurf eines Tunnels, der Folkestone (England) und Cap Griet (Frankreich) verbindet. © wikimedia Doch die Ereignisse waren den Tunnelbefürwortern nur allzu vertraut: Das Projekt scheiterte inmitten der zerrütteten Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Nachdem ein italienischer Nationalist versucht hatte, Napoleon mit einer Bombe britischer Produktion zu ermorden, schürte die britische Presse Panik vor einer Invasion. Premierminister Lord Palmerston, der die Franzosen hasste, nutzte die Situation aus und umgab Plymouth und Portsmouth mit teuren und nutzlosen Befestigungen. Im Gegensatz zu den optimistischen Liberalen glaubte Palmerston, dass der Tunnel „unsere natürlichen Verteidigungsanlagen gegen Feinde auf dem Kontinent“ zerstören würde. Cobden und Chevalier sahen ihn als besessen von den Napoleonischen Kriegen seiner Jugend: „Seine Gedanken waren mit der Vorstellung einer französischen Invasion beschäftigt.“ Dies war die pessimistische und misstrauische Weltanschauung, die die Tunnelbefürworter überwinden mussten, wenn sie Erfolg haben wollten. Unter britischer Führung In den 1860er Jahren gaben britische Ingenieure wie William Low und John Hawkshaw zusammen mit Tomé de Garmont die Idee der Vane Bank auf und konzentrierten sich stattdessen auf die Gewässer zwischen Dover und Calais. Nach umfangreichen Erkundungen und Untersuchungen wurde Ende des 19. Jahrhunderts ein gemeinsames englisch-französisches Komitee gegründet, um das Projekt voranzutreiben. 1872 wurde die britische Channel Tunnel Company gegründet, 1875 kam ein französisches Unternehmen hinzu. Auf Vorschlag der Briten (Palmerson wurde als Premierminister durch den sympathischeren Disraeli ersetzt) bildeten Vertreter der beiden Länder ein formelles gemeinsames Komitee, um Spezifikationen und Vorschriften für den geplanten Tunnel zu entwickeln. Am 2. August 1875 verabschiedeten beide Länder Gesetze, die ihren jeweiligen Unternehmen den Baubeginn gestatteten. Weniger als zwei Jahre später waren die Fortschritte jedoch ins Stocken geraten. Der anhaltende Mangel an vollständigen Machbarkeitsnachweisen untergräbt das Vertrauen der Anleger. Aufgrund finanzieller Probleme hatte das britische Unternehmen bis 1876 kaum nennenswerte Fortschritte erzielt und die durch das Gesetz von 1875 erteilte Konzession lief aus. „Geologische Karte der Straße von Dover, die die wahrscheinliche Linie der Aufschlüsse über den Ärmelkanal zeigt“, aus William Topley, The Geology of the Straits of Dover, The Quarterly Journal of Science (1872). © Archiv Zu dieser Zeit wurde der Tunnel von Sir Edward William Watkin übernommen, dem unabhängigen liberalen Abgeordneten für Hythe und Vorsitzenden von drei großen Eisenbahngesellschaften, darunter der South Eastern Railway, die in Kent tätig war. Watkin war kämpferisch und stur, ein vollendeter Geschäftsmann und Publizist, fasziniert von großen und visionären Ingenieurprojekten und ein leidenschaftlicher Verfechter des Freihandels. Er stellte einen angesehenen wissenschaftlichen und juristischen Beratungsausschuss zusammen, zu dessen Mitgliedern Anwälte, Elektro-, Hydraulik- und Bergbauingenieure, Geologen, Militärangehörige und der Präsident der Royal Society gehörten. Die Schlüsselfiguren waren jedoch zwei Offiziere der Royal Engineers, Colonel Frederick Beaumont und Captain Thomas English, die letztendlich die Machbarkeit des Tunnelprojekts bewiesen. Beide waren begabte Erfinder. In den späten 1870er Jahren experimentierte Beaumont mit Lokomotiven und Straßenbahnen, die mit Druckluft betrieben wurden. English war ein Experte für Stahlpanzerplatten (das Material, das zur Herstellung langlebiger Bergbaugeräte benötigt wird) und ließ sich 1880 eine neue Bohrmaschine patentieren, die auf Beaumonts vorherigem Entwurf basierte. Ein Jahr später nutzten die beiden Englishs Patent, um eine Tunnelbohrmaschine zu bauen, die von Beaumonts Druckluftmotor angetrieben wurde. Es stellte sich als das perfekte Werkzeug für diese Aufgabe heraus. Colonel Beaumonts Entwurf einer Luftlokomotive, die einen 150 Tonnen schweren Zug mit einer einzigen Ladung durch den Tunnel ziehen kann, Abbildung aus Charles Tylden-Wrights Aufsatz „The Channel Tunnel“, veröffentlicht im Northern Institute of Mining and Mechanical Engineers, Band XXXII (1882–1883). © Archiv Ein Querschnitt des Meeresbodens des gegenwärtigen Verlaufs der Straße von Dover, der eine isometrische Perspektive der Druckluftbohrmaschinen von Colonel Beaumont und Captain English zeigt, aus einer Illustration zu Arnold Luptons Aufsatz über den Kanaltunnel, veröffentlicht in den Proceedings of the Yorkshire Geological and Technological Society, Band III (1883). © Archiv Die Maschine ist mit einem rotierenden Fräser ausgestattet, der mit einer Geschwindigkeit von einem Yard pro Stunde einen Tunnel mit einem Durchmesser von 7 Fuß gräbt, sowie mit einem Förderband zum Entfernen des Schutts. Für den Betrieb sind weniger als 10 Arbeiter erforderlich. Entscheidend ist, dass der Motor aufgrund seines elektrischen Antriebs nicht nur keine gefährlichen Abgase produziert, sondern während des Betriebs auch Luft abgibt und so den Tunnel belüftet. Am 14. Oktober 1880 begann die englische Tunnelbohrmaschine Beaumont mit Probebohrungen am Abbots Cliff bei Dover. Die Maschine fördert den grauen Kreidefelsen zu Tage, der gut schneidbar und nahezu wasserundurchlässig ist. Nachdem ein 770 Meter langer Tunnel probeweise gegraben worden war, wurde die Maschine im September des folgenden Jahres an einen neuen Standort unter der Shakespeare-Klippe gebracht, dem nächstgelegenen Punkt zwischen England und Frankreich. Eine englische Tunnelbohrmaschine von Beaumont arbeitet in weicherem Gestein. © Archiv Bis zum Ende des Jahres hatte Watkin die Submarine Continental Railway Company gegründet, um die Arbeiten zu überwachen. Die französische Unterwasser-Eisenbahngesellschaft (Compagnie du Chemin-de-fer Sousmarine) nahm bald ihren Betrieb von Sangatte bei Calais aus auf und verwendete dabei eine modifizierte Tunnelbohrmaschine von Beaumont-English. Dies ist das erste Mal in der Geschichte des Projekts, dass Bergleute auf dem Meeresboden arbeiten. Kupferstich des Unterwassertunnelprojekts zwischen Frankreich und England von Frederic de Haenen, ca. 1850–1900. © meisterdrucke Beaumont erklärte: „Zu sehen, dass der Traum, den ich immer hatte, wahr werden konnte, wird einer der stolzesten Momente meines Lebens sein.“ Aber Beaumont hat noch größere Träume. Er stellte sich eine internationale Unterwasser-Eisenbahn vor, die vollständig mit Druckluft betrieben würde, mit Waggons, die von 80-Tonnen-Lokomotiven gezogen würden, die die Tunnel während der Fahrt belüften würden. Graben in Richtung Katastrophe Im Juni 1881 verkündete Watkin einer überraschten Nation, dass er mit der Fertigstellung eines vorläufigen „Experimentaltunnels“ innerhalb von fünf Jahren rechne und plane, die Strecke in den 1890er Jahren zu eröffnen. „Von Geburt an bin ich ein Insulaner, aber mein Ziel ist es, Teil des großen europäischen Kontinents zu werden“, sagte er. Das einzige offensichtliche Hindernis besteht darin, einen Gesetzentwurf durch das Parlament zu bringen, der es Unternehmen erlaubt, Tunnel unter dem Meeresboden – also auf staatseigenem Land – zu graben. Der Kanaltunnel sollte die Krönung sowohl der internationalen Ingenieurskunst als auch von Watkins eigener Karriere darstellen, „ein Werk, das in seiner gesamten Arbeit seinesgleichen sucht und dennoch von Menschenhand vollbracht wurde.“ Dies wäre sowohl eine praktische Fortsetzung der Arbeit von Richard Cobden als auch ein konkreter Schritt hin zur späteren Europäischen Freihandelsassoziation. Durch die Schaffung wirtschaftlicher und persönlicher Verbindungen zwischen der britischen und der französischen Bevölkerung würde der Tunnel dazu beitragen, gegenseitige Feindseligkeiten abzubauen und ein neues Verständnis zu ermöglichen, „das die Massen beider Länder durchdringt“. „Es ist klar, dass der Ärmelkanal jedes Jahr unpassierbarer wird und zu einem Hindernis für die Kommunikation zwischen den Ländern wird“, sagte Watkin. Der Entwurf einer luftkomprimierten Tunnelbohrmaschine von Colonel Beaumont und Captain English in den 1890er Jahren. © meisterdrucke Watkins Vision der europäischen Einheit ist einzigartig britisch. Als überzeugter Patriot und Internationalist war er fest davon überzeugt, dass Freihandel und Frieden der Schlüssel zum wirtschaftlichen und imperialen Erfolg Großbritanniens seien. Der Unterwassertunnel ist eine Möglichkeit, diese Werte auf den europäischen Kontinent zu exportieren: „…der Kontinent wird von einem besseren und engeren Kontakt mit den Freiheiten und Industrien Englands profitieren…freundlicher Wettbewerb in allen Branchen und Berufen wird zu einem gemeinsamen Erbe zum Nutzen der ganzen Welt werden.“ Diese Leidenschaft für den „Fortschritt“ von Wissenschaft, Handel und Zivilisation wurde im Parlament am eindringlichsten von Lord Brabourne, Watkins Vertreter, zum Ausdruck gebracht: Trotz aller Widerstände schreitet die Wissenschaft stets voran; in aktuellen Fragen schreiten Zivilisation und christliche Kultur Hand in Hand voran; die Hindernisse, die durch isolierte Vorurteile und das leere Gerede professioneller Pedanten entstehen, mögen eine Zeit lang bestehen bleiben, doch angesichts des Zeitgeistes werden sie schließlich blass und machtlos werden. Mit dem Sieg des Ärmelkanaltunnels werden die Herzen der Völker aller Länder geeinter sein und einer vollständigen und glücklichen Anerkennung der universellen Brüderlichkeit der Menschheit näher kommen! Im Januar 1882 schien Watkins Kanaltunnel nicht mehr aufzuhalten. Die öffentliche Meinung war dafür und auch die liberale Regierung unter Watkins Freund William Gladstone unterstützte den Tunnel. Gladstone gewann die Parlamentswahlen von 1880 mit einem Programm des Internationalismus, des Friedens und des Freihandels. Für Watkin war der Kanaltunnel die ideale Verkörperung dieser Politik. John Tenniels Illustration für eine Ausgabe des Magazins Punch aus dem Jahr 1865 mit dem Titel „Die Wasserbabys“ zeigt Mrs. Britain, wie sie zu Mrs. France sagt: „Es ist entzückend, nicht wahr, meine Liebe, zu sehen, wie die Kinder so gute Freunde werden?“ © wikimedia Doch in diesem Moment brach die unterdrückte Macht plötzlich aus. Ohne dass die Öffentlichkeit davon wusste, wurde 1881 ein offizielles Komitee, bestehend aus Vertretern des Handelsministeriums, des Kriegsministeriums und der Admiralität, gegründet, um die Auswirkungen eines Tunnels unter dem Meer zu untersuchen. Eines ihrer Beweisstücke war ein Memorandum von Sir Garnet Wolseley, dem Generalstaatsanwalt der Armee. Obwohl Wolseley in der Öffentlichkeit ein tüchtiger Berufssoldat war, war er politisch ein zutiefst Reaktionär, der die liberale Weltanschauung von Cobden, Gladstone und Watkin offen verachtete. Wolseleys Memorandum zum Tunnel war kein sorgfältiges technisches Dokument, sondern ein vernichtender Angriff auf „die falsche Vorstellung universeller Brüderlichkeit“ und „egoistische Kosmopoliten“. Wolseley ersetzte Watkins optimistische Vorhersagen über die englisch-französische Freundschaft durch seine eigene Analyse der Beziehungen zwischen Nationen und betonte dabei die dem Menschen innewohnende gewalttätige und eifersüchtige Natur. Wolseley war ein notorischer Pessimist und glaubte, dass das britische Militär völlig unterfinanziert sei. Er machte dafür die liberalen Internationalisten verantwortlich. „Wir haben in einem Zustand der Unvorbereitetheit auf einen Krieg gelebt, weil wir auf die guten Absichten anderer vertraut haben“, schrieb er. In diesem Zusammenhang war das freie und wohlhabende Großbritannien eine Trophäe, die es zu erobern galt, und keine Zivilisation, die es nachzuahmen galt. Er glaubte, dass ein Unterwassertunnel „den skrupellosen Ausländer ständig dazu verleiten würde, Krieg gegen uns zu führen, weil er ihm beispiellose Hoffnungen auf Eroberungen eröffnen würde.“ Wolseley stellte fest, dass die Generäle in den jüngsten Kriegen in den USA und Europa durch den Einsatz von Zügen ihre Truppen schneller und weiter transportieren konnten als je zuvor. Ein Anschluss Großbritanniens an Frankreich würde Großbritannien denselben Gefahren aussetzen. Er behauptete, ohne Beweise vorlegen zu können, dass durch den Tunnel stündlich 5.000 Soldaten ins Land transportiert werden könnten. Er malte sich einen plötzlichen Angriff während einer Zeit „tiefen Friedens“ aus, ohne Warnung und ohne formelle Kriegserklärung, „während wir Gentlemen von England in unseren Betten liegen und von der Zeit träumen, als der Löwe und das Lamm einen gemeinsamen Traum hatten“. Da London die einzige unverteidigte Hauptstadt Europas war und über keine große Wehrpflichtarmee verfügte, die es mit Frankreich oder Deutschland hätte aufnehmen können, würde Großbritannien rasch besiegt und in Kontinentaleuropa eingegliedert werden. Es drohte die „nationale Auslöschung“ und die Verwandlung in „ewige französische Heloten (Anmerkung des Herausgebers: das Helotensystem war ein staatliches Sklavensystem im antiken griechischen Stadtstaat Sparta)“. „Der Löwe kann dem Krähen des Hahns nicht standhalten“, Illustration von Friedrich Graetz für das Magazin Punch, Juli 1883, zeigt Wolseley, wie er auf einem Löwen reitet, um vor dem französischen Hahn zu fliehen. Die Illustration wurde einen Tag, nachdem Watkins Gesetzentwurf zum English Tunnel (Pilot Works) aus dem Parlament zurückgezogen wurde, veröffentlicht. Die Inschrift auf dem Tunnel lautet: „British Tunnel Monster“. © wikimedia Die wahre Schärfe von Wolseleys Argumentation liegt nicht in seiner Vision zukünftiger Kriegsszenarien, sondern in seiner Analyse der britischen Gesellschaft. Individuelle Freiheit, niedrige Steuern, freier Handel und ein kleineres Militär waren aufgrund der Sicherheit, die der Ärmelkanal bot, möglich. Durch die Einführung von Tunneln wird dieser Konsens jedoch grundlegend erschüttert. Dies würde dazu führen, dass das Land in eine „Panik“ verfällt, einen schrecklichen Zustand, den alle Länder mit unbedeutenden Armeen und sehr mächtigen Nachbarn regelmäßig erleben. Jede Bewegung französischer Truppen in der Nähe von Calais könnte in Großbritannien Panik auslösen, dass ein Angriff unmittelbar bevorstehe. Ohne die Fähigkeit, ein absolut sicheres Verteidigungssystem zu entwickeln, wird Großbritannien in einer Reihe eskalierender Panikattacken und riesiger Militärausgaben gefangen sein. Das Ergebnis sei, dass Großbritannien letztlich „dem Beispiel europäischer Länder folgen“ und ein umfassendes Wehrpflichtsystem einführen müsse. Darüber hinaus behauptete Wolseley, dass er eine solche Armee unter „unserem Regierungssystem“ für unmöglich halte, und deutete an, dass ein Unterwassertunnel die parlamentarische Demokratie selbst beseitigen könnte. Die größte Bedrohung, die von Tunneln ausgeht, ist daher nicht unbedingt die Angst vor einer Invasion, sondern die wirtschaftlichen und sozialen Kosten, die mit der Abwehr dieser Bedrohung verbunden sind. Panik-Petitionen und Unterwasser-Champagner Im Februar 1882 wurde Wolseleys Memorandum in der Zeitschrift The Nineteenth Century veröffentlicht und im folgenden Monat begannen er und andere Armee- und Marineoffiziere eine konzertierte öffentliche Kampagne gegen den Tunnel. Dabei half ihnen James Knowles, der Herausgeber der Zeitschrift Nineteenth Century, der eine Sonderausgabe und eine Petition gegen den Plan organisierte, die von einer Reihe prominenter (wenn auch nicht ganz repräsentativer) Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens unterzeichnet wurde, darunter eine Reihe prominenter Liberaler wie Thomas Henry Huxley, Herbert Spencer und 14 liberale Abgeordnete. Knowles‘ Begleitpapier reduziert Wolseleys Argumente auf drei große Ängste: die „Unvermeidlichkeit“ erhöhter Militärausgaben, die „Möglichkeit“ einer Panik und die „Wahrscheinlichkeit einer irreparablen Katastrophe“. Es ist klar, dass diese Themen im liberalen Großbritannien einen Nerv treffen. In einer kritischen Phase trauten viele nicht zu, dass „das Volk“ seine Verbindungen zur Neuen Welt im Geiste universeller Brüderlichkeit annehmen würde. Der Scotsman schrieb: „Alarmisten unterzeichnen die Petition, weil sie Alarmisten sind. Nicht-Alarmisten unterzeichnen sie, weil sie nicht wollen, dass das Land beunruhigt wird.“ „Lord Watkins’ Heilmittel gegen die Invasionspanik: Ertränkt die Franzosen im Kanaltunnel“, doppelseitige Illustration aus The Penny Illustrated, 1881. © printsandephemera Watkin reagierte auf diese Angriffe mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln. Er ermutigte seine Freunde, sich für den Unterwassertunnel einzusetzen, und schon bald waren Zeitungen und Zeitschriften voll von Debatten über den Plan. Einen eindrucksvollen Artikel lieferte Sir Andrew Clarke, Kommandant der Royal School of Military Engineering, der damit besonders erfolgreich war. Der Artikel versicherte den Lesern, dass es keinen historischen Präzedenzfall für die Stationierung einer ganzen Armee entlang einer einzigen Eisenbahnlinie gebe, und tat die Möglichkeit einer verdeckten Invasion als „reine Unmöglichkeit“ ab. Generell wiesen die Tunnelbefürworter darauf hin, dass es sehr leicht wäre, den Tunnel zu zerstören, zu blockieren oder zu überfluten, insbesondere da der Eingang unter Beschuss der Kanonen von Dover Castle und aller im Hafen vor Anker liegenden Kriegsschiffe liege. Watkin griff auch auf sanftere Überzeugungsmethoden zurück und lud verschiedene Prominente (darunter Gladstone und Wolseley) zu einer Besichtigung der Tunnelarbeiten unter dem Meer ein, wo sie Champagnerempfänge unter elektrischem Licht genießen und die Bohrmaschinen inspizieren konnten. Illustration eines Champagnerempfangs im Eurotunnel, aus The Illustrated London News, 1882. © wikimedia Diese Gegenargumente konnten die öffentliche Meinung jedoch nicht aufhalten, die sich aufgrund der Panik deutlich gegen den Tunnel wandte. Hin- und hergerissen zwischen seinen persönlichen Überzeugungen und seinem politischen Instinkt, überwies Gladstone die Angelegenheit einem parlamentarischen Sonderausschuss, der jedoch keinen Konsens erzielte und mit sechs zu vier Stimmen gegen den Plan stimmte. Dies ist die Ausrede, die die Regierung braucht, um aus der Patsche zu kommen. Watkins Gesetzentwurf zum Kanaltunnel (Experimentelle Arbeiten) wurde am 24. Juli 1883 offiziell aus dem Unterhaus zurückgezogen. Die Arbeiten an dem Titel Shakespeare Cliff wurden im August 1882 eingestellt; Das Board of Trade war schließlich gezwungen, eine einstweilige Verfügung gegen Watkin zu erlassen, der sich zeitweise bereit erklärte, wegen des Tunnels ins Gefängnis zu gehen. Bis zum 18. März 1883, als Sangattes Maschine abgeschaltet wurde, hatten die beiden Unternehmen 3.863 Yards (3,5 km) Tunnel ohne größere Zwischenfälle gegraben. Die französische Maschine wurde bald nach Liverpool gebracht, wo sie einen Belüftungstunnel für die Mersey Railway grub. Die britische Maschine wurde an Ort und Stelle 130 Fuß unter dem Ärmelkanal zurückgelassen. Die Continental Undersea Railway Company verschwand 1886, nachdem sie mit der Channel Tunnel Company fusionierte. Watkin kämpfte weitere acht Jahre energisch für sein Amt, jedoch ohne Erfolg. Er ging 1894 bei der Eisenbahn in Rente und starb 1901. Wäre der Tunnel aus dem 19. Jahrhundert fertiggestellt worden, wenn die militärischen Einwände zurückgezogen worden wären? Beaumont und English zeigten, wie man einen Unterwassertunnel baut, aber ihre „experimentelle“ Arbeit war im Vergleich zum gesamten Projekt unbedeutend. Watkin selbst räumt ein, dass möglicherweise staatliche Unterstützung erforderlich ist, bevor die Verbindung fertiggestellt ist. Es ist unwahrscheinlich, dass der Beaumont-Luftzug jemals die geplante Größe erreichen wird, und die Probleme hinsichtlich der Belüftung und Wartung werden enorm sein. Andererseits wird die Einführung elektrischer Züge bis zum Ende dieses Jahrhunderts das Problem erheblich vereinfachen. Schematische Darstellung des Funktionsprinzips einer modernen Tunnelbohrmaschine. © Pinterest Sicher ist jedoch, dass die Geologie auf ihrer Seite ist. Eine Eurotunnel/TransManche-Bohrmaschine durchfährt den Unterwassertunnel der ehemaligen „Underwater Continental Railway Company“ während des Baus des modernen Tunnels Ende der 1980er Jahre. Die Arbeiten aus dem Jahr 1882 erwiesen sich als wasserdicht und die Gleise und Straßenbahnen waren noch vorhanden: eine Erinnerung daran, dass diese Straße schon einmal befahren worden war. Von Peter Keeling Übersetzt von tamiya2 Korrekturlesen/Rabbits leichte Schritte Originaltext/publicdomainreview.org/essay/the-early-history-of-the-channel-tunnel/ Dieser Artikel basiert auf der Creative Commons License (BY-NC) und wird von tamiya2 auf Leviathan veröffentlicht Der Artikel spiegelt nur die Ansichten des Autors wider und stellt nicht unbedingt die Position von Leviathan dar |
>>: „Ein Schuss und Blackout“? Bei Ihnen gibt es zu viele Missverständnisse zum Thema Anästhesie!
Artikel empfehlen
Tagebuch eines wissenschaftlichen Experiments | Auch Metalle leiden unter dem „Social Bull Syndrome“
...
Vier Missverständnisse führen dazu, dass 90 % der Menschen nicht wissen, was ein echter Benutzer ist
Ein Unternehmen, das behauptete, über zig Million...
Wie kann man das Längenwachstum von Kindern fördern? Diese Sportarten helfen dabei!
Die Größe ihrer Kinder bereitet vielen Eltern Sor...
Welche Art von Übung schadet den Knien nicht?
Wie wir alle wissen, ist das Knie das größte und ...
So bauen Sie starke Muskeln auf
Manche Menschen möchten starke Muskeln aufbauen, ...
Warum tun mir nach dem Training die Knie weh?
Viele Freunde verspüren nach anstrengenden Aktivi...
Einblicke | Das Geheimnis des Glücklichseins: Nicht aufregen oder streiten
Galerie berühmter Künstler | Henri Matisse, ein b...
Welches Fitnessgerät eignet sich für das Bauchmuskeltraining
Viele Frauen mögen eine schmale Taille, denn eine...
Kurze Diskussion: Was fehlt uns noch im Puzzle der Erschaffung wissenschaftlicher Wunder?
Nur freie Menschen können die Wahrheit entdecken ...
Warum können wir nicht gleichzeitig durch beide Nasenlöcher atmen?
Gutachter: Yuan Xiandao (stellvertretender Chefar...
Was man beim Hot Yoga anziehen sollte
Yoga ist in unserem Leben weit verbreitet, aber d...
„Bild“, das du nicht kennst | Perfekter goldener Schnitt
Quelle: Guangxi Wissenschafts- und Technologiemus...
Wie läuft das 8-Minuten-Brustmuskeltraining ab?
Im Leben sind die meisten Männer jeden Tag mit de...
Ein „unartiges Kind“ hat mit dem Feuer gespielt und ein Auto angezündet... Brandschutzerziehung ist nicht zu unterschätzen!
Brand- und Diebstahlschutz „Unartige Kinder“ könn...