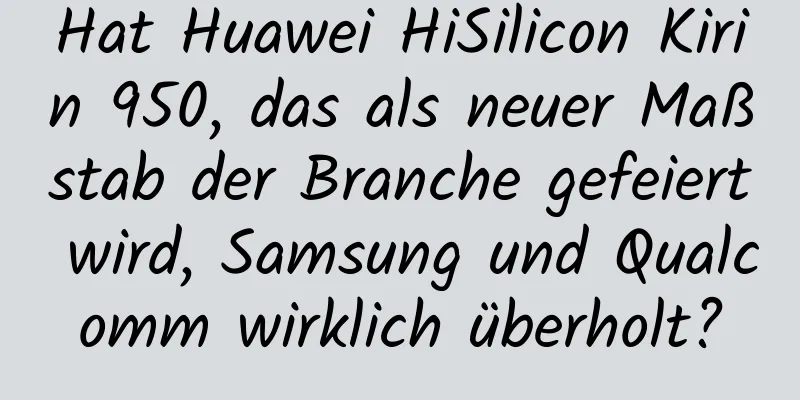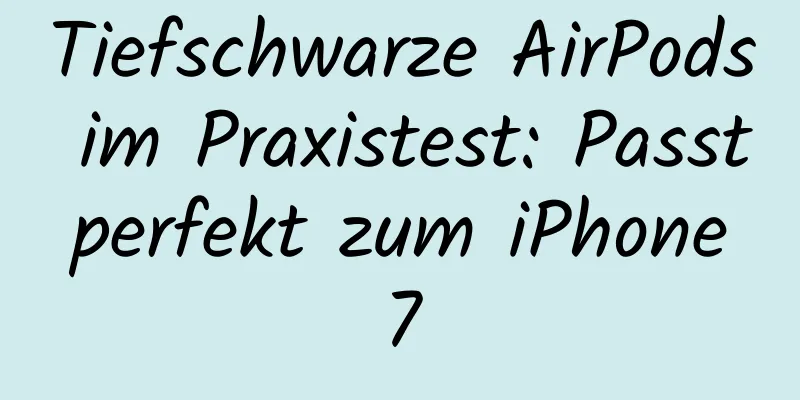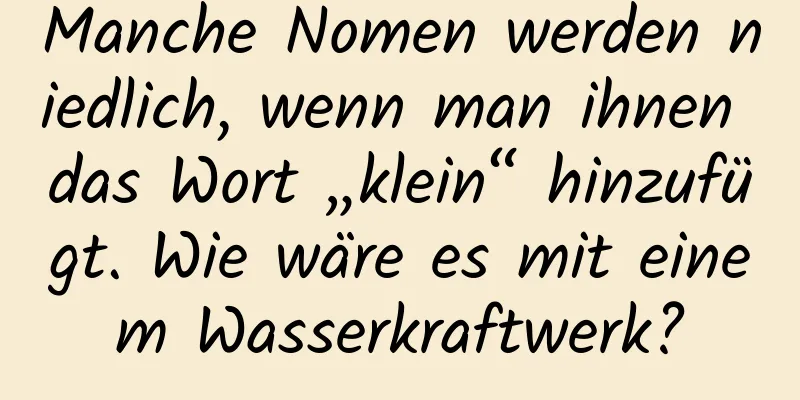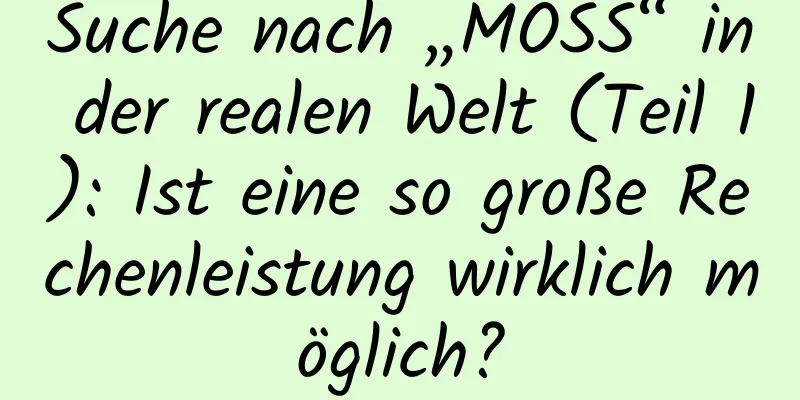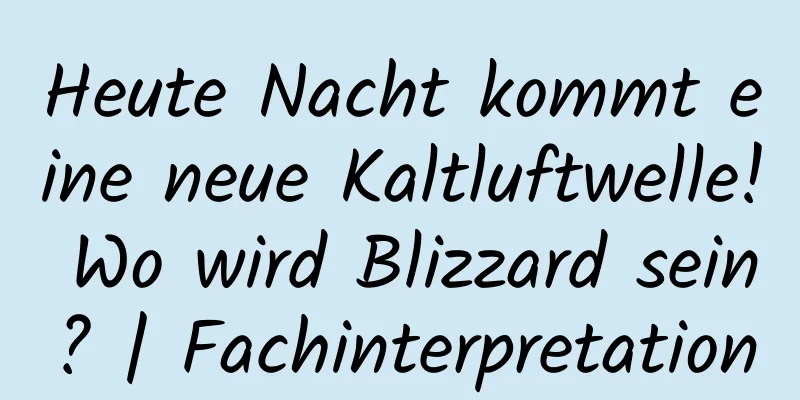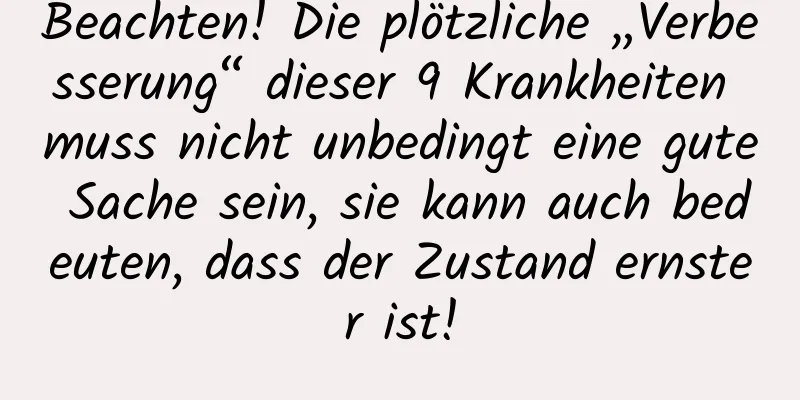Welches ist das erste Tier der Welt, das aktive Geräusche von sich gibt? Wenn das Leben zu zwitschern beginnt
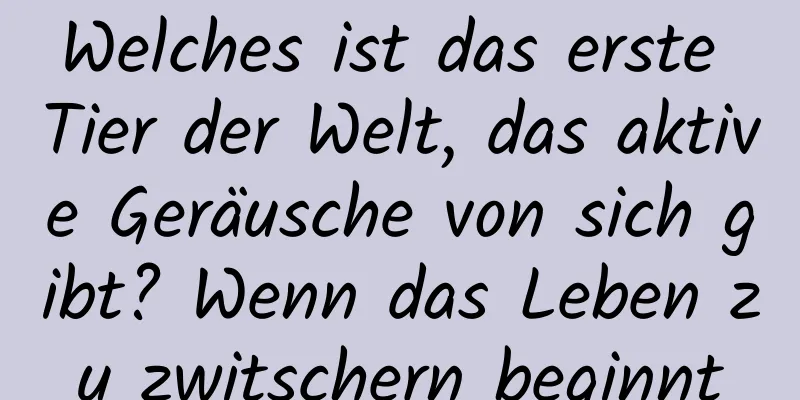
|
Autor: Global Science Wir sind daran gewöhnt, dass die Erde voller Tiergeräusche ist. Interessant ist jedoch, dass es während des größten Teils der Erdgeschichte nur Geräusche wie Wind, Regen und Wellen gab, aber keine aktiven Tiergeräusche. Obwohl das erste bekannte Leben vor 3,7 Milliarden Jahren entstand, bestand es ursprünglich aus Mikroorganismen. Auch wenn einige mehrzellige Weichtiere erst viel später auftauchten, kann man von einer Qualle natürlich nicht verlangen, ein Geräusch zu machen. Erst vor etwa 500 Millionen Jahren, nach der kambrischen Explosion, begannen die Tiere, einige grundlegende stimmliche Verhaltensweisen zu entwickeln. Dabei handelte es sich allerdings lediglich um Geräusche, die durch die Reibung zwischen Gliedmaßen und der Umgebung entstanden. Wie das Schaben der Füße eines Gliederfüßers über den Sand oder das Reiben eines Kopffüßers, der seinen Kopf aus seinem Panzer steckt. Dazu gehören die ältesten bekannten Insekten, die vor etwa 400 Millionen Jahren auftauchten, aber wahrscheinlich weder Geräusche machen noch hören konnten. Gleichzeitig sind an Land von Tieren grundsätzlich keine Geräusche zu hören. Es dauerte weitere 200 Millionen Jahre, bis summende Insekten auftauchten und eine völlig neue Welt der Akustik schufen. Insekten-Trommelfell Tatsächlich lassen sich die ältesten bekannten Insekten auf ein Alter von 400 Millionen Jahren zurückführen, doch es ist sehr wahrscheinlich, dass sie nicht nur keine Geräusche machen, sondern auch taub sind. Um das erste Insekt aufzuspüren, das Geräusche machen konnte, untersuchten Wissenschaftler des Nanjing Institute of Geology and Paleontology eine große Zahl fossiler Insektenexemplare in Sammlungen auf der ganzen Welt und konzentrierten dann ihre ganze Aufmerksamkeit auf ein Orthoptera-Insekt namens Laubheuschrecke. Laubheuschrecken, allgemein als Heuschrecken und Zikaden bekannt, können durch Reibung zwischen ihren Vorderflügeln Geräusche erzeugen und sind auf die Trommelfelle ihrer Vorderfüße angewiesen, um Schallsignale zu empfangen. Laubheuschrecken waren im Mesozoikum in großer Zahl verbreitet und stellten daher ideale Organismen für die Erforschung der Evolution der Tierakustik dar. Auf der Grundlage umfangreicher Forschungsarbeiten haben Wissenschaftler eine Datenbank mit den wichtigsten morphologischen Merkmalen fossiler Laubheuschrecken erstellt und die Häufigkeit der Rufe mesozoischer Laubheuschrecken systematisch rekonstruiert. In einem 2022 veröffentlichten Artikel spekulierten sie, dass Laubheuschrecken bereits in der mittleren Trias vor 240 Millionen Jahren in der Lage waren, hochfrequente Töne im Bereich von 12 bis 16 kHz zu erzeugen. Dies ist zugleich die älteste Aufzeichnung hochfrequenter Töne im gesamten Tierreich. Während des Mesozoikums waren Laubheuschrecken sehr verbreitet. Sie waren wie unermüdliche „Sänger“, die vom frühen Morgen bis in die Nacht sangen. Unter ständigem Gezwitscher markieren sie ihr Territorium, suchen Verwandte und Freunde, werben um Partner und vermehren sich. Darüber hinaus können auch die frühesten bekannten Zikadenfossilien auf diese Zeit zurückgeführt werden. Diese Insekten können besonders laute Geräusche erzeugen, indem sie die Trommelfelle in trommelartigen Strukturen auf ihrem Hinterleib schnell anspannen und entspannen. Bei manchen Insektenfossilien sind die Strukturen, die Geräusche erzeugen, intakt erhalten, sodass Forscher die Gesänge der Insekten damals rekonstruieren konnten. Für diese ersten Exemplare summender Insekten hatte die Fähigkeit, Geräusche zu erzeugen und zu hören, viele Vorteile. Da sie über große Entfernungen durch Schall kommunizieren können, können sie auch die Geräusche von Raubtieren in der Nähe hören und sogar Beute anlocken, indem sie die Geräusche potenzieller Partner nachahmen. Darüber hinaus boten Geräusche eine neue Möglichkeit, einen Partner anzulocken, und führten zu einem neuen biologischen Kampf: Welches Lebewesen konnte den lautesten Lärm machen? Etwa zur gleichen Zeit, als Insekten zu summen und zu zwitschern begannen, begannen auch Wirbeltiere mit der Erzeugung verschiedener Arten von Geräuschen zu experimentieren. Dinosaurierkehle Etwa zur gleichen Zeit, als Insekten zu quietschen und zu summen begannen, entwickelten auch Wirbeltiere eine sehr wichtige Struktur zur Erzeugung von Geräuschen – eine Struktur, die wir noch heute nutzen: den Kehlkopf. Tatsächlich ist es für uns schwierig, genau zu wissen, wie der Kehlkopf ursprünglich entstanden ist. Denn der Kehlkopf besteht aus Knorpel, Knorpel lässt sich als Fossil jedoch meist nur schwer konservieren. Einige Studien legen jedoch nahe, dass der Kehlkopf möglicherweise gleichzeitig mit den Landwirbeltieren vor etwa 300 Millionen Jahren auftrat. Im Mesozoikum entwickelten Wirbeltiere allmählich vielfältige stimmliche Fähigkeiten. Wenn Sie eine Tiergruppe mit den ausgefallensten Stimmtechniken in diesem Stadium auswählen müssten, wären es die Dinosaurier. Im Mesozoikum entwickelten sich die Dinosaurier zu einer großen Vielfalt an Gruppen, von denen jede über einzigartige Lautäußerungsfähigkeiten verfügte. Parasaurolophus beispielsweise ist ein pflanzenfressender Dinosaurier, der zur Familie der Hadrosaurier gehört. Sie haben eine riesige Krone auf dem Kopf. Im Jahr 1981 entdeckte der Paläontologe David Weisham, dass der Kamm wie eine Trompete mit Vakuum gefüllt und mit den Atemwegen des Tieres verbunden war. Er glaubte daher, dass der Kamm tatsächlich eine Resonanzkammer darstellte, die die Geräusche des Parasaurolophus verstärken konnte. (Dies ist die tatsächliche Resonanz der Kopfhöhle) Andere Forscher haben herausgefunden, dass die Schädel vieler Dinosaurier nicht massiv sind, sondern viele komplexe Löcher aufweisen. Sie gehen davon aus, dass die durch einen solchen Schädel strömende Luft nicht nur die Körpertemperatur der Dinosaurier regulierte, sondern ihnen auch ermöglichte, verschiedene Geräusche zu erzeugen. Wenn wir über Dinosaurier sprechen, müssen wir natürlich Filme und Fernsehsendungen wie „Jurassic Park“ erwähnen, in denen Dinosaurier oft mit sehr lautem Brüllen (Ah——) gepaart werden. Dies steht jedoch nicht im Einklang mit den fossilen Beweisen, die wir gefunden haben. Einige Studien legen nahe, dass die Rufe theropodaner Dinosaurier wie Tyrannosaurus Rex auf Grundlage der bislang entdeckten Fossilien eher denen von Vögeln als denen von Säugetieren ähneln. Mit anderen Worten: Der Tyrannosaurus Rex hat eigentlich „gebrüllt“, anstatt zu „weinen“. Aber es ist nicht so, dass der Tyrannosaurus Rex wie eine Riesengans quakte oder wie ein Riesenspatz zwitscherte. Das „Zwitschern“ hat hier einen biomechanischen Hintergrund. Das Geräusch ähnelt eher einem summenden Geräusch, das durch die Vibration tief in der Brust entsteht und bei geschlossenem Mund durch die Nase austritt. Dann gab es die großen Dinosaurier – die Sauropoden mit ihren langen Hälsen und riesigen Körpern. In manchen Filmen werden Brachiosaurus und Diplodocus so dargestellt, als würden sie Geräusche wie Elefanten machen, in Wirklichkeit geben sie jedoch kaum Geräusche von sich und können höchstens ein Zischen von sich geben. Hier liegt ein Problem vor. Wir alle Vierbeiner, vom Frosch bis zum Menschen, verwenden den Kehlkopf zur Lauterzeugung, was eine Steuerung durch den Nervus laryngeus recurrens erfordert. Dieser Nerv hat einen ungewöhnlichen Verlauf: Er verläuft den Hals hinunter, um die Brust herum und dann wieder den Hals hinauf in den Kehlkopf. Das heißt, die neuronalen Signale für die Lautäußerung müssen eine Distanz zurücklegen, die doppelt so lang ist wie der Hals. Für uns Menschen ist die doppelte Halslänge nichts. Man stelle sich jedoch vor, dass diese Route bei einem Brachiosaurier mit einem mehrere Meter langen Hals zu erheblichen Signalverzögerungen führen würde. Es ist für uns schwer vorstellbar, wie sie trotz solcher Verzögerungen ihre Stimmbänder so manipulieren können, dass sie sich schnell bewegen und komplexe Laute wie Zwitschern oder Brüllen erzeugen. Vogelsyrinx Eine Dinosaurierart hat ein ganz besonderes Stimmorgan entwickelt: den Vogel. Obwohl es offensichtliche Unterschiede im Aussehen gibt, haben sich Vögel aus Dinosauriern der Ordnungen Saurier und Theropoda entwickelt. Als sie sich zu flinken Lebewesen entwickelten und in den Himmel flogen, wurden die einzigartigen Rufe der Vögel zu ihrem ganz eigenen Symbol. Die Stimmorgane von Vögeln unterscheiden sich völlig von denen von Reptilien und Säugetieren. Vögel erzeugen mit ihrer Syrinx wunderschöne Gesänge. Die Syrinx befindet sich am Übergang zwischen Luftröhre und Bronchien von Vögeln und ist wie eine „menschliche“ Form an der Gabelung der Atemwege platziert. Normalerweise besteht die Syrinx aus einem Teil der Trachealwand (also der Syrinx) und der im mittleren Teil liegenden Semilunarmembran. Darüber hinaus gibt es an der Außenseite der Tracheawand Stimmmuskeln, die die Tracheabewegung steuern können. Wenn Luft durch die Syrinx strömt, werden die Syrinx und die Taschenmembran zum Vibrieren gebracht, wodurch Schall entsteht. Die Syrinx-Muskeln können die Details des Klangs nur anpassen, indem sie die Spannung der Syrinx- und Bronchialöffnungen verändern. Man kann sagen, dass der Lautäußerungsprozess von Vögeln die Erzeugung und Resonanz von Geräuschen beinhaltet. Das Gas strömt durch die Syrinx, wodurch diese vibriert und Geräusche erzeugt. Die Syrinx erzeugt dann unter der Regulierung der Syrinx-Muskeln verschiedene Arten von Obertönen. Es ist erwähnenswert, dass sich die Syrinx dort befindet, wo sich die Luftröhre gabelt. Diese Struktur ermöglicht es den linken und rechten Syrinxmuskeln, Vibrationen relativ unabhängig voneinander zu steuern. Daher können manche Singvögel nicht nur beim Aus- und Einatmen Zwitschergeräusche erzeugen, sondern auch unabhängig voneinander oder koordiniert zwischen links und rechts Zwitschergeräusche erzeugen. Durch diesen Ansatz wird die Lautvielfalt der Singvögel erheblich erweitert. Auch die Frage, wie sich diese komplexe Struktur entwickelt hat, ist eine sehr interessante wissenschaftliche Frage. Wir wissen, dass fossile Funde das wichtigste Forschungsmaterial für das Verständnis der Evolutionsgeschichte sind. Im Allgemeinen ist es wahrscheinlicher, dass nur relativ harte Knochen und Schalen dem Zahn der Zeit standhalten und als Fossilien erhalten bleiben. Daher glaubten Wissenschaftler lange Zeit, dass Weichteile wie die Syrinx nur schwer als Fossilien erhalten werden könnten, was die Beschreibung ihres Evolutionsprozesses erschwerte. Doch im Jahr 2016 änderte sich alles, als Wissenschaftler ein Fossil mithilfe hochauflösender Tomographietechnologie analysierten. Das Fossil wurde auf der Insel Vega östlich der Antarktischen Halbinsel in der Antarktis gefunden. Aus diesem Grund haben die Wissenschaftler ihm den Namen Vega-Vogel gegeben. Vegaornis stammt aus der Zeit vor 66 bis 68 Millionen Jahren, was der späten Kreidezeit entspricht. Als dieses Fossil erstmals entdeckt wurde, hatten Wissenschaftler bereits einige Restaurierungsarbeiten durchgeführt und festgestellt, dass es sich um einen flugfähigen Vogel handelte, der den heutigen Gänsen sehr ähnlich war, es sich jedoch möglicherweise nicht um den direkten Vorfahren der heutigen Gänse handelte. Bei einer hochauflösenden Tomographieuntersuchung im Jahr 2016 stellten Wissenschaftler unerwartet fest, dass die Verbindung zwischen Luftröhre und Bronchien des Wega-Vogels deutlich vergrößert war und größere Lücken zwischen den Bronchialknorpeln auftraten. Dieses Merkmal ist der heutigen Syrinx sehr ähnlich. Man kann sagen, dass dies auch darauf hindeutet, dass der Wega-Vogel zu dieser Zeit bereits eine Syrinx entwickelt hatte, die Geräusche machen konnte. Weitere Untersuchungen lassen darauf schließen, dass Wega möglicherweise in der Lage war, ähnliche Laute wie heutige Gänse oder Enten hervorzubringen. Es ist zwar nicht so sanft und bewegend, sorgt aber auch für neuen Spaß. Vom ersten Auftreten der Vögel vor 150 Millionen Jahren bis zur frühesten bekannten Syrinx vor 68 Millionen Jahren haben die Vögel eine sehr interessante Reise hinter sich. Da der Kehlkopf bereits ein Stimmorgan ist, fanden sie dennoch einen anderen Weg und entwickelten an einer anderen Stelle des Organs ein neues Stimmorgan. Dies ist in der Evolutionsgeschichte selten. Auch heute noch besitzen Vögel einen Kehlkopf, doch mit Ausnahme einiger weniger Arten nutzen ihn kaum noch Vögel zur Lauterzeugung. Es ist erwähnenswert, dass, obwohl Flugsaurier zu dieser Zeit ebenfalls eine ökologische Nische am Himmel besetzten, diese Kreatur im eigentlichen Sinne kein Vogel war und sich auch in ihrer Art, Laute von sich zu geben, von der der Vögel unterschied. Die Entstehung der Echoortung Die Stimmgebung und das Gehör haben sich so entwickelt, dass sie über die reine Kommunikation hinaus mehr Funktionen erfüllen. Wir alle wissen, dass Tiere wie Fledermäuse und Wale die Fähigkeit haben, Dinge mithilfe von Schall zu „sehen“, also Echoortung. Zur vollständigen Entwicklung der Echoortung ist die Entwicklung zahlreicher Organ- und physiologischer Strukturen erforderlich. Die Auflösung von Objekten, die durch Echoortung gesehen werden können, ist umgekehrt proportional zur Wellenlänge des ausgesendeten Schalls. Wenn Fledermäuse mithilfe von Schall Ziele wie kleine Insekten erkennen möchten, müssen sie Töne mit einer sehr kurzen Wellenlänge, also einer höheren Frequenz, aussenden. Zum Vergleich: Die Obergrenze des menschlichen Hörvermögens liegt bei etwa 20.000 Hz, während die Frequenz der von Fledermäusen mit ihrem Kehlkopf und ihrer Zunge erzeugten Geräusche zwischen 15.000 und 200.000 Hz liegen kann. Das hohe Quietschen, das wir hören, liegt bei Fledermäusen nur im Bassbereich. In ähnlicher Weise haben Fledermäuse große Innenohrstrukturen entwickelt, um Ultraschallechos zu hören. Die Cochlea des Menschen ist kleiner als ein Zehncentstück, die Cochlea einer Fledermaus kann jedoch (bei Vergrößerung auf die gleiche Größe) so groß wie ein Golfball sein. Echoortung kann auch in Unterwasserumgebungen eingesetzt werden. Und weil die Schalldämpfung im Wasser viel geringer ist als in der Luft, können mit der Echoortung im Wasser auch weiter entfernte Objekte erkannt werden als in der Luft. Wenn eine Fledermaus in der Luft in 50–90 Metern Entfernung auf ein großes Objekt trifft, kann sie es möglicherweise nicht orten. Handelt es sich um ein kleines Insekt, muss der Abstand noch geringer sein. Manche Delfine können mithilfe der Echoortung jedoch Objekte in einer Entfernung von bis zu 200 Metern unterscheiden. Die Unterwasserumgebung ermöglicht eine möglichst weite Schallübertragung und große Wassertiere haben in dieser Hinsicht einen natürlichen Vorteil. Die riesigen Bartenwale beispielsweise haben einen Kehlkopf von etwa 60 cm Länge und können Töne mit extrem niedriger Frequenz erzeugen, die für Menschen unhörbar sind. Die Geräusche mancher Bartenwale sind Hunderte oder sogar Tausende Kilometer weit zu hören. Leider können menschliche Aktivitäten im Meer manchmal zu laut sein. Viele Organismen im Ozean sind auf das Ausstoßen und Hören von Geräuschen angewiesen, um zu kommunizieren, Beute aufzuspüren und Partner zu finden. Der vom Menschen verursachte Lärm kann jedoch leicht die Geräusche dieser Meeresbewohner überdecken und so ihr Überleben ernsthaft beeinträchtigen. Die Entstehung der menschlichen Sprache Etwa 230 Millionen Jahre nachdem sich die Laute der frühen Säugetiere auf der ganzen Welt verbreiteten, begann die Vokalisierung eine neue Rolle in der Evolution der menschlichen Sprache zu spielen. Zu den strukturellen Voraussetzungen für die Sprache gehören ein schnell anpassungsfähiger Kehlkopf und eine enge Verbindung von Kehlkopf und Zunge. Diese Strukturen lassen sich zumindest bis zu unseren Ursprüngen, dem frühen Homo, zurückverfolgen. Dies bedeutet, dass unsere menschlichen Vorfahren möglicherweise bereits vor 2,8 Millionen Jahren über eine Form von Sprache verfügten. Wann und wo die früheste menschliche Sprache entstand, ist jedoch weiterhin umstritten. Sprache erfordert nicht nur eine Struktur, die Laute hervorbringen kann, sondern erfordert auch die Fähigkeit des Menschen, die Welt mithilfe von Werkzeugen wie Symbolen und Bildern zu verstehen, also symbolisches Denken. Die meisten Modelle lassen darauf schließen, dass der Homo erectus, der vor etwa 1,8 Millionen Jahren auftrat, der erste Vorfahre des Menschen war, der Symbole verwendete. Doch die vollständig entwickelte menschliche Sprache mit ihren komplexen grammatikalischen und syntaktischen Regeln ist möglicherweise nur dem Homo sapiens vorbehalten, was bedeutet, dass die Ursprünge der menschlichen Sprache lediglich auf einige Hunderttausend Jahre zurückgehen. Der Mensch verfügt nicht nur über eine mächtige Sprache, sondern ist auch einzigartig in seiner Fähigkeit, Sprache zu lehren, zu lernen und aufzuzeichnen. Noch interessanter ist, dass sich der Gesang offenbar weiterentwickelt hat, als sich die Menschen an die Veränderungen in der Stimmintonation gewöhnten. Diese Form bereichert nicht nur die Klanglandschaft dieser Welt zusätzlich, sondern ermöglicht es den Menschen auch, ihren Emotionen Ausdruck zu verleihen oder den Zusammenhalt der Gruppe zu stärken. In primitiven Stämmen werden viele wichtige Aktivitäten von einzigartigen Liedern und Tänzen begleitet. Auch in der heutigen Zeit ist das Singen eine der wichtigsten kulturellen Aktivitäten der menschlichen Gesellschaft. Man kann sagen, dass die menschliche Sprache eine der einflussreichsten Eigenschaften ist, die Organismen entwickelt haben. Unsere sozialen Gruppen und unsere soziale Zivilisation basieren auf der Sprache. Durch die Sprache konnten wir zusammenarbeiten und Technologien von der Landwirtschaft bis zum Space Shuttle erfinden, die wiederum zur modernen Klanglandschaft beigetragen haben. Obwohl unsere menschliche Stimme weder der älteste noch der lauteste oder süßeste Tierklang ist, hat sie die Welt in mancher Hinsicht grundlegend verändert. Dieser Artikel ist eine vom Science Popularization China Starry Sky Project unterstützte Arbeit Team-/Autorenname: Global Science Gutachter: Zhu Youan, assoziierter Forscher, Wirbeltierpaläontologie (Urfische), Institut für Wirbeltierpaläontologie und Paläoanthropologie, Chinesische Akademie der Wissenschaften Produziert von: Chinesische Vereinigung für Wissenschaft und Technologie, Abteilung für Wissenschaftspopularisierung Hersteller: China Science and Technology Press Co., Ltd., Beijing Zhongke Xinghe Culture Media Co., Ltd. |
>>: Zahnschmerzen sind keine Krankheit, aber wenn es wehtut ... ist es ein Herzinfarkt?
Artikel empfehlen
Dieses Gemüse ist einfach "natürliches MSG", in Wasser gekocht = "vegetarische Suppe", die so lecker ist, dass es einem die Augenbrauen herunterfallen lässt
Ein Topf köstlicher und erfrischender Suppe mit v...
Welche Methoden gibt es für das Training der Taillenkraft?
Wenn die Taillenkraft einer Person gut entwickelt...
Der "Wettbewerb" zwischen Android und iPhone aus der Perspektive des Cloud Computing
Dan Rowinski, ein Kolumnist für ausländische Medi...
Wie lange muss man Sit-ups machen, um abzunehmen?
Sit-ups sind eine Übungsform, die viele Menschen ...
Entdecken Sie spannende Unterhaltung, die Huawei VR Glass-Brille bietet Ihnen ein echtes Spaßerlebnis!
Da sich der Lebensstil der Menschen ändert, begin...
Ein gewöhnliches Seil brachte den Dicken tatsächlich vor Gericht
Elastische Seile nutzen beim Ziehen die Schwerkra...
Mit welchen Übungen lässt sich die Taille schlanker machen?
Obwohl manche Menschen eine sehr gute Figur zu ha...
Die „Reputationsmaschine“ ist wirklich vielversprechend! Neuer Durchbruch bei der ersten 50-MW-Hochleistungsgasturbine der F-Klasse meines Landes
Produziert von: Science Popularization China Auto...
Russlands fliegendes Elektroauto nimmt ab 500.000 Rubel Vorbestellungen entgegen
Am 26. Juni begannen russischen Medienberichten zu...
Wie können Männer abnehmen und stark werden?
Wie können Männer abnehmen, Sport treiben und ein...
Haben Sie immer ein juckendes Gefühl im Hintern? Seien Sie nicht unvorsichtig, es könnte sich um einen solchen Fehler handeln.
„Juckender Hintern“ ist den Menschen in Sichuan u...
Kann Sport die Vagina verkleinern?
Eine Vaginalverengung bei Frauen kann zu einer Ve...
Amap startet den Plan „Staubeseitigung“ und arbeitet mit Hunderten von Experten zusammen, um Lösungen für Staus zu untersuchen
Am 26. Juli 2018 gab Amap auf dem heute abgehalte...
Warum verwenden Huawei-Telefone immer HiSilicon-Prozessoren?
Huawei hat gerade das P7 herausgebracht, das immer...