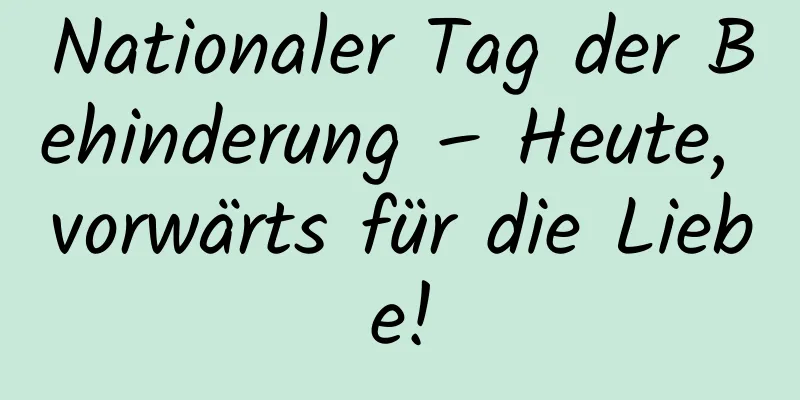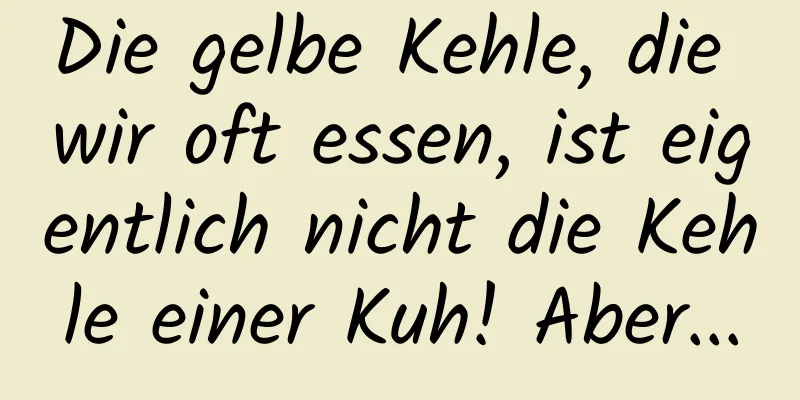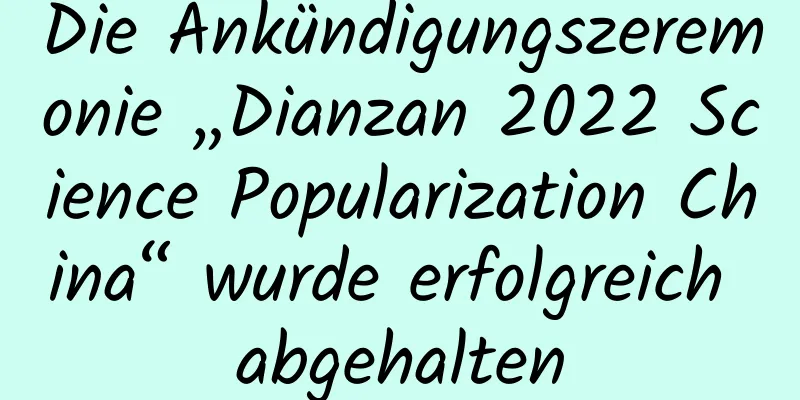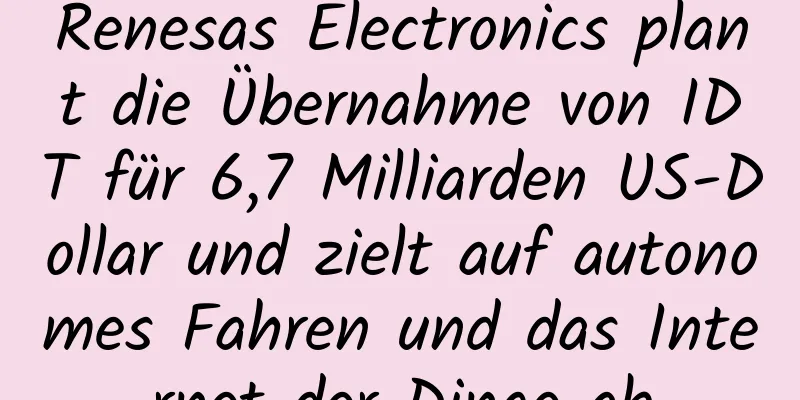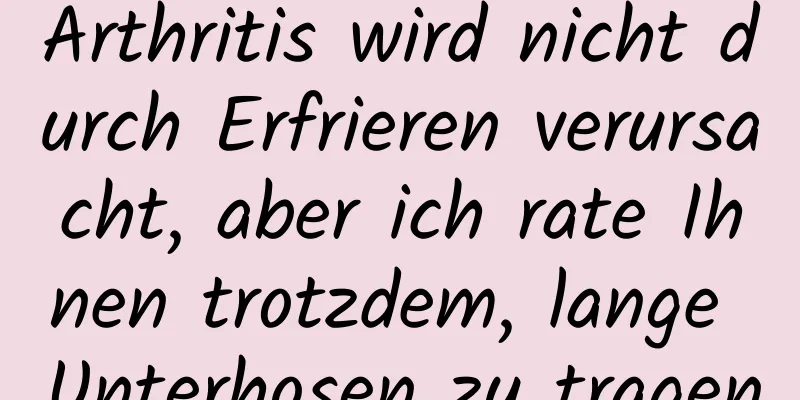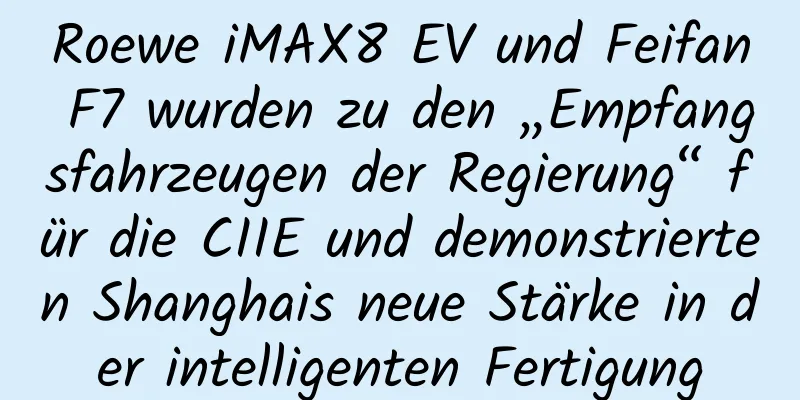„Waldbrände können nicht gelöscht werden, die Frühlingsbrise erweckt sie wieder zum Leben.“ Es stellt sich heraus, dass dies daran liegt, dass …
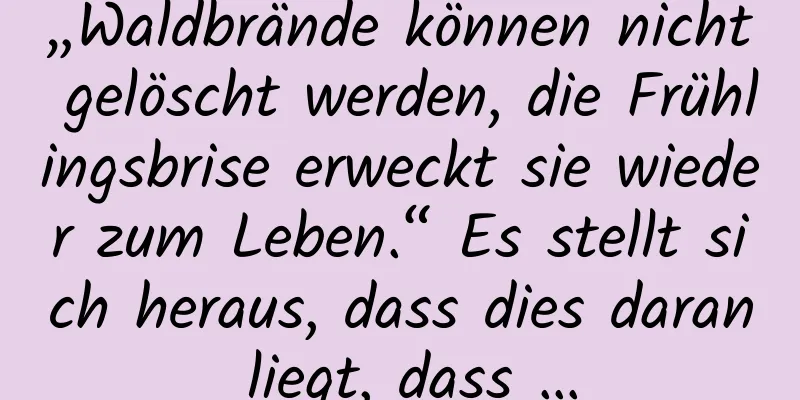
|
Wenn von Waldbränden die Rede ist, denken viele Menschen an diese Szene: wütende Flammen, die sich über die Prärie ausbreiten und alles zerstören. In der Natur sind jedoch nicht alle Waldbrände schädlich. Waldbrand auf Maui (Bildnachweis: Rebecca Hernandez (CC0)) Obwohl Waldbrände immer unermessliche Schäden in den Wäldern verursachen, haben einige Pflanzen nicht nur Wege gefunden, in den wütenden Feuern zu überleben, sondern können mit Hilfe der Waldbrände sogar gedeihen. Darüber hinaus können künstlich „gezähmte“ Waldbrände auch zu einem wirksamen Instrument zum Schutz der Artenvielfalt werden. Führen häufige Waldbrände zu einer größeren Artenvielfalt? Die meisten Menschen stellen sich vor, dass in Gebieten, in denen es häufig zu Bränden kommt, raue Bedingungen herrschen und weniger biologische Organismen vorhanden sind. Tatsächlich ist die Artenvielfalt in den von Waldbränden heimgesuchten Gebieten nicht geringer als in anderen Gebieten, sie ist sogar besser. Beispielsweise ist das mediterrane Klima mit heißen und trockenen Sommern sowie milden und regnerischen Wintern anfällig für Waldbrände. Die fünf mediterranen Klimazonen der Welt (Mittelmeerbecken, Kalifornien in den USA, Zentralchile, Kapregion in Südafrika und Südwestaustralien) sind ausnahmslos Hotspots der Artenvielfalt. Zusammen bedecken sie nur etwa 1,2 % der Landoberfläche der Erde, beherbergen aber etwa ein Sechstel aller Pflanzenarten der Welt. In allen mediterranen Klimazonen, mit Ausnahme Zentralchiles, besteht die Gefahr wiederkehrender Brände. Globale Verteilung der mediterranen Klimaregionen (Bildquelle: Referenz [1]) In einem mediterranen Klima kommt es in heißen, trockenen Sommern fast immer zu häufigen Bränden. Dadurch treten Brände sehr regelmäßig und vorhersehbar auf und stellen einen geeigneten Selektionsdruck dar, der die Evolutionsrichtung lokaler Pflanzen verändert. Derzeit gibt es mehrere Hypothesen, die erklären, wie Feuer die Pflanzenvielfalt fördert. Die Hypothese der intermediären Störung in der Ökologie besagt, dass Pflanzen bei zu kurzen Abständen zwischen Bränden möglicherweise nicht genügend Zeit haben, Samen und andere Fortpflanzungsorgane zu produzieren und ausgerottet werden könnten. ist das Intervall zu lang, kann die Lebensdauer der Anlage überschritten werden; und Brände in angemessenen Abständen fördern die Selbsterneuerung von Pflanzen, die genügend Samen produziert oder gespeichert haben. Die Hypothese der thermischen Diversität und Biodiversität geht davon aus, dass Brände in Ökosystemen neue kleinräumige „Mosaik“-Umgebungen schaffen, in denen in regelmäßigen Abständen kleine Bereiche mit unterschiedlichen Eigenschaften verteilt sind. Dadurch entstehen vielfältigere ökologische Nischen und die Voraussetzungen für das Eindringen weiterer Arten. Vor Hunderten von Millionen Jahren begannen Pflanzen, „mit dem Feuer zu gehen“ Wann begannen Pflanzen, sich an Feuer anzupassen? Holzkohlefossilien von vor 400 Millionen Jahren beweisen, dass Pflanzen schon vor langer Zeit der Bedrohung durch Feuer ausgesetzt waren (Wie man Waldbrände vor Hunderten von Millionen Jahren untersucht). Einige Studien haben gezeigt, dass Gymnospermen bereits vor etwa 100 Millionen Jahren einige an Feuer angepasste Merkmale entwickelt hatten , und dass die weite Verbreitung der Angiospermen in der Kreidezeit auch mit dem hohen Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre und den häufigen Bränden zu dieser Zeit zusammenhing. Während der langen Jahre des Lebens mit Feuer verschaffte die Anpassung an das Feuer einigen Pflanzenstämmen einen Wettbewerbsvorteil und trug zu ihrem Wohlstand bei. Pinus beispielsweise, die größte Gattung der Nacktsamer, umfasst mehr als 100 Arten und besiedelt ausgedehnte Nadelwälder auf der Nordhalbkugel. Ihre Verbreitung und Diversifizierung hängen eng mit der Anpassung an Feuer zusammen. Die nordamerikanische Kurzblattkiefer, Pinus banksiana, ist ein an Feuer angepasster Baum, der abgestorbene Äste an seinem Stamm behält, was seine Entflammbarkeit erhöht (Bildquelle: Referenz [4]) Pflanzen, die sich an Feuer anpassen können, sterben durch das Feuer nicht nur ihre Konkurrenten ab, wodurch ihnen mehr Ressourcen zur Verfügung stehen, sondern es bleiben auch große Mengen an Nährstoffen in der Asche zurück, die sie nutzen können (dieses Prinzip wird auch bei der Brandrodung in der Landwirtschaft angewendet). Gleichzeitig wirken die Hitze und die Chemikalien, die bei der Verbrennung freigesetzt werden (wie etwa Karzinogene im Rauch), auch als Mutagene und führen zu weiteren vererbbaren Variationen, wie etwa Genmutationen in Organismen , und liefern so Rohstoffe für die biologische Evolution. Welche Anpassungsmerkmale haben Pflanzen entwickelt, um diese Vorteile sinnvoll nutzen zu können? Tipps zum Schutz der Pflanzen vor Verbrennungen 1. Du kannst mich nicht verbrennen, du kannst mich nicht verbrennen Der einfachste und brutalste Weg, Feuer zu widerstehen, besteht darin, die mechanische Abwehr zu verstärken und inneres Gewebe durch eine harte Panzerung zu schützen. Bei dieser Pflanzenart handelt es sich vor allem um hohe Bäume mit dicker Rinde in Bodennähe, die dem Angriff von Bodenfeuer standhalten können. Gleichzeitig wachsen ihre Äste und Blätter oft weiter oben an der Pflanze und in der Mitte des Stammes befindet sich ein langer Abschnitt ohne Äste (die Äste sterben ab und fallen ab), wodurch eine Isolierschicht entsteht, die verhindert, dass die Flammen am Boden die oberen Äste und Blätter erreichen. Viele feuerbeständige Kiefern verfolgen diese Strategie. Darüber hinaus sind ihre Kiefernnadeln tendenziell länger und fallen lose zu Boden, wodurch sie sehr leicht entflammbar sind. So lässt sich leichter ein Bodenfeuer entfachen, um die toten Äste und Blätter zu entfernen und zu verhindern, dass sie sich zu dicht auftürmen. Auf diese Weise werden die Kiefern durch häufige Bodenbrände nicht nur nicht geschädigt, sondern sie werden auch dabei unterstützt, Konkurrenten wie beispielsweise Eichensetzlinge aus dem Wald zu entfernen. Allerdings besteht dabei auch die Gefahr, dass die eigenen Setzlinge verbrennen. Daher müssen die Setzlinge schnell wachsen, um außerhalb der Reichweite des Bodenfeuers zu sein. Die dicke, weiche Rinde der Myrica bella (Myrica spp.) in der brasilianischen Savanne wirkt als Isolator (Bildquelle: Referenz [4]) 2. Wenn es nicht durch Feuer verbrannt wird, wächst es nicht nach? Eine weitere wichtige Aufgabe der Pflanzen besteht im Brandfall darin, ihre Fortpflanzungsorgane zu schützen. Daher müssen die Samen von Pflanzen, die einem Brandrisiko ausgesetzt sind, sorgfältig geschützt werden, damit sie die Flammen überleben können. Viele Pflanzen haben eine Eigenschaft namens Serotinie entwickelt, bei der ihre Samen in holzigen Früchten oder Zapfen geschützt sind. Sie platzen nicht sofort nach der Reifung, sondern erst nach dem Backen bei hohen Temperaturen auf und geben die darin enthaltenen Samen frei. Diese Eigenschaft macht die Pflanze resistent gegen Kronenfeuer. Selbst wenn Äste und Blätter der Baumkrone bei einem Brand erheblichen Schaden nehmen, kann sich die Pflanze erfolgreich vermehren, solange die Samen intakt sind. An den Stämmen dieser Bäume bleiben oft einige tote Äste hängen, die die Flammen in Richtung der Baumkronen lenken und so die Verbreitung der Samen durch das Feuer fördern. Derzeit wird angenommen, dass mehr als 1.200 Pflanzenarten über dieses Merkmal verfügen, darunter repräsentative Gruppen wie Pinus, einige Gattungen der Familie der Proteaceae (wie Banksia und Protea) und einige Gattungen der Familie der Cupressaceae (wie Cupressus und Callitris). Geschlossene Zapfen von Pinus brutia vor dem Brand (Bildquelle: Referenz [4]) Die Zapfen der Mittelmeerzypresse Cupressus sempervirens sind nach dem Verbrennen gesprungen (Bildquelle: Referenz [4]) 3. Das wütende Feuer weckte mich ... Im Allgemeinen sind nach einem Brand die meisten brennbaren Materialien auf dem Boden verbrannt, sodass es schwierig ist, innerhalb kurzer Zeit erneut ein Feuer zu entfachen. Einige Pflanzensamen nutzen diese Zeit zum Keimen und Wachsen. Ihre Samenschalen weisen eine hohe mechanische Festigkeit auf und sind relativ feuerbeständig. Nach der Reife durchlaufen sie eine Ruhephase und keimen nur, wenn sie Feuer ausgesetzt werden. So besitzen beispielsweise manche Hülsenfrüchte Samen mit einer harten Außenhaut, die normalerweise wasserundurchlässig ist und erst nach einer Verbrennung Wasser aufnehmen und keimen kann. Andere Pflanzensamen, wie etwa Audouinia capitata in Südafrika, erkennen Feuer anhand der bei der Verbrennung entstehenden Chemikalien und keimen, wenn sie einer im Rauch enthaltenen Verbindung namens Karrikinolid ausgesetzt werden. Audouinia capitata (Bildnachweis: www.gbif.org) 4. Verbrannt, aber nicht völlig tot Nicht nur die Samen, sondern auch viele feuerresistente Pflanzen selbst verfügen über ein starkes Regenerationsvermögen und können in der Zeit nach dem Brand erneut austreiben. Die verkohlte Farbe nach einem Brand bedeutet nicht, dass die Pflanze verbrannt ist. Die überlebenden unterirdischen Organe oder Stammbasen können die Flammen oft überstehen und lassen Hoffnung auf Leben bestehen. In Gebieten, in denen es immer wieder zu Bränden kommt, entwickeln viele Gehölze an der Verbindung von Wurzel und Stamm eine vergrößerte holzige Kronenstruktur, in der Nährstoffe gespeichert werden und ruhende Knospen entstehen. Einige Gruppen, wie etwa Eukalyptus, können auch nach einem Brand aus dem verbleibenden Hauptstamm neu austreiben. Adenostoma fasciculatum in Südkalifornien, Neuaustrieb aus holzigen Knollen nach einem Brand (Bildquelle: Referenz [4]) In der Zeit nach dem Brand sind die Ressourcen am reichlichsten und der Wettbewerbsdruck am geringsten. Das Abbrennen von Deckung schafft eine offenere Umgebung, erhöht die Anzahl der Bestäuber und ist daher förderlich für die Fortpflanzungsaktivitäten der Pflanzen. Beispielsweise absorbiert Nuytsia floribunda, ein parasitärer Baum aus der Familie der Loranthaceae, Nährstoffe, indem er die Wurzeln anderer Pflanzen parasitiert. Nach einem Brand ersetzt es die verbrannte Rinde durch abnormales Sekundärwachstum und bildet große Rispen entlang der überlebenden Zweige. Nuytsia floribunda (Fotoquelle: www.gbif.org) Wie Menschen Feuer zum Schutz von Ökosystemen nutzen In Gebieten, in denen es häufig zu Bränden kommt, ist Feuer zu einem unverzichtbaren Bestandteil des lokalen Ökosystems geworden. Genau wie bei Dayus Hochwasserschutz ist es besser, Wasser abzulassen als zu blockieren. Die Menschen versuchen, die Gesundheit des Ökosystems zu erhalten, indem sie das Auftreten von Bränden künstlich kontrollieren. Proteaceae-Pflanzen vermehren sich in Südafrika durch Verbrennen, um ihre Früchte zu öffnen und Samen freizugeben. Das erfolgreiche Wachstum der Setzlinge hängt jedoch von der Jahreszeit und Größe des Feuers sowie den klimatischen Bedingungen vor und nach dem Feuer ab. Die feuchte Umgebung nach dem Brand begünstigt die Keimung der Samen, während eine anhaltende Dürre während der Keimlingsperiode wahrscheinlich zum Tod der Samen führt. Daher ist es für das Gesundheitsmanagement der Gemeinde vorteilhafter, Brände vor der Regenzeit durch künstliche Zündung zuzulassen. Auch in unserem Land gibt es Fälle, in denen Menschen Feuer zum Schutz der Artenvielfalt einsetzen. Zum Schutz der Cycas panzhihuaensis, einer national erstklassig geschützten Pflanze, wurde künstlich eingeleitetes Feuer eingesetzt. Durch den Einsatz von Feuer lässt sich nicht nur das Wachstum der Sträucher kontrollieren und deren Behinderung der Panzhihua-Cycas verringern, sondern auch einige Schädlinge abtöten und das Ausmaß ihrer Schäden verringern. Darüber hinaus können manuell gelegte Feuer die Schuttansammlungen unter dem Wald beseitigen und so verhindern, dass zu große Schuttansammlungen große, unkontrollierbare Brände verursachen. Das Sichuan Panzhihua Cycad National Nature Reserve führt ein Experiment mit künstlichem Feuer durch (Fotoquelle: China National Radio) Durch menschliches Eingreifen ausgelöste Brände dienen nicht nur dem Pflanzenschutz, sondern haben auch einen praktischen Nutzen für den Schutz der Tierwelt. So können beispielsweise gezielte Brände die Vielfalt und Biomasse krautiger Pflanzen wirksam erhöhen, die Höhe holziger Pflanzen verringern und Sikahirschen mehr Möglichkeiten zur Nahrungssuche bieten. Der gezielte Einsatz von Bränden zur Schaffung einer Mosaikverteilung verschiedener Lebensraumtypen ist für das Überleben und die Fortpflanzung des Sikahirsches sehr förderlich. Warum müssen wir der Waldbrandprävention weiterhin Aufmerksamkeit schenken? Aus dem oben Gesagten lässt sich schließen, dass die Anpassung der Pflanzen an das Feuer der Überquerung des Meeres durch die Acht Unsterblichen gleicht, wobei jeder von ihnen seine eigenen magischen Kräfte zeigt. Manche Leute denken vielleicht: Können wir Waldbrände einfach in Ruhe lassen, wenn Pflanzen sich an Feuer anpassen können und Feuer einer der Gründe für die zunehmende Artenvielfalt ist? Die Antwort ist natürlich nein. Die Anpassungsfähigkeit feuerresistenter Pflanzen ist heute das Ergebnis einer langjährigen Koexistenz mit periodischen Bränden, doch nicht alle Wälder leben in einer solchen Umgebung. Zu viel ist genauso schlecht wie zu wenig. Brände, die ein bestimmtes Ausmaß überschreiten, können verheerende Auswirkungen auf das Ökosystem haben. Insbesondere in den letzten Jahren haben der Klimawandel und menschliche Aktivitäten dazu geführt, dass Waldbrände häufiger auftreten und Waldpflanzen größeren Risiken ausgesetzt sind. Menschliche Eingriffe in Brandschutzmaßnahmen erfordern gründliche wissenschaftliche Forschung, um den Schwellenwert zu finden, der für den Schutz des Ökosystems am förderlichsten ist. Wir sollten die Beziehung zwischen Pflanzen und Feuer wissenschaftlich verstehen, sie rational nutzen, sie wissenschaftlich verhindern und kontrollieren und das grüne Herz der Erde schützen. Quellen: [1] Rundel PW, et al. Feuer und Pflanzendiversifizierung in Regionen mit mediterranem Klima. Frontiers in Plant Science, 2018, 9. Doi: 10.3389/fpls.2018.00851 [2] He TH, et al. Feuer als Haupttreiber der Artenvielfalt der Erde. Biological Reviews, 2019, 94 (6): 1983-2010. [3] He TH, et al. Ein 350 Millionen Jahre altes Erbe der Feueranpassung bei Nadelbäumen. Journal of Ecology, 2015, 104 (2): 352-363. [4] Keeley JE, et al. Evolutionäre Ökologie des Feuers. Jahresbericht zu Ökologie, Evolution und Systematik, 2022, 53: 203-225. [5] Jin WT, et al. Phylogenomische und ökologische Analysen enthüllen die räumlich-zeitliche Evolution der Kiefern weltweit. PNAS, 118 (20) e2022302118 [6] Keeley JE Ökologie und Evolution der Lebensgeschichten von Kiefern. Annals of Forest Science, 2012, 69: 445-453. [7] Keeley JE, et al. Feuer als evolutionärer Druck, der die Eigenschaften von Pflanzen prägt. Trends in Plant Science, 2011, 16 (8): 406-411. [8] Lamont BB, et al. Evolutionsgeschichte des durch Feuer angeregten Wiederaustriebs, der Blüte, der Samenfreisetzung und der Keimung. Biological Reviews, 2019, 94 (3): 903-928. [9] Lamont BB, et al. Durch Feuer angeregte Blüte bei Wiederaustriebspflanzen und Geophyten in Australien und Südafrika. Pflanzenökologie, 2011, 212: 2111–2125. [10] Heelemann S., et al. Auswirkungen der Brandsaison auf die Rekrutierung nicht keimender serotinöser Proteaceae im östlichen (bimodaler Niederschlag) Fynbos-Biom, Südafrika. Austral Ecology, 2008, 33 (2): 119-127. [11] Lebende Fossilien der „Feuer“-Pflanze schützen die zum Nationalschatz gehörende Pflanze Panzhihua Cycas revoluta. Chinesisches Nationalradio. http://sc.cnr.cn/sc/2014sz/20160216/t20160216_521386014.shtml [12] Jiang Zhigang, Qin Haining, Li Chunwang, Liu Wuhua, Liu Jian et al. Studie zur Artenvielfalt im nationalen Naturschutzgebiet Taohongling Sika Deer, Provinz Jiangxi. 2009. Peking: Tsinghua University Press. Autor: Wei Zhourui Dieser Artikel stammt vom öffentlichen Konto „Science Academy“. Bitte geben Sie beim Nachdruck die Quelle des öffentlichen Kontos an. |
>>: Was hat Pluto falsch gemacht, dass er aus dem Sonnensystem „vertrieben“ wurde?
Artikel empfehlen
Lernen Sie diese Methoden und Ihnen wird nie wieder Reisekrankheit auftreten!
Viele Menschen leiden unter Reisekrankheit, die i...
nicht gut! Die mysteriösen "Teigpickel", die von den Wellen angespült wurden丨Environmental Trumpet
Hallo zusammen, dies ist die 25. Ausgabe der Kolu...
Was ist besser: zügiges Gehen oder Joggen?
Morgens und abends finden auf dem Campus, im Gelä...
Welche Vorteile bietet das Straßenradtraining?
Radfahren ist derzeit eine sehr gute nationale Fi...
Was ist der Nordost-Kältewirbel?
„Im April hat es wieder angefangen zu schneien“, ...
91 Zehn Artikel: Teslas Bremsversagen trat in Hangzhou erneut auf, BMW wird einen Wasserstoff-Brennstoffzellen-Crossover X5 auf den Markt bringen
1. Der Finanzbericht von Xpeng Motors für das ers...
Ist es gut, jeden Tag zu laufen?
Heutzutage sind die Menschen in ihrem Leben und b...
Mobile Sales: Ein zukunftssicheres Vertriebsmodell
Liquidität Wir konzentrieren uns auf drei Branche...
Erinnern Sie sich an Dorie, den blauen Fisch in „Findet Nemo“? Es "existiert" wirklich
Blaue Teufelsfische bewohnen hauptsächlich die Ko...
Der „3Q-Krieg“ ist ein Urteil über den Pseudowettbewerb
Die Entwicklung des „3Q-Krieges“ und das endgülti...
So bauen Sie schnell Muskeln auf
Muskeltraining ist besonders für Männer wichtig. ...
Wissen Sie, wie Sie Ihre Muskeln entspannen können?
Ich weiß nicht, ob Sie oft ins Fitnessstudio gehe...
Kann man durch Sonnenbaden durch Glas nicht Kalzium ergänzen?
Seit unserer Kindheit sehen wir in der Werbung hä...
Können Liegestütze beim Abnehmen helfen?
Liegestütze sind eine Trainingsform, die viele Mä...