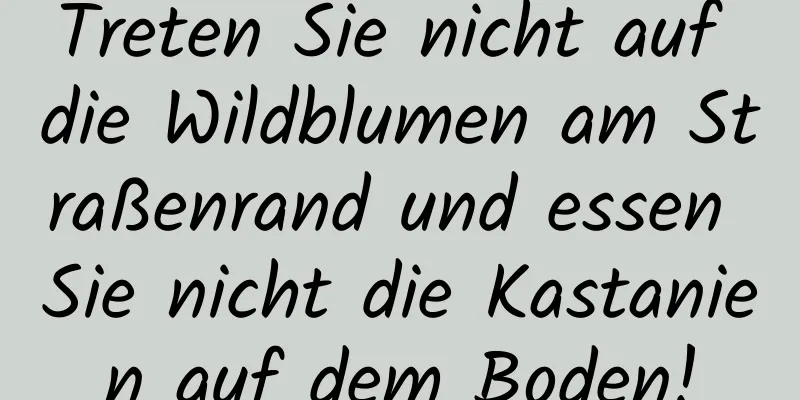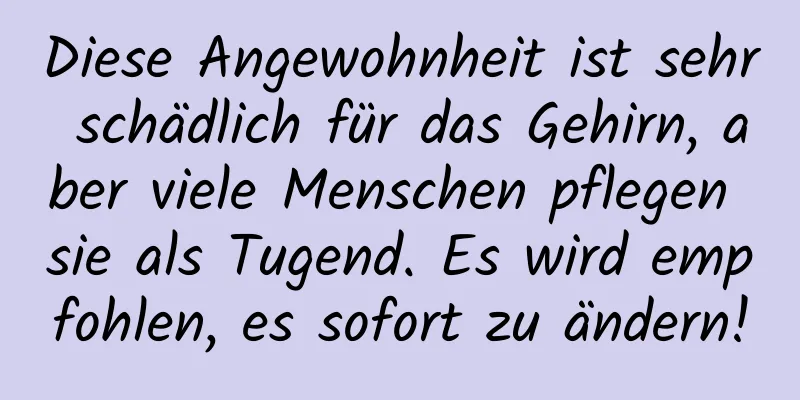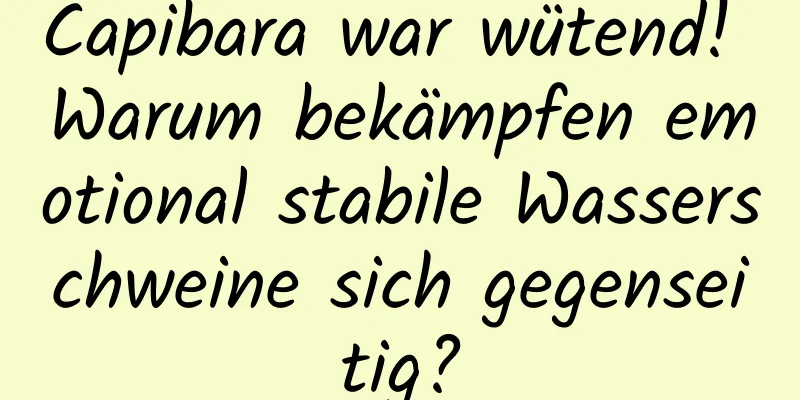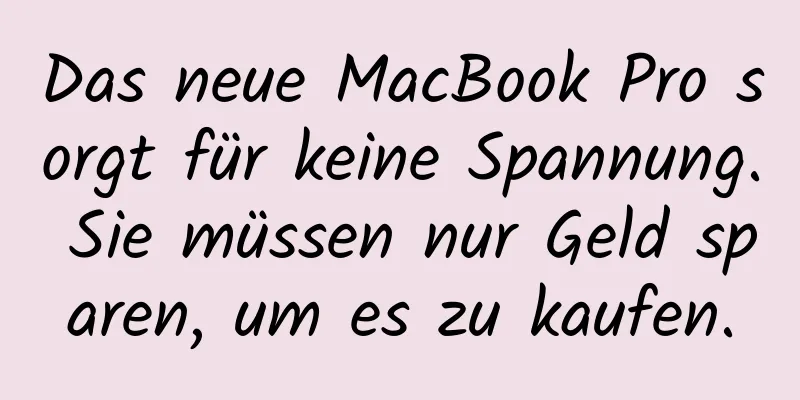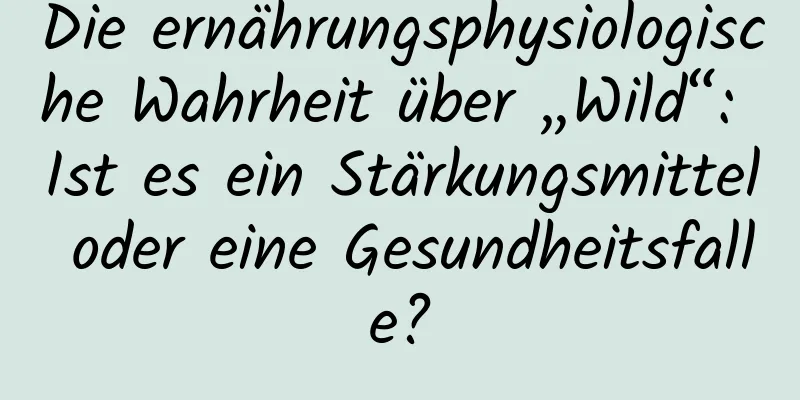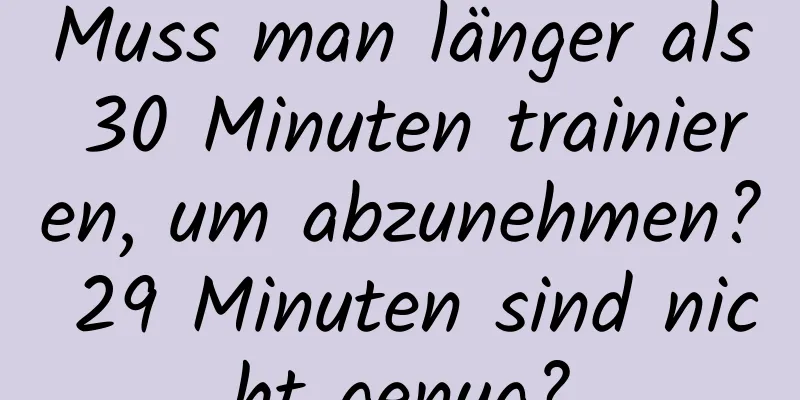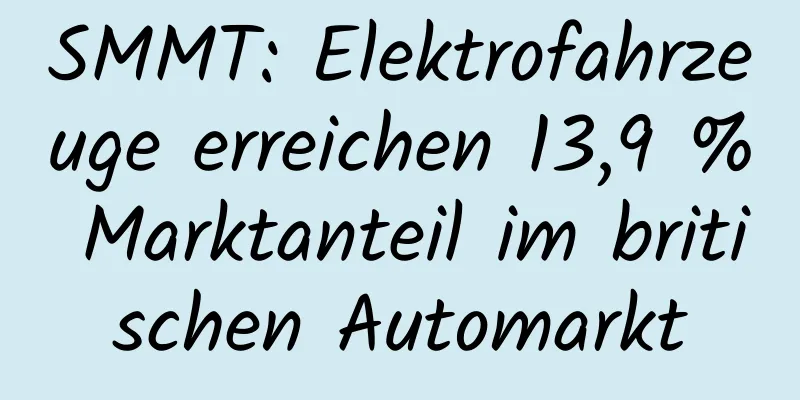Sie züchtete ein Virus, um ihren eigenen Krebs zu heilen. Können „Selbstexperimente“ den wissenschaftlichen Fortschritt fördern?
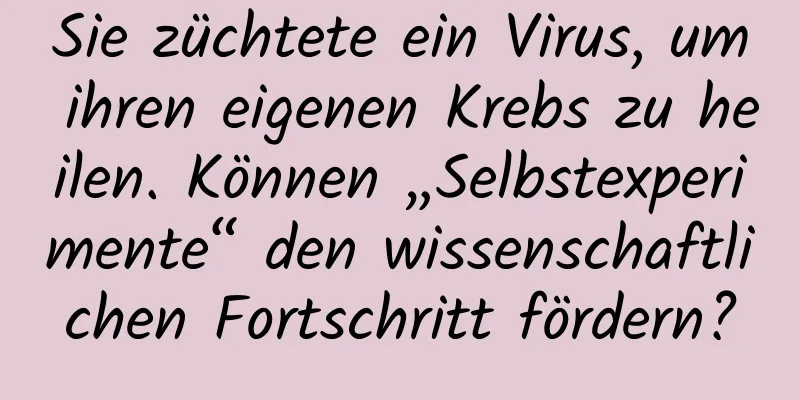
|
Im Jahr 2020 trat bei Beata Halasi zum zweiten Mal ein Brustkrebsrückfall auf. Sie litt an der aggressivsten und gefährlichsten Form von Brustkrebs und, was noch schlimmer war, sie konnte die Chemotherapie nicht fortsetzen. Es war fast ein Todesurteil. Doch glücklicherweise ist sie Virologin und entschied sich nach der Lektüre umfangreicher Literatur für eine onkolytische Virustherapie, deren Wirksamkeit bei Brustkrebs bisher nicht nachgewiesen war. Mit Hilfe seiner Kollegen injizierte Harasi das kultivierte Virus in den Tumor. Nach einer zweimonatigen Behandlung war die Tumorgröße deutlich reduziert (von hart auf weich) und es traten keine schwerwiegenden Nebenwirkungen auf. Darüber hinaus bildeten sich auch die aggressiven Ränder der Tumore zurück, sodass diese leichter operativ entfernt werden konnten. Die Analyse der entfernten Tumoren zeigte, dass sie vollständig mit Lymphozyten infiltriert waren, was darauf schließen lässt, dass die onkolytische Virustherapie wie beabsichtigt gewirkt und das Immunsystem dazu angeregt hatte, sowohl das Virus als auch die Tumorzellen anzugreifen. Nach der Operation erhielt Halasi ein Jahr lang Medikamente gegen Krebs. Im August dieses Jahres veröffentlichte Halasi seinen Fallbericht über die Krebsbekämpfung mit Impfstoffen. Geschrieben von | Wang Chenguang Krebs war schon immer eine große Herausforderung für die moderne Medizin. Trotz der kontinuierlichen Verbesserung der Behandlungsmethoden sind viele Patienten in einem bestimmten Stadium ihrer Krankheit immer noch mit der Situation konfrontiert, dass ihre Krankheit nicht mehr heilbar ist. Vor diesem Hintergrund ist das Konzept einer viralen Krebstherapie allmählich in das öffentliche Bewusstsein gerückt. Die kroatische Virologin Beata Halassy hat in den letzten Jahren zur Virustherapie bei Brustkrebs geforscht und ihre Versuchsergebnisse in wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht. Bemerkenswerterweise beteiligte sich Halasi nicht nur an der Forschung, sondern nutzte das im Labor entwickelte Virus auch persönlich zur Behandlung ihrer eigenen Brustkrebsdiagnose. Dieser mutige Schritt hat der Virustherapie große Aufmerksamkeit in den Medien und der Öffentlichkeit beschert. Beata Harasi | Ivanka Popić Es sei darauf hingewiesen, dass die Virotherapie keine originäre Erfindung des Harasi-Labors ist. Dieses Konzept wurde bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts vorgeschlagen und hat viele Jahre der Entwicklung durchlaufen. Halasis Forschung liefert weitere Datenunterstützung auf der Grundlage früherer Forschungen. Die Virustherapie hat Krebspatienten neue Hoffnung gegeben und ihr Potenzial in der Tumorbehandlung unter Beweis gestellt. Da Halasis Selbstbehandlung jedoch eine hitzige Debatte auslöste, traten auch medizinethische Fragen zutage. Auch die Geschichte der Selbstversuche der Wissenschaftler und die ethischen Herausforderungen der Virustherapie verdienen eingehende Überlegungen. Viren können Waffen gegen Krebs sein Wenn Menschen „Virus“ erwähnen, denken sie oft an tödliche Infektionskrankheiten wie Pocken, Ebola und COVID-19. Viren sind jedoch nicht nur eine Bedrohung für die menschliche Gesundheit. Unter bestimmten Bedingungen können sie auch zu Waffen gegen Krebs werden. Die onkolytische Virotherapie ist eine Behandlungsmethode, bei der Viren eingesetzt werden, um Tumorzellen zu infizieren und Tumorgewebe zu zerstören. Mithilfe gentechnischer Verfahren können Wissenschaftler spezifische Viren entwickeln, die Tumorzellen angreifen und gleichzeitig eine Schädigung normaler Zellen vermeiden. In ihrer Forschung auf dem Gebiet des Brustkrebses setzte Beata Harasi erfolgreich genetisch veränderte onkolytische Viren ein, um Krebszellen gezielt anzugreifen. Ihr Team hat die Genombearbeitung des Virus so verfeinert, dass es gezielt Brustkrebszellen angreift, ohne normales Gewebe zu schädigen. Durch diese gezielte Behandlung werden Schäden an normalen Zellen während der Behandlung erheblich reduziert und das Risiko von Nebenwirkungen verringert. Durch präklinische Experimente zeigte die Forschung des Halasi-Teams, dass das modifizierte Virus nicht nur Krebszellen wirksam abtöten, sondern auch das körpereigene Immunsystem des Patienten aktivieren und die Fähigkeit verbessern kann, verbleibende Tumorzellen zu beseitigen. Die Entdeckung bietet einen völlig neuen Behandlungsansatz für Brustkrebspatientinnen und zeigt Potenzial für ein breiteres Spektrum von Krebsbehandlungen. Obwohl Halasis Forschung für die Medien und die Öffentlichkeit erfrischend war, ist die onkolytische Virustherapie kein neues Konzept. Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts stellten Mediziner fest, dass die Tumore mancher Patienten nach einer Virusinfektion Anzeichen einer Schrumpfung oder sogar eines Verschwindens zeigten. Dieses Phänomen war der erste Anstoß für die Forschung zur onkolytischen Virustherapie. Mitte des 20. Jahrhunderts entdeckten amerikanische Wissenschaftler, dass das Rötelnvirus das Wachstum bestimmter Krebszellen in vitro hemmen kann, was den Grundstein für die spätere Entwicklung der Virustherapie legte. Mit Beginn des 21. Jahrhunderts ist es Wissenschaftlern dank der rasanten Entwicklung der Technologie zur Genomeditierung gelungen, Viren präzise zu konstruieren und so ihre Fähigkeit, Krebszellen gezielt anzugreifen, erheblich zu verbessern. Im Jahr 2015 genehmigte die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) das erste onkolytische Virusmedikament, T-VEC (Talimogene laherparepvec), zur Behandlung von fortgeschrittenem Melanom. Dieser Meilenstein stellt einen entscheidenden Schritt beim Übergang der Virustherapie vom Labor in die Klinik dar. Seitdem hat eine wachsende Zahl klinischer Studien gezeigt, dass die onkolytische Virustherapie bei einer Reihe von Krebsarten, darunter Lungenkrebs, Hirnkrebs und Prostatakrebs, vielversprechend ist. Unter onkolytischen Viren (OV) versteht man kein bestimmtes Virus, sondern alle Viren, die Tumorzellen selektiv infizieren und abtöten können. Die onkolytische Virustherapie unterscheidet sich von herkömmlichen Krebsbehandlungen dadurch, dass sie ihre Antitumorwirkung über zwei Hauptmechanismen entfaltet. Die erste besteht darin, Tumorzellen direkt „aufzulösen“. Onkolytische Viren können Tumorzellen infizieren und sich in ihnen vermehren, infizierte Zellen zersetzen und sich auf andere Tumorzellen ausbreiten, was letztendlich zur Lyse und zum Tod der Tumorzellen führt. Die zweite besteht in der Stimulierung der Immunantwort, die das Immunsystem des Wirtes durch die Freisetzung tumorassoziierter Antigene aktiviert und eine anhaltende Anti-Tumor-Immunantwort hervorruft. Durch diese Doppelwirkung sind onkolytische Viren nicht nur in der Lage, Tumore direkt abzutöten, sondern auch das Immunsystem des Wirtes zu mobilisieren, um eine umfassendere Tumorbeseitigung zu erreichen. Dadurch wird in manchen Fällen eine länger anhaltende therapeutische Wirkung als bei herkömmlichen Therapien erzielt. Darüber hinaus können mithilfe moderner Gentechnik onkolytische Viren so verändert werden, dass sie Tumorzellen gezielter infizieren. Beispielsweise können Zytokin-Gene (wie GM-CSF) eingefügt werden, um die lokale Anti-Tumor-Immunreaktion weiter zu verstärken. In den letzten Jahren wurden bei onkolytischen Viren in der Forschung und klinischen Anwendung erhebliche Fortschritte erzielt und eine Vielzahl von Viren wurden zur Krebsbehandlung erprobt. T-VEC beispielsweise ist ein genetisch verändertes Herpes-simplex-Virus (HSV-1), das in den USA zur Behandlung von Melanomen zugelassen ist. T-VEC wird direkt in die Tumorstelle injiziert, infiziert und tötet Tumorzellen, während es gleichzeitig eine lokale Immunantwort aktiviert und so den Immunangriff auf Krebszellen verstärkt. Adenoviren sind ein weiteres häufiges onkolytisches Virus, das in der onkolytischen Virusforschung häufig verwendet wird, da es leicht zu modifizieren ist und ein breites Infektionsspektrum aufweist. „Ankorui“ ist das erste in China zugelassene adenovirale onkolytische Virus zur Behandlung von Plattenepithelkarzinomen im Kopf- und Halsbereich. Aufgrund seiner natürlichen Immunogenität und seiner tumorspezifischen Eigenschaften hat sich das Masernvirus in den letzten Jahren zu einem Forschungsschwerpunkt entwickelt. Die onkolytische Therapie mit Masernviren hat in klinischen Studien bei verschiedenen Krebsarten, darunter Eierstockkrebs und Melanom, Potenzial gezeigt. „Arsenal“ exogener Krankheitserreger Neben Viren werden auch Bakterien seit langem in der Tumorbehandlung erforscht. William Coley war ein Pionier der Bakterientherapie. Im späten 19. Jahrhundert stellte er fest, dass die Tumore einiger Krebspatienten nach einer Infektion mit Bakterien schrumpften oder sich zurückbildeten. Auf dieser Grundlage spekulierte er, dass die durch die Infektion ausgelöste Immunreaktion dazu beitragen könnte, Tumorzellen abzutöten. Coley entwickelte eine Mischung aus inaktivierten Streptokokken und anderen Bakterien namens „Coley-Toxin“, die injiziert wurde, um das Immunsystem des Patienten zur Bekämpfung von Tumoren anzuregen. Obwohl diese Therapie später durch moderne Krebsbekämpfungstechnologien ersetzt wurde, legte sie einen wichtigen Grundstein für die Immuntherapie. Die Anwendung von Bakterien in der Krebstherapie basiert auf ihrer Fähigkeit, sich im hypoxischen, nährstoffreichen Tumormikroumfeld zu vermehren. Die Fähigkeit anaerober Bakterien wie Clostridium, in Tumorgewebe zu wachsen, hat Wissenschaftler dazu veranlasst, ihr Potenzial als Antitumorvektoren zu untersuchen. Durch genetische Veränderung können Bakterien Träger von Antikrebsgenen oder Toxinen sein und diese gezielt im Tumor freisetzen, wodurch die abtötende Wirkung verstärkt wird. Darüber hinaus kann eine bakterielle Infektion das Immunsystem aktivieren und so die Tumorbeseitigung weiter fördern. Beispielsweise kann sich die genetisch veränderte Salmonella VNP20009 in hypoxischen Bereichen von Tumoren vermehren und Antitumorfaktoren freisetzen. Derzeit werden klinische Studien der Phase I für Melanome und solide Tumoren durchgeführt. Clostridium und Escherichia coli werden auch häufig in der bakteriellen Krebsforschung eingesetzt und weisen großes Potenzial auf, doch die Sicherheit und Toxizitätskontrolle bleiben für zukünftige klinische Anwendungen eine Herausforderung. Zu den größten Herausforderungen bei der bakteriellen Therapie zählen die Kontrolle der Toxizität der Bakterien, um zu verhindern, dass sie normales Gewebe schädigen, und die Schwierigkeit, die Verteilung und Vermehrung der Bakterien im Körper präzise zu kontrollieren. Daher sind weitere Studien erforderlich, um die Sicherheit und Zielgerichtetheit der Bakterien zu optimieren. Mit der Entwicklung der synthetischen Biologie nutzen Wissenschaftler immer ausgefeiltere Techniken zur Genomeditierung, um Bakterien so zu modifizieren, dass sie im Tumormikroumfeld eine präzisere therapeutische Rolle spielen können. Neben Viren und Bakterien wurden auch andere exogene Mikroorganismen wie Pilze und Parasiten auf ihre Antitumorwirkung untersucht. Die einzigartigen Mechanismen dieser Art von Mikroorganismen liefern neue Ideen für die Antitumorbehandlung. Zurück zur onkolytischen Virustherapie: Obwohl sie ein gewisses klinisches Potenzial gezeigt hat, ist sie auch mit einigen Problemen konfrontiert. Eines der größten Probleme besteht darin, die Wirksamkeit der Behandlung sicherzustellen und gleichzeitig Nebenwirkungen zu vermeiden, insbesondere da der Wirkmechanismus auf das Immunsystem noch nicht vollständig geklärt ist. Obwohl eine Virusinfektion Krebszellen direkt zerstören und das Immunsystem durch die Freisetzung von Antigenen aktivieren kann, um eine Anti-Tumor-Immunreaktion hervorzurufen, ist der spezifische Regulierungsmechanismus dieses Prozesses komplex und muss noch weiter erforscht werden. Eine der größten Herausforderungen ist die komplexe Beziehung zwischen dem Virus und dem Immunsystem des Wirts. Das Virus kann das Immunsystem nicht nur dazu aktivieren, den Tumor anzugreifen, sondern es kann auch das therapeutische Virus schnell beseitigen und so seine Ausbreitung und Wirkung im Tumor einschränken. Wie dieses „Immungleichgewicht“ ausgeglichen werden kann, ist in den Fokus der Forschung gerückt. Darüber hinaus gibt es Unterschiede in der Art und Weise, wie Viren Krebszellen gezielt angreifen, ohne normale Zellen zu schädigen, insbesondere in der Wirksamkeit und Sicherheit bei verschiedenen Tumorarten. Um diese Probleme zu überwinden, erforschen Forscher genetisch veränderte Viren und Kombinationstherapien, um die Selektivität und die immunaktivierende Wirkung onkolytischer Viren zu verbessern. Diejenigen, die mutig genug sind, „mit sich selbst zu experimentieren“ Auslöser des Nachrichteneffekts waren nicht etwa die Fortschritte in der viralen Krebsbehandlungstechnologie, sondern die Tatsache, dass Halasi zur Behandlung seiner eigenen Krebserkrankung im Labor entwickelte Viren einsetzte und die Ergebnisse in Form einer wissenschaftlichen Arbeit öffentlich machte. Ist an diesem Verhalten an sich, abgesehen von den technischen Problemen der viralen Krebsbehandlung, irgendetwas falsch? Halasi nutzte ihre eigene Forschung zur Behandlung ihres Brustkrebses, was man als „Selbstversuch“ bezeichnen könnte. Diese Situation ist in der Geschichte der Biowissenschaften nicht ungewöhnlich. Um den wissenschaftlichen Fortschritt voranzutreiben, nutzen viele Wissenschaftler sich selbst sogar als Versuchsobjekte. In den 1980er Jahren beispielsweise stellte der australische Arzt Barry Marshall die These auf, dass Magengeschwüre nicht durch Stress oder Ernährung, sondern durch ein Bakterium namens Helicobacter pylori verursacht würden. Allerdings wurde diese Hypothese damals von der medizinischen Fachwelt stark in Frage gestellt. Um diese Theorie zu beweisen, beschloss Marshall, sich mit den Bakterien zu infizieren. Er trank eine Lösung mit Helicobacter pylori und entwickelte schnell Symptome eines Magengeschwürs, das mit Antibiotika erfolgreich geheilt werden konnte, was seine Theorie letztendlich bestätigte. Dieser mutige Selbstversuch revolutionierte die Behandlung von Magengeschwüren und brachte ihm 2005 den Nobelpreis für Medizin ein. Während meiner Tätigkeit an der Thomas Jefferson University nahm ich am Empfang von Dr. Marshall teil und war Gastgeber eines Mittagessens für Doktoranden und Marshall. Bei dem Treffen fragte ein Student, warum Marshall sich entschieden habe, seine Forschungshypothese selbst zu testen. Marshall erinnerte sich an die Schwierigkeiten, mit denen er während seiner Forschung konfrontiert war, insbesondere an die starken Zweifel seiner Kollegen. Er erwähnte, dass seine Artikel trotz mehrmaliger Einreichung immer wieder von Zeitschriften zur Veröffentlichung abgelehnt wurden. In einem derart kritischen Umfeld ist es offensichtlich äußerst schwierig, auf Grundlage von Forschungsergebnissen die Genehmigung für klinische Versuche zu erhalten. Der amerikanische Arzt Walter Reed leitete Ende des 19. Jahrhunderts eine Studie, die die Verbreitung des Gelbfiebers aufdecken sollte. Um die Theorie zu bestätigen, dass Gelbfieber durch Mücken übertragen wird, beschlossen Reid und sein Team, sich dem Risiko einer Infektion auszusetzen. Sie ließen sich von Mücken stechen und zeichneten die Entwicklung der Symptome auf. Obwohl dieses Experiment die Gelbfieberforschung entscheidend voranbrachte, führte es auch zur Infektion zahlreicher Wissenschaftler und Versuchsteilnehmer, einige starben sogar daran. Der Chirurg John Hunter aus dem 18. Jahrhundert ist vor allem für seine Beiträge zur Physiologie bekannt, einige seiner Experimente waren jedoch umstritten. Um sexuell übertragbare Krankheiten zu untersuchen, injizierte er sich Sekrete von Menschen mit Gonorrhoe und Syphilis, um die Ausbreitung der Krankheit und die Entwicklung der Symptome zu beobachten. Obwohl dieser äußerst riskante Selbstversuch einige wichtige Daten für die Medizin lieferte, führte er in seinen späteren Jahren auch zu seinen eigenen gesundheitlichen Problemen. Albert Calmette und Camille Guérin: 1921 impften sie sich selbst mit lebenden Pasteurella-Bakterien, um deren Fähigkeit nachzuweisen, eine Immunreaktion gegen Tuberkulose auszulösen. Dieses Experiment führte zur Entwicklung des BCG-Impfstoffs, der noch heute zur Vorbeugung von Tuberkulose eingesetzt wird. Hans Jäger: Er infizierte sich in den 1950er Jahren freiwillig mit HIV, um die Wirkung und Verbreitung dieses neuen Erregers zu erforschen. Der Vorfall löste damals große Kontroversen aus und regte Diskussionen über Ethik und wissenschaftliche Methoden an. Die ethischen Herausforderungen des „Selbstexperimentierens“ Die Erforschung der Verwendung von Viren und anderen Krankheitserregern zur Behandlung von Krebs zeigt die Innovation und den Fortschritt der modernen Medizin und gibt Patienten neue Hoffnung. Die Forschung von Wissenschaftlern wie Harasi hat diesem Bereich neue Impulse verliehen und Viren von bloßen Krankheitserregern in Werkzeuge zur Krebsbekämpfung verwandelt. Allerdings birgt das „Selbstexperimentieren“ erhebliche ethische Risiken. Dass Wissenschaftler Selbstversuche durchführen, um die Medizin voranzubringen, wird manchmal als Zeichen ihres Engagements gesehen, hat aber auch tiefe ethische Debatten ausgelöst. Obwohl Selbstversuche in der modernen Medizin zurückgegangen sind, kann die wissenschaftliche Forschung, insbesondere klinische Tests innovativer Medikamente, nicht absolut sicher sein. Die Frage, wie die Grenzen menschlicher Sicherheit definiert werden können, bleibt eine zentrale ethische Frage. Erstens ist allein die Durchführung von Experimenten an den eigenen Körpern durch Forscher mit schwerwiegenden ethischen Herausforderungen verbunden. Allgemeine klinische Forschung erfordert die Überprüfung und Genehmigung durch ein unabhängiges Ethikkomitee, um sicherzustellen, dass die Experimente den medizinethischen Standards entsprechen. Bei Selbstversuchen können diese notwendigen Überprüfungen übersprungen werden, was zu potenziellen Interessenkonflikten oder sogar zur Durchführung von Experimenten ohne Risikobewertung führen kann. Zweitens ist es ohne geeignete Stichproben oder Kontrollvariablen unwahrscheinlich, dass Daten aus Selbstversuchen wissenschaftlich breit anwendbar oder repräsentativ sind. Selbst wenn die experimentellen Ergebnisse bei einer Einzelperson wirksam sind, besteht keine Garantie dafür, dass sie bei anderen Patienten ebenso wirksam sind, was die wissenschaftliche Stichhaltigkeit der Ergebnisse fraglich macht. Drittens birgt der Einsatz experimenteller Therapien (wie etwa unvollständig validierter Virusbehandlungen) außerhalb formeller klinischer Studien erhebliche Sicherheitsrisiken. Ohne strenge klinische Tests und behördliche Zulassung kann die Anwendung solcher Therapien zu unerwarteten Nebenwirkungen oder unerwünschten Ergebnissen führen, während das Fehlen einer angemessenen medizinischen Überwachung diese Risiken noch weiter erhöht. Viertens könnten Halasis Offenlegung seiner eigenen Versuchsergebnisse in der Arbeit und seine Schlussfolgerung, dass die Virustherapie wirksam sei, Diskussionen über akademische Interessenkonflikte auslösen. Da sie Initiatorin und Versuchsperson der Studie ist, bleiben ihre Ergebnisse möglicherweise nicht neutral, was das Vertrauen der wissenschaftlichen Gemeinschaft in die Forschungsergebnisse beeinträchtigen wird. Aufgrund der oben genannten Punkte sowie aufgrund des Medienrummels und der öffentlichen Diskussion können die Forschungsergebnisse der Öffentlichkeit falsche Hoffnungen oder Informationen vermitteln und sie zu der Annahme verleiten, dass eine bestimmte Behandlung wirksam sei, obwohl dies noch nicht vollständig verifiziert wurde. Insbesondere in Ländern und Regionen, in denen „alternative Therapien“ noch immer einen riesigen Markt darstellen, könnte ein solches Verhalten zu einem Chaos in der Branche führen oder dieses verschlimmern, da dann verschiedene Therapien, die nicht streng klinisch geprüft sind, um den Markt konkurrieren. Darüber hinaus ist es äußerst unzuverlässig, Gesundheitsentscheidungen auf der Grundlage der Medien und der sekundären Interpretation der neuesten Forschungsergebnisse durch die Öffentlichkeit zu „leiten“. Selbst wenn normale Menschen die Originalarbeiten direkt lesen, fällt es ihnen aufgrund ihres fehlenden beruflichen Hintergrunds schwer, den Forschungsinhalt genau zu verstehen und vernünftige Urteile zu fällen. Daher ist es für den Normalbürger nicht empfehlenswert, medizinisches Wissen aus neu veröffentlichten wissenschaftlichen Arbeiten zu beziehen. Auch wenn eine Studie persönliche Interessen beinhaltet, sollte sie mit Vorsicht betrachtet werden und am besten ein Experte zu Rate gezogen werden. (Details siehe „Leben diejenigen, die nach den „neuesten Forschungsergebnissen“ leben, gesünder?“) Die Virustherapie stellt eine wichtige Richtung in der Krebsbehandlung dar, doch die wissenschaftliche Entwicklung kann nicht von ethischen Zwängen getrennt werden. Mit der gemeinsamen Weiterentwicklung von Technologie, Ethik und Recht dürfte sich die Virustherapie in Zukunft zu einer sicheren und wirksamen Routinebehandlung von Krebs entwickeln und mehr Patienten dabei helfen, den Krebs unter Kontrolle zu bringen. Danksagung: Wir möchten Professor Xie Songqiang von der School of Medicine der Henan University für die Überprüfung dieses Artikels danken. Besondere Tipps 1. Gehen Sie zur „Featured Column“ unten im Menü des öffentlichen WeChat-Kontos „Fanpu“, um eine Reihe populärwissenschaftlicher Artikel zu verschiedenen Themen zu lesen. 2. „Fanpu“ bietet die Funktion, Artikel nach Monat zu suchen. Folgen Sie dem offiziellen Account und antworten Sie mit der vierstelligen Jahreszahl + Monat, also etwa „1903“, um den Artikelindex für März 2019 zu erhalten, usw. Copyright-Erklärung: Einzelpersonen können diesen Artikel gerne weiterleiten, es ist jedoch keinem Medium und keiner Organisation gestattet, ihn ohne Genehmigung nachzudrucken oder Auszüge daraus zu verwenden. Für eine Nachdruckgenehmigung wenden Sie sich bitte an den Backstage-Bereich des öffentlichen WeChat-Kontos „Fanpu“. |
>>: Wie überquerten die Acht Unsterblichen das Meer? Welche magischen Kräfte zeigte jeder von ihnen?
Artikel empfehlen
Yoga für einen schlanken Bauch
Ich glaube, Sie alle kennen Yoga. Yoga ist ein Sp...
Welchen Einfluss hat Bauchmuskeltraining auf die sexuelle Leistungsfähigkeit?
Ich glaube, jeder sollte wissen, dass die Bauchmu...
Was sind Extremsportarten im Rennsport?
Wir wissen viel über den Rennsport, weil unsere L...
Die Geburt der schwarzen Technologie? Baidu World Conference 2017: KI-Hardware ist schon vor ihrer Veröffentlichung heiß begehrt
„Erwecken Sie KI zum Leben“, dies ist ein Einladu...
Wie bekommt man eine Westenlinie?
Viele unserer Freundinnen legen vielleicht besond...
Eine Tonne Mondboden kann 50 Menschen einen Tag lang mit Trinkwasser versorgen? Chinesische Wissenschaftler haben die „Methode zur Wassergewinnung aus dem Mondboden“ vorgeschlagen!
Eine Tonne Mondboden kann 50 Menschen einen Tag l...
Ist es besser, Rind- oder Schweinefleisch zu essen? Ich hätte nicht gedacht, dass ich die ganze Zeit das Falsche gegessen habe →
Für Fleischliebhaber sind Schweine- und Rindfleis...
Der erste AI Creator Competition von Volcano Engine versammelt Tausende von Teilnehmern und schafft Hunderte von intelligenten Einheiten. Er fördert die intelligente Entwicklung der Automobilindustrie.
Vor Kurzem ist der erste Creator-Wettbewerb – Car...
Welche Fahrräder eignen sich am besten zum Trainieren?
Einen gesunden Körper zu haben, ist der Traum ein...
Gemeinsamer Bodentank: Hilft Raketen, Gewicht zu reduzieren und die Effizienz zu steigern, um die Leistung zu verbessern
Am 26. Juli hat der Boden des ersten Wasserstoff-...
„Vier-Stunden-Schlaf-Regel“? Ist es wirklich zuverlässig, zu lernen, wie Tiere zu schlafen?
„Dreh dich um den roten Pavillon, öffne das schön...
Welchen Schaden verursachen übermäßiges Pflanzenwachstum und hohe Sauerstoffkonzentrationen für andere Organismen?
Sauerstoff war früher als „Yangqi“ bekannt. Wie d...
Welche Tastatur ist besser? MacBook Pro vs. Razer Blade
Razer hat in diesem Jahr seine Gaming-Notebook-Se...
Was bedeutet es für WeChat, 11 Schnittstellen zu öffnen?
WeChat hat 11 JS-SDK-Schnittstellen geöffnet, dar...
Leapmotor erhielt eine Investition von 1,5 Milliarden Euro von Stellantis und konzentriert sich nicht nur auf den heimischen Markt, sondern beabsichtigt auch, im Ausland zu expandieren
Chinesische Autokonzerne haben erneut eine Allian...