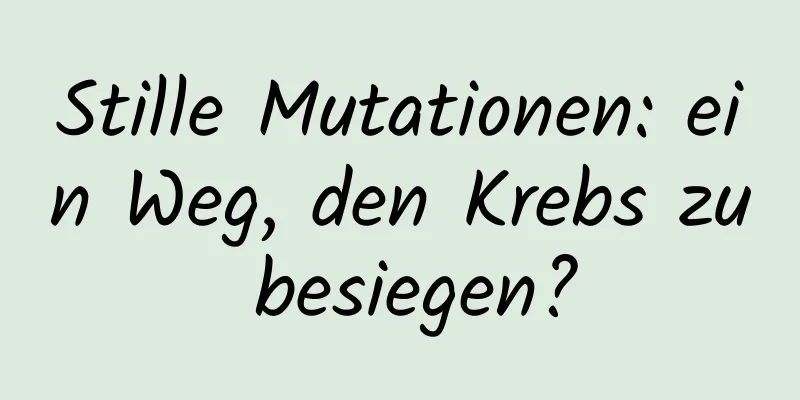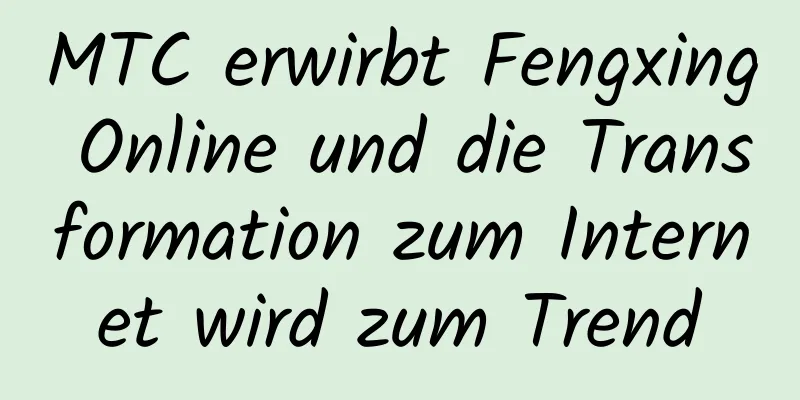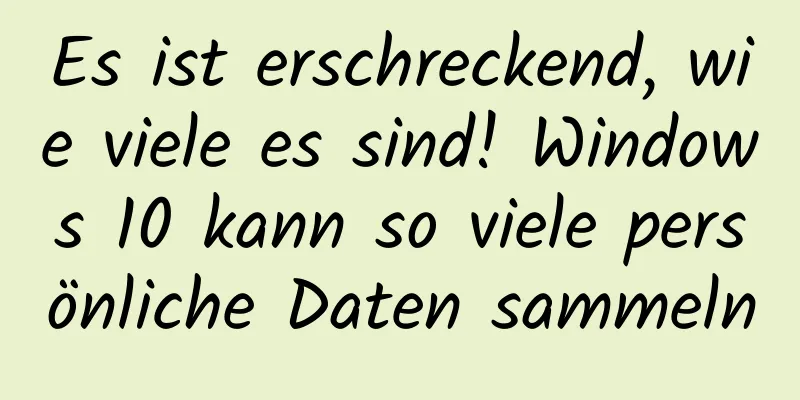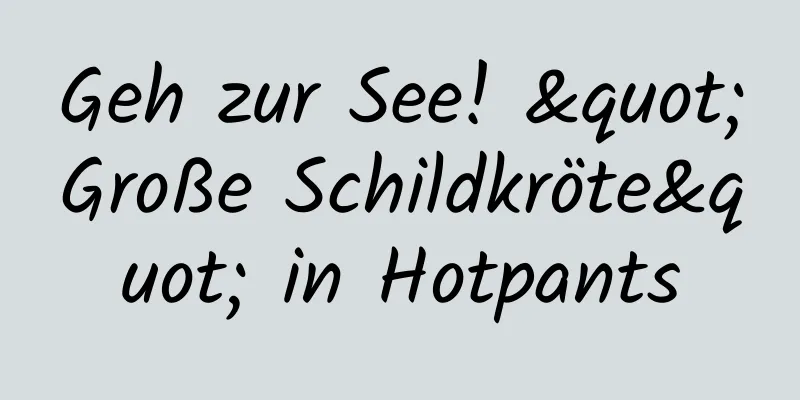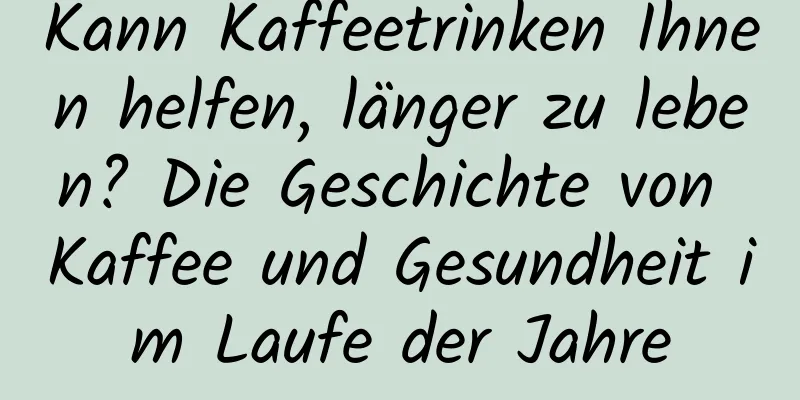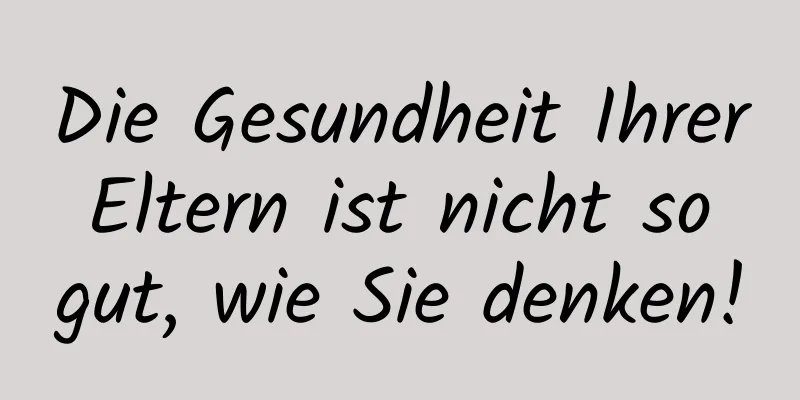Was wird mit der Natur geschehen, wenn die Menschen verschwinden?
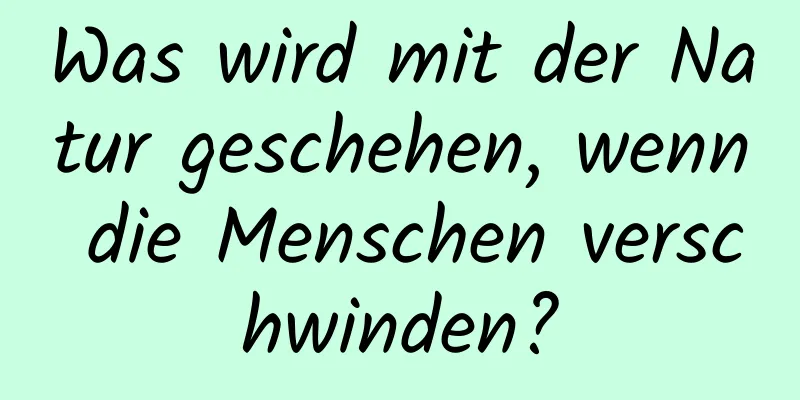
|
Leviathan Press: Es widerspricht nicht unserer Intuition, sondern ist ein Konzept, das sich in unseren Köpfen festgesetzt hat: Der Mensch ist wie der Krebs der Erde, er zerstört die Natur, wo immer er hinkommt. Doch wenn der Mensch verschwindet, wird die Natur mit der Zeit ihr ursprüngliches Aussehen und ihre ursprüngliche Ökologie zurückerlangen. Leider ist diese hartnäckige Vorstellung in unseren Köpfen wahrscheinlich falsch, manchmal sogar furchtbar falsch. Es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass sich die Natur nicht wie von uns erwartet erholen wird, selbst wenn die Menschen von einem Ort verschwinden. Tatsächlich gehen Wissenschaftler auf die Frage nach dem „ursprünglichen“ Bild der Natur davon aus, dass es in den meisten Teilen der Erde keine sogenannte „ursprüngliche“ Landschaft gibt. Wenn es zu Verlassenheit kommt, schleicht sie sich von den Rändern her ein. Zuerst wurden die Häuser am Stadtrand verlassen, dann die Lebensmittelgeschäfte in den Außenbezirken. Es drängt langsam aber unaufhaltsam nach innen. Die Tankstelle wurde geschlossen und Kletterpflanzen kletterten über die Zapfsäulen und breiteten sich über das Dach aus, bis es unter der Last zusammenbrach. Auch Bushaltestellen, Apotheken, Kinos und Cafés wurden nacheinander verschluckt und schließlich wurden sogar Schulen geschlossen. Eine der wenigen Institutionen, in denen im zentralbulgarischen Dorf Tyurkmen heute noch menschliche Aktivität herrscht, ist das Postamt. Dimitrinka Dimcheva, eine 56-jährige Postangestellte, hält ihr Postamt an zwei Tagen in der Woche geöffnet und bringt Waren von außerhalb der Stadt herein, die in den örtlichen Geschäften nicht mehr erhältlich sind. Turkmen war einst eine geschäftige Stadt mit über 1.200 Einwohnern, heute sind es weniger als 200. An einem warmen Frühlingsnachmittag stand Dimcheva auf dem zentralen Platz der Stadt. „Hier haben Hochzeiten stattgefunden, ebenso wie verschiedene Volkstänze und Volleyballspiele. Es gibt viele junge Leute und ein Schwimmbad“, sagte sie. Sie sah sich um, zeigte auf Ruinen oder jetzt leere Flächen und erinnerte sich an die Gebäude, die einst dort gestanden hatten. Dort stand einst ein kleines Kino; Dahinter befand sich eine Schule, die niederbrannte, wieder aufgebaut und schließlich geschlossen wurde. „Damals war das Leben pulsierend“, aber jetzt, sagte sie, „stirbt das Dorfleben aus.“ Ähnliche Dörfer gibt es in ganz Bulgarien. Später strömten die Menschen auf der Suche nach Arbeit in die Städte und im Laufe der nächsten 30 Jahre wurden viele Dörfer verlassen und schließlich aufgegeben. Den Daten der Volkszählung von 2021 zufolge sind in Bulgarien fast 300 Dörfer völlig unbewohnt, und in über 1.000 Dörfern leben weniger als 30 Menschen, von denen die meisten älter sind. Aufgrund niedriger Geburtenraten und hoher Auswanderung ist die Bevölkerung Bulgariens seit Jahrzehnten rückläufig . Die Bevölkerung ist von fast 9 Millionen im Jahr 1989 auf weniger als 6,5 Millionen gesunken – einer der größten Bevölkerungsrückgänge in Friedenszeiten der modernen Geschichte.[1] Bulgarien befindet sich am äußersten Ende dieses demografischen Wandels, doch die Kräfte, die das Land umgestalten, sind überall zu finden. Im letzten halben Jahrhundert ist der Anteil der Weltbevölkerung, der in ländlichen Gebieten lebt, um fast ein Drittel gesunken. Die Landwirtschaft wird zunehmend industrialisiert und konzentriert. Heute lebt mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten und deren Umland. Prognosen zufolge wird dieser Anteil bis 2050 auf 70 % steigen. In vielen Ländern sinken die Geburtenraten stetig. Obwohl die Weltbevölkerung Prognosen zufolge bis 2080 weiter wachsen wird, wird etwa die Hälfte dieses Wachstums von weniger als 10 Ländern getragen werden[2]. In Turkmenistan (Bulgarien) ist ein Kranich zu sehen, der durch einen verfallenen Schuppen zu seinem Nest zurückkehrt. © Ivo Danchev Aufgrund der Abwanderung und des Bevölkerungsrückgangs werden dauerhafte Wohngebiete nach und nach aufgegeben. Die Leute lassen oft alles dort, wo es ist, als ob sie sich darauf vorbereiten würden, eines Tages zurückzukommen, aber dieser Tag kommt normalerweise nie. In Turkmenistan hängen in leeren Häusern noch immer Weihnachtskugeln an Gardinenstangen und werden langsam von Spinnweben bedeckt. In einem verlassenen Raum lag eine eingestürzte Vitrine in einem verrottenden Loch im Boden. Die Teller waren noch immer ordentlich gestapelt, neben einer Packung Windeln für die Enkelkinder, die zu Besuch kamen. Manchmal erfolgt die Aufgabe plötzlich, etwa aufgrund einer Gerichtsentscheidung oder einer Notevakuierung. aber häufiger ist es chaotisch, langsam und ungeplant. Die Leute sind einfach gegangen. Einige Wissenschaftler gehen davon aus, dass seit den 1950er Jahren weltweit etwa 400 Millionen Hektar Land – fast die Größe der Europäischen Union – aufgegeben wurden[3]. Eine Gruppe von Wissenschaftlern hat kürzlich berechnet[4], dass in den gesamten USA seit den 1980er Jahren etwa 30 Millionen Hektar Ackerland aufgegeben wurden. Da durch die Klimakrise immer mehr Gebiete unbewohnbar werden (Überschwemmungen, Wasserknappheit und Waldbrände machen den Bau von Häusern unmöglich, und Bodenerosion und Dürre machen die Landwirtschaft unmöglich), ist in Zukunft mit einer stärkeren Vertreibung der Bevölkerung zu rechnen. Dieser weltverändernde Wandel blieb fast unbemerkt. „Es war schon immer da – aber wir haben es nicht wirklich beschrieben“, sagte Professor He Yin, Wissenschaftler an der Kent State University. Er und andere Wissenschaftler nutzen Fernerkundungstechnologie, um verlassenes Land auf der ganzen Welt zu kartieren. „Wir reden immer über Expansion“, sagte er und meinte damit die Landentwicklung, „und ja, das ist sicherlich wichtig. Aber es gibt noch eine andere Seite – die Aufgabe – über die selten gesprochen wird.“ Ein verlassenes Haus in Turkmen. © Georgia Public Broadcasting Hinter der Geschichte der Entvölkerung verbirgt sich eine weitere Geschichte: die Geschichte, was mit verlassenem Land geschieht. Um einen bewohnbaren Planeten zu erhalten, ist es von entscheidender Bedeutung, Wälder, Grasland, gesunde Ökosysteme und Wildnisgebiete zu schützen und zu erweitern. Große Flächen verlassenen Landes bieten sowohl Chancen als auch Fragen. Dies ist ein unvollendetes Experiment mit unvorhersehbarem Ausgang. Im Laufe von Jahrtausenden hat der Mensch seine Lebensräume drastisch verändert und das Antlitz der Erde neu geformt. Was also passiert mit der Natur, wenn die Menschheit verschwindet? Es war dieses Geheimnis, das die Ökologin Gergana Daskalova zum Turkmenischen Tor lockte. Sie ging an einem heißen, ruhigen Morgen im Mai die Main Street entlang. Die Straße war menschenleer, doch Zäune, Tore und Telefonmasten waren mit Papier bedeckt, das in der Hitze des Frühsommers zitterte, weil sich die Klammern im Wind lösten. Wenn in Bulgarien ein Familienmitglied stirbt, ist es Tradition, einen Nachruf zu veröffentlichen. Diese gedruckten Blätter im A4-Format enthalten den Namen des Verstorbenen, ein Foto, das Todesdatum und eine kurze Trauerrede. Auf jedem Blatt Papier war die Zeitspanne seit dem Tod der Person angegeben: sechs Monate, ein Jahr, zehn Jahre, zweiundzwanzig Jahre. In Dörfern im ganzen Land markierten diese Todesanzeigen oft auch das Ende menschlicher Besiedlung. Todesanzeigen für das Dorf Prestoy. © Ivo Danchev „Wenn man herumläuft, ist es wie eine Uhr, die anzeigt, wann diese Menschen weg sind“, sagt Daskalova, die sich auf die Ökologie des globalen Wandels spezialisiert hat, also auf die Erforschung der groß angelegten Umgestaltung der natürlichen Welt durch menschliche Aktivitäten. Aus menschlicher Sicht ist es traurig. Aber es markiert auch das Ende des menschlichen Einflusses und den Beginn der damit verbundenen Umweltveränderungen. Derzeit führt sie ein ehrgeiziges Forschungsprojekt durch, bei dem sie 30 Dörfer auf dem bulgarischen Land untersucht, die sich in unterschiedlichen Stadien der Verlassenheit befinden. Gemeinsam mit Mitarbeitern und Studenten sammelt sie eine große Bandbreite an Daten: Sie setzt Drohnen ein, um die Erholung der Wälder zu kartieren, führt botanische Untersuchungen von Parzelle zu Parzelle durch, um Veränderungen der Pflanzenarten zu beobachten, und befestigt Aufzeichnungsgeräte an Bäumen, um Veränderungen der Dichte und Lautstärke des Vogelgesangs aufzuzeichnen. Mit der Zeit hofft sie, die Ökologie verlassener Dörfer mit der noch bewohnter Dörfer vergleichen zu können, um ein umfassendes Bild davon zu erhalten, wie die Natur auf den Weggang der Menschen reagiert. Daskalova, Forscherin an der Universität Göttingen in Deutschland, führt ihre Arbeit in Bulgarien durch. © Ivo Danchev Daskalova, eine herzliche und gesprächige Frau Anfang 30, hat ein Händchen dafür, wissenschaftliche Theorien geduldig populär zu machen. Diese Fähigkeit hat sie sich wahrscheinlich angeeignet, als sie neugierigen Hirten auf abgelegenen Feldern erklärte, warum sie Mikrofone an Bäume befestigte. Sie hatte vor kurzem einen Sohn bekommen und manchmal saß das Kind neben ihr und beobachtete sie mit ernster Miene, während sie auf dem Forschungsgelände hin und her ging. Turkmenistan war kein zufällig gewählter Forschungsstandort – hier ist sie aufgewachsen. Wie viele ihrer Generation wuchs Daskalova als Kind hauptsächlich bei ihren Großeltern auf, während ihre Eltern in der nächstgelegenen Stadt arbeiteten. Schließlich verließ sie das Dorf, um aufs College zu gehen. „Zehn Jahre lang gehörte ich zu den Menschen, die das Dorf verließen und gelegentlich zurückkamen. Jedes Mal, wenn ich zurückkam, lebten weniger Menschen in meiner Straße“, sagte sie. Als sie jung war, suchte Daskalova im Winter nach Zeichen der Vernachlässigung und achtete darauf, ob noch Rauch aus den Schornsteinen kam oder ob in den Fenstern auf der Straße noch Licht war. „Aber irgendwann gingen die Lichter aus.“ In den ersten Jahren ihrer Karriere arbeitete Daskalova an entlegenen Orten, unter anderem in der arktischen Tundra. Doch sie erinnerte sich stets an den massiven Rückgang der Population, den sie erlebt hatte, und war sich bewusst, dass dieser Teil eines umfassenderen Trends war, der die Zukunft Tausender Arten verändern könnte. Heute lebt und arbeitet sie im alten Haus ihrer Großeltern in Turkmenistan. Die Häuser um sie herum waren fast alle leer. Auf der anderen Straßenseite lag ein Haus wie ein weggeworfener Pappkarton im Regen. Jeder Untersuchungsort ist für sich betrachtet nur ein Dorf wie Tausende andere. „Aber in gewisser Weise ist das das Besondere daran, denn die Entvölkerung findet in sehr großem Ausmaß statt.“ Und was nach der Aufgabe passiert, ist oft ganz anders als wir erwarten. Das Wissen, dass große Teile unseres Planeten aufgegeben werden, ruft unweigerlich Bilder eines Garten Eden hervor, der inmitten der Ruinen der Menschheit wiederaufersteht. Ohne den Menschen wird die Natur mit aller Macht zurückkehren. Rehe werden durch die bröckelnden Straßen der Stadt streifen, Schlingpflanzen werden den Beton durchbrechen und Fußballfelder werden zu Wäldern. Der Himmel wird aufklaren und die Arten werden gedeihen. Während des Lockdowns 2020 sahen viele Menschen den halbverlassenen Zustand. Da die Menschen gezwungen sind, in ihren Häusern zu bleiben, kehren die Wildtiere in die Straßen und Vorstadtgärten der Städte zurück. „Der Mensch ist das Virus“, witzelte der Kommentator, und in seiner Abwesenheit „heilt die Natur.“ Ein verlassenes Haus im bulgarischen Dorf Kreslyuvtsi. © Ivo Danchev Diese Vorstellung vom Menschen als Fluch der Natur und von einem Paradies, das nach unserem Verschwinden blühen wird, knüpft an einige der ältesten Ideen der Ökologie an. Im späten 19. Jahrhundert machte der Botaniker Frederick Clements die „Sukzessionstheorie“ populär, die Idee, dass jede Landschaft, sofern sie nicht gestört wird, einem allmählichen Entwicklungsprozess folgt. Beispielsweise ist ein Ackerland zunächst von schnell wachsenden Gräsern und Unkräutern bedeckt, dann von Sträuchern und schließlich von Bäumen und Wäldern. Clements glaubte, dass jeder Ort durch Sukzession einen „höchsten“ Zustand stabilen Gleichgewichts erreichen würde. Das Endergebnis kann je nach Klima und Geografie unterschiedlich ausfallen – ein Alpenwald unterscheidet sich von einem Sumpf oder einer Wüste –, doch die grundlegende Entwicklung ist dieselbe: Clements nennt es das „universelle Gesetz“, dass ein Ökosystem in einen Höchstzustand „aufsteigt“, so wie ein Tier vom Jungtier zum Erwachsenen heranwächst. Diese Ansicht fand zu Beginn des 20. Jahrhunderts, in einer Zeit explosionsartigen Wachstums von Städten, Bevölkerung und Industrie, breite Akzeptanz. Es hat eine gewisse schlichte und elegante Schönheit. Die Theorie bietet auch einen gewissen Trost, da die Menschen beobachten, wie menschliche Aktivitäten die Erde um sie herum verändern. Egal wie dramatisch die Störung ist – ob Gletscher zurückweichen oder Wälder für Ackerland gerodet werden – die Fähigkeit der Natur, zurückzukehren, ist immer vorhanden. Der ideale Oberflächenzustand ist wie die Matrix unter der Erde, die sich mit der Zeit und unter ungestörten Bedingungen erholt, selbst wenn der Boden gepflügt, umgegraben, abgebrannt oder asphaltiert wird. Im Laufe der Zeit wurden Clements‘ umfassendere Theorien von anderen Botanikern in Frage gestellt. Was er als stabile, dauerhafte Klimaxgemeinschaften bezeichnet, ist schwer zu fassen: Feldstudien haben ergeben, dass Ökosysteme unvorhersehbaren Zyklen von Zusammenbruch, Regeneration, Differenzierung und Stagnation unterliegen. Heute ist diese deterministische Nachfolgetheorie widerlegt. Doch Clements‘ Vision bleibt im öffentlichen Bewusstsein verankert, manchmal zum Entsetzen der Ökologen. „Viele populäre Vorstellungen über die Umwelt basieren auf dem Glauben, dass die Natur ihr Gleichgewicht bewahren wird, wenn der Mensch nur nicht eingreift“, schrieb der Ökohistoriker William Cronon 1995. „Diese Geschichten stammen von uns, nicht von der Natur. Die Natur formt sich nicht spontan zu Fabeln.“ Tatsächlich stellen Wissenschaftler fest, dass die Beziehung der Menschheit zur Natur weitaus komplexer ist, als wir oft annehmen. Auch hier handelt es sich um eine eher kontraintuitive Entdeckung Daskalovas: Die menschliche Existenz steht nicht zwangsläufig immer im Konflikt mit der Natur, sondern kann vielen Arten zum Überleben verhelfen. Noch überraschender ist, dass eine völlige Aufgabe mitunter schlimmere Folgen für die Artenvielfalt haben kann, als wenn man einen Teil der menschlichen Präsenz zurücklässt. Um diesen Punkt zu veranschaulichen, führt mich Daskalova in ein unter Weinreben begrabenes Dorf. Kreslyuvtsi liegt in einer bergigen Gegend in Zentralbulgarien. Im Laufe der Jahre wurde das Dorf fast vollständig verlassen. Die Genealogie der Dörfer, die Daskalova untersucht, stellt eine Fallstudie über die Folgen einer nahezu völligen Abwesenheit menschlicher Existenz dar. Daskalova stand am Rand des Hügels und trat vorsichtig auf den Pfad. Als ihre Füße den Boden berührten, hüpften sie leicht, gestützt von Tausenden ineinander verschlungenen Ranken, wobei die Elastizität des engen Geflechts für einen elastischen Auftrieb sorgte. Irgendwo weiter unten war ein steiler Abhang und ein paar Meter entfernt stand ein seit langem verlassenes Haus im Dorf Kreslevtsi. Seine Form zerfiel langsam, als die Steinmauern nachgaben. Die Ranken haben das ganze Haus bedeckt und nur eine Ecke des Daches freigelassen, wie der Bug eines sinkenden Schiffes in seinen letzten Zügen. „Sie werden den Ort völlig verschlingen“, sagte Daskalova. Verlassenes, von Weinreben bedecktes Haus in Kreslevtsi. © Ivo Danchev Die Weinreben veranschaulichen die erste Kraft, der das Land ausgesetzt ist, nachdem der Mensch es verlassen hat: Wenn der Mensch in Massen verschwindet, können neu entstehende dominante Arten andere Arten hinwegfegen. Der schlimmste Befall geht nicht von Weinreben, sondern von invasiven Arten aus. In Polen, wo rund 12 % der landwirtschaftlichen Nutzflächen brachliegen, haben sich die Felder zu weiten Teilen senfgelb verfärbt – bedeckt mit dem leuchtenden Pollen der Kanadischen Goldrute. Die Pflanze hat über 75 % der verlassenen Felder im ganzen Land befallen, und wo Goldruten wachsen, haben andere Arten kaum eine Chance, sich anzusiedeln. Wissenschaftler, die diese verlassenen Gebiete untersuchten, stellten fest, dass die Populationen wilder Bestäuber um 60 bis 70 % zurückgegangen waren und die Vogelpopulationen um die Hälfte geschrumpft waren[5]. In Bulgarien stellt der Götterbaum (Ailanthus altissima) eine neue Bedrohung dar. Dabei handelt es sich um einen robusten, schnell wachsenden und krankheitsresistenten Baum, der in Nordchina beheimatet ist und einen bitteren Saft absondert, der andere Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen abstößt. Diese Konzentrationen einzelner Arten können „biologische Wüsten“ bilden, in denen nur eine Art überlebt. Das Bedürfnis nach Vielfalt ist nicht nur auf menschliche ästhetische Vorlieben zurückzuführen. Mit dem Aussterben einzelner Arten gehen häufig Bodenerosion und Nährstoffmangel, das Aussterben anderer Arten, schwer zu reinigende Wasservorräte, großflächige Waldbrände, Dürreanfälligkeit und die schnelle Ausbreitung von Krankheiten einher. Überreste von Steinmauern an einem verlassenen Haus in Bulgarien. © Gergana Daskalova In manchen Fällen ist die Dominanz einer einzelnen Art nur vorübergehend. Sogar tödliche invasive Arten können manchmal als Brutstätte für eine Vielzahl von Pflanzen und Organismen dienen, die schließlich größer werden als sie selbst. In anderen Fällen stagnieren die Ökosysteme und erholen sich nicht oder entwickeln sich nicht weiter. „Es wird allgemein angenommen, dass sich einmal zerstörte Wälder innerhalb weniger Jahrzehnte auf natürliche Weise von Grasland oder Buschland erholen können und dass das Anpflanzen von Bäumen dabei helfen kann“, schrieben Wissenschaftler in einer Studie über Plantagen in Hongkong aus dem Jahr 2023. „ Unsere Untersuchungen zeigen, dass sich die Wälder nicht so schnell und vollständig erholen, wie man dachte. “[6] Oftmals ist der Mensch für die Dominanz einer einzigen Art verantwortlich. Doch spielen die Menschen auch eine unerwartete und unterschätzte Rolle bei der Verhinderung dieser Dominanz. Zwischen den Weinreben von Kreslevtsi drehte sich Daskalova um und ging vorsichtig zurück zum Pfad, der den Hang hinaufführte. Zurück auf dem Weg hockte sie sich ins Gras und begann, die Arten zu ihren Füßen zu benennen: Gräser, Efeu, aber auch Butterblumen, lila blühende Kletterpflanzen und eine winzige gelbe Orchidee. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass viele Leute diesen Weg gehen würden, aber gelegentlich tut es jemand“, sagte sie. Dabei blockierten sie die Ausbreitung der Weinreben und gaben diesem kleinen Artenflecken Raum, in voller Farbe zu erblühen. Der Weg, auf dem Daskalova stand, führte zu einem offenen Bereich im Wald, wo Gras und Wildblumen auf einer gerodeten Wiese wuchsen. Auch hier erscheinen zarte Blumenbüschel, die die Geschichte des Landes offenbaren. Butterblumen und landwirtschaftliche Unkräuter deuten darauf hin, dass hier in der jüngeren Vergangenheit Menschen lebten, ebenso wie die gerodeten Flächen. Daskalova deutete auf die dichten Bäume, die die Lichtung umgaben und wie ein Amphitheater für die Zuschauer angeordnet waren. Ihr Geflecht aus Ästen begann sich bereits in Richtung der kostbaren Lichtquelle auf der Lichtung auszudehnen. „Sie befinden sich direkt am Rand und sind bereit, sich dort niederzulassen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Wenn das Land nicht beweidet oder gemäht wird, kann es nur fünf Jahre dauern, bis es vollständig im Schatten eines dichten Blätterdachs liegt.“ Eine Schafstelze in einem unbebauten Weizenfeld in der Nähe von Shishmanzi, Bulgarien. © Malkolm Boothroyd Wenn Menschen an die Erholung eines Ökosystems denken, ist die Rückkehr der Wälder oft das Erste, was ihnen in den Sinn kommt. Allerdings stellen Wälder nur einen kleinen Teil der möglichen Lebensräume dar. Für andere Arten ist Licht die Währung des Lebens und ein Überleben unter dem begrenzten Blätterdach des Waldes ist unmöglich. Die Schwalbe ist perfekt an große, offene Felder angepasst: Die Krümmung ihrer Flügel und die einzigartige Gabelung ihres Schwanzes sind darauf ausgelegt, Insekten über dem Gras schnell zu fangen. Starenschwärme sind wie Pfeffer auf einer Tischdecke eine Anpassung an offene Felder: Sie sollen Raubtiere fernhalten und den Lebensraum schützen. Zahlreiche Arten haben sich an diese offenen Flächen angepasst und gemeinsam mit ihnen eine Evolution durchlaufen – Pflanzen, Säugetiere, Insekten, Pflanzenfresser und Wildblumen. Offenes Grasland weist möglicherweise sogar eine größere Artenvielfalt auf als gemäßigte Wälder. Es war einmal eine Zeit, in der solche Umgebungen von riesigen Tieren geschaffen wurden. Tiere wie Mammuts, Büffel, Bisons und Höhlenbären waren groß genug, um Wälder umzugestalten, indem sie Bäume umstürzten und so Grasland und sogar Prärien bildeten. Wissenschaftler schätzen, dass die Megafauna etwa 30 % der Wälder Südamerikas zerstört hat.[7] Sie sind jedoch fast alle ausgestorben, wobei ihr Untergang oft mit der Ankunft des Menschen zusammenfiel.[8] Vielerorts sind Menschen die einzigen Organismen, die die Landschaft noch so extrem verändern können, indem sie den Schatten der Bäume zurückdrängen und anderen Organismen die Möglichkeit geben, Wurzeln zu schlagen. Ein verlassenes Bauernhaus in der Nähe von Rijssen, Niederlande. © Stringer via Getty Images Seit Tausenden von Jahren nutzen Menschen auf der ganzen Welt Feuer und Werkzeuge, um Land für Landwirtschaft, Gartenbau, Weidewirtschaft und Jagd zu roden. Dabei entstehen ökologische „Mosaike“ oder „Patchwork-Landschaften“: Das sind Landschaften, die unterschiedliche Lebensräume wie Wiesen, Gärten und Wälder beinhalten. Diese Orte sind nicht als Naturschutzgebiete konzipiert, beherbergen aber oft eine große Vielfalt an Tieren. In ihrem Buch „Nature‘s Ghosts“ beschreibt Sophie Yeo ausführlich Forschungsergebnisse[9], die zeigen, dass Heuwiesen, die in Europa für die Tierhaltung kultiviert werden, tatsächlich erfolgreicher darin sind, eine größere Anzahl von Arten zu erhalten, als Wiesen, die speziell für die Artenvielfalt kultiviert werden. Rückblickend auf das frühe Holozän (das vor etwa 11.700 Jahren begann) stellten Forscher fest, dass die menschliche Präsenz die Artenvielfalt mit etwa gleicher Wahrscheinlichkeit erhöhte wie verringerte.[10] Nicht alle vom Menschen geschaffenen Landschaften sind gleich. Ein mit Asphalt gepflastertes Viertel mit Kunstrasen ist etwas völlig anderes als ein Dorf voller vielfältiger Gemüse- und Blumensorten. Ein traditionelles Heufeld unterscheidet sich stark von einer mit Pestiziden getränkten Sojabohnenplantage. Und doch stellen Wissenschaftler immer wieder fest, dass die alten Vorstellungen vom Gegensatz zwischen Mensch und Natur genauso falsch sind und dass die rosigen Visionen einer Umwelt, die auch ohne uns floriert, eher Fantasie als Realität sind. „Die Leute stellen sich die Natur immer noch als einen unberührten Ort vor, den die Menschen retten können“, sagt der amerikanische Umweltwissenschaftler Erle Ellis. „Das ist absolut ein Missverständnis.“ © CN Traveller Im Jahr 2021 veröffentlichte Ellis eine neue Studie, die 12.000 Jahre in die Geschichte zurückreicht. Er und seine Kollegen stellten fest, dass fast drei Viertel der Landfläche der Erde von menschlichen Gesellschaften bewohnt und verändert wurden. Andere Forscher sind sogar noch weiter in die Vergangenheit zurückgegangen. Als Wissenschaftler die Interaktionen des Menschen mit der Artenvielfalt während des späten Pleistozäns (vor bis zu 120.000 Jahren) untersuchten, kamen sie zu dem Schluss, dass es in den meisten Teilen der Erde keine „unberührten“ Landschaften mehr gibt und dass dies in den meisten Fällen schon seit Tausenden von Jahren nicht mehr der Fall war.[11] Viele Landschaften, die heute als unberührt gelten – von den Savannen Äquatorialafrikas bis in die Tiefen des Amazonas-Regenwalds – wurden tatsächlich vom Menschen tiefgreifend verändert. „Die entscheidende Rolle, die der Mensch in der Ökologie spielt, ist so wichtig und wurde lange übersehen“, sagte Ellis. „Die Orte mit der größten Artenvielfalt auf der Erde – und das trifft fast überall zu – werden von indigenen Völkern bewohnt. Warum? Denn sie schützen einen Großteil der Artenvielfalt und schaffen diese sogar. Sie pflegen diese heterogene Landschaft. Es besteht kein Zweifel daran, dass die jüngsten menschlichen Aktivitäten – insbesondere die massive Zerstörung von Ökosystemen und der industrielle Verbrauch fossiler Brennstoffe – zu ökologischen Katastrophen geführt haben. Doch wenn die Natur in einen früheren Zustand zurückversetzt werden soll, ist die Schlüsselfrage möglicherweise nicht die Abwesenheit des Menschen, sondern die Form, in der die Anwesenheit des Menschen auftreten kann. Ein Hirte treibt seine Schafe durch das Yatürk-Tor in Bulgarien. © Malkolm Boothroyd In kleinen bulgarischen Gemeinden, die einen Bevölkerungsrückgang verzeichnen, sind manchmal Spuren bescheidener menschlicher Aktivität zu erkennen, die sowohl einen Weg in die Zukunft als auch einen Blick in die Vergangenheit bieten. Abseits der Hauptstraße des Dorfes Turkmen führt ein Feldweg zu einer mit Buschwerk bewachsenen Wiese. Am Tag meines Besuchs stand der 56-jährige Slavcho Petkov Stoyanov dort und beobachtete seine Schafe, die im Gebüsch grasten. „Vor Jahren ließ mich hier niemand grasen“, sagt er. „Es ging nur um den Gemüseanbau.“ Er ist der letzte Mann im Dorf, der Schafe hält, und normalerweise stellte er Hirten ein, um auf seine Herden aufzupassen – doch in letzter Zeit haben die jungen Männer das Dorf verlassen, und er ist auf die Felder zurückgekehrt und sitzt im Schatten, um der sengenden Mittagssonne zu entgehen. Stoyanov ist einer der wenigen Menschen hier, die dabei helfen, eine vielfältige „Mosaiklandschaft“ zu erhalten: Auf einigen offenen Flächen breiten sich Baumkronen aus, andere werden für die Beweidung gerodet und sind mit Wildblumen übersät. Er zeigte, wie menschliche Aktivitäten die Umwelt nicht schädigen, sondern sogar schützen können. Mit der Entvölkerung ländlicher Gebiete wie Turkmenistan werden diese anfällig für neue Formen der Ausbeutung: Die Grundstückspreise sinken, und da weniger Menschen vor Ort sind, wird es schwieriger, sich Projekten wie Bergbau und Steinbruchbau zu widersetzen. „Man könnte meinen, die Entvölkerung würde zum Sprungbrett für die Industrialisierung werden“, sagte mir Daskalova. Diese Straße im Dorf Turkmen hat im Leben mehrerer Generationen eine wichtige Rolle gespielt. © Gergana Daskalova Stoyanov zeigte auf den Stausee unterhalb des Feldes. Seine Großeltern halfen selbst beim Graben des Stausees. Doch erst vor ein paar Jahren erhielt ein Unternehmen über die Stadtverwaltung einen günstigen Vertrag, um dort Fisch abzuholen. Der Prozess folgte einer brutalen, kurzfristigen Logik: Sie installierten Pumpen, leerten die Reservoirs und schöpften die Fische heraus. Fast alle anderen Organismen starben. „Sie haben etwa 20 Tonnen Fisch gefangen“, sagte Stoyanov. Die verbliebenen Dorfbewohner waren empört und starteten eine erfolgreiche Kampagne zur Beendigung des Vertrags. Der Stausee erholte sich langsam und Wasser, Fische und Vögel kehrten zurück. Er hofft, dass mit der Zeit auch Teile des Dorfes wiederhergestellt werden. Mittlerweile gibt es neue Konkurrenten, darunter einen geplanten Kalksteinbruch am Rande des Dorfes. Um die ökologischen Möglichkeiten, die dieser massive Bevölkerungsverlust bietet, voll auszuschöpfen, müssen wir unsere Auffassung von der Beziehung der Menschheit zur Natur ändern und uns bewusst machen, dass unsere Spezies für die Ökosysteme sowohl von Nutzen als auch von Nachteil sein kann. Es erfordert auch menschliche Absicht: Ignorieren allein reicht nicht. Rund um Slavchos Herde verändert sich der Hintergrund des Turkmenischen Tors. Die Waldflächen weiteten sich aus, Weinreben überwucherten die Villen und invasive, nach Chemikalien riechende Sträucher überwucherten die Wiesen. Der Vormarsch der Natur scheint unaufhaltsam, doch ihre Zukunft bleibt ungewiss und hängt von den Menschen ab, die sie zurücklassen: Was werden sie wachsen lassen? Was wird sonst noch unterdrückt? Hinter der Tür des Lagerraums im verlassenen Haus befanden sich Dutzende ungeöffnete Gläser mit eingelegtem Gemüse und Konserven. © Gergana Daskalova Diese Unsicherheit kam in Gesprächen mit Wissenschaftlern, die verlassene Gebiete erforschen, immer wieder zur Sprache. Damit die Artenvielfalt gedeihen kann, braucht es Zeit. Dieselben Kräfte, die Menschen von einem Ort vertreiben – Epidemien, Kriege, veränderte Wirtschaftstrends – können sie auch zurücktreiben. He Yin fand in Zusammenarbeit mit einem Team von Wissenschaftlern heraus, dass innerhalb weniger Jahrzehnte Millionen Hektar verlassenen Landes wieder kultiviert wurden. Ihre Vernachlässigung ist „zu kurz“, um sich in echten Vorteilen für die Natur niederzuschlagen.[11] An einem der am längsten verlassenen Orte, die Daskalova überwachte, sah sie Bäume wachsen und gedeihen, ungestört, seit die letzten Bewohner weggegangen waren. „Seit fast einem halben Jahrhundert hat niemand mehr einen Fuß auf dieses Grundstück gesetzt“, sagte sie. Doch gerade in diesem Jahr tauchten neue Eigentümer auf. Sie planen den Bau eines Hotels, um das abgelegene Grundstück in ein Paradies für Touristen zu verwandeln. „Als Erstes haben sie jeden Zentimeter Vegetation entfernt – sie haben buchstäblich alles dem Erdboden gleichgemacht“, sagte sie. Die Wälder wurden abgeholzt und bis auf die Erde umgepflügt, sodass auf den Parzellen nur wenige invasive Unkräuter übrig blieben. Nach der Rodung des Grundstücks wurde den Käufern klar, dass ihr neues Projekt nicht rentabel sein würde. „Sie haben den Hotelplan fallen gelassen“, sagte Daskalova. „Jetzt ist es wieder verlassen.“ Quellen: [1]www.researchgate.net/publication/290752133_Bulgaria's_population_implosion [2]www.theguardian.com/global-development/article/2024/jul/11/global-population-predictions-offer-hopeful-sign-for-planet-un-says?CMP=share_btn_url [3]www.science.org/doi/10.1126/science.adf1099 [4]iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ad2d12 [5]www.science.org/doi/full/10.1126/science.adi7833 [6]www.kfbg.org/en/press-release/article/KFBG-Study-Finds-That-Trees-Planted-in-Monocultures-Impede-Forest-Recovery [7]nsojournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ecog.01593 [8]royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2013.3254 [9]www.cambridge.org/core/journals/environmental-conservation/article/managing-biodiversity-rich-hay-meadows-in-the-eu-a-comparison-of-swedish-and-romanian-grasslands/3FB1EEF21C821CB667CC6D87B9F1A817 [10]www.nature.com/articles/s41559-024-02457-x [11]pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9132457/ Von Tess McClure Übersetzt von Tim Korrekturlesen/tamiya2 Original/ www.theguardian.com/news/2024/nov/28/great-abandonment-what-happens-natural-world-people-disappear-bulgaria Dieser Artikel basiert auf der Creative Commons License (BY-NC) und wird von Tim auf Leviathan veröffentlicht Der Artikel spiegelt nur die Ansichten des Autors wider und stellt nicht unbedingt die Position von Leviathan dar |
<<: Lufthansa: Investitions- und Innovationsbericht der asiatischen Reisebranche 2020
Artikel empfehlen
Chinas Absatz von Fahrzeugen mit neuer Antriebsenergie sank im ersten Quartal 2020 um 56,4 %, doch Teslas Absatz lag im März bei über 10.000 Fahrzeugen
Aufgrund von Faktoren wie der Epidemie und Subven...
Nehmen Sie die Sterculia lychnophora schnell aus Ihrer Tasse!
Haben Sie in Ihrer Schulzeit schon einmal diese S...
Welche Muskeln werden am Reck trainiert?
Körperliche Betätigung ist im modernen Leben eine...
Wie lange müssen die Menschen noch von diesen schlechten Angewohnheiten gequält werden, die nicht einmal durch eine Geschlechtsumwandlung oder Injektionen geändert werden können?
Der Frühling ist da und es ist wieder die Jahresz...
Kann Hula-Hoop wirklich beim Abnehmen helfen?
Freundinnen wünschen sich pralle Brüste und einen...
Olympische Goldmedaillen bestehen nicht mehr aus reinem Gold! Auch aus Müll und alten Baustoffen hergestellt! Die Länder haben einen Müllwettbewerb gestartet …
Der Athlet, der bei den Olympischen Spielen in Pa...
Yoga-Übungen zur Erhaltung der Eierstöcke
Viele Frauen legen Wert auf ihre Gesundheit und a...
Wie fühlt sich Bauchatmung an?
Die Atmung ist ein normales physiologisches Phäno...
So trainieren Sie den seitlichen Kopf des Bizeps
Jeder möchte stärker aussehen, was ihn nicht nur ...
Was ist Aerobic-Training zur Gewichtsabnahme?
Viele Freunde möchten durch Sport abnehmen, aber ...
Drei Schwestern, die nicht rauchen, erkranken nacheinander an Lungenkrebs! Das ist wichtig, aber viele Leute machen es falsch.
Experte dieses Artikels: Hu Zhongdong, stellvertr...
Handelt es sich dabei wirklich um eine Gewichtsabnahme oder lediglich um eine Belastung Ihres IQ? Nachdem ich 11 Sorten Vollkornbrot getestet habe, muss ich sagen, dass es einige Fallstricke gibt!
Erst kürzlich ist ein beliebtes Vollkornbrot „abg...
Schwindel und Übelkeit, liegt es daran, dass sich der „Stein“ im Ohr verlagert hat?
Haben Sie in Ihrem Leben schon einmal plötzlichen...
Ist die WM-Vermarktung ein verlorenes Spiel für die TV-Branche?
„Kurzfristig hat die Fußball-Weltmeisterschaft ei...
Ist es gut, jeden Tag zu laufen?
Heutzutage sind die Menschen in ihrem Leben und b...