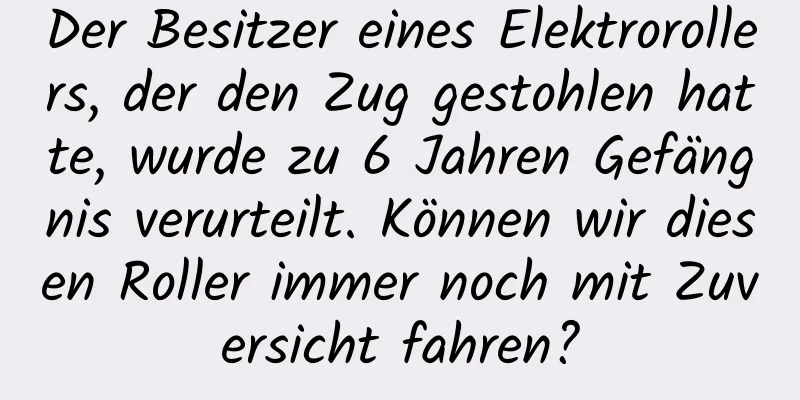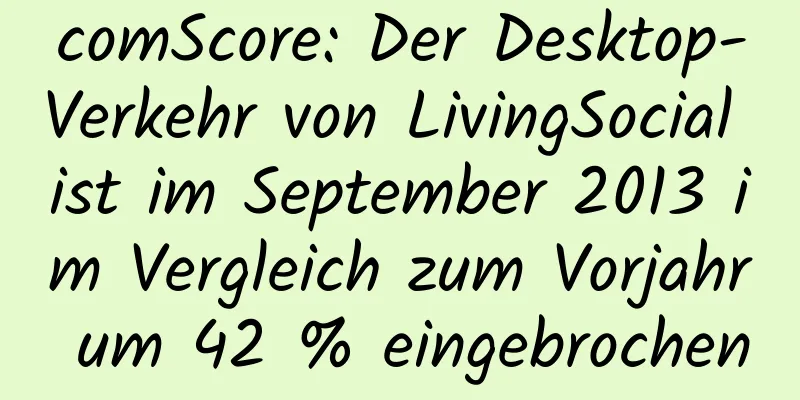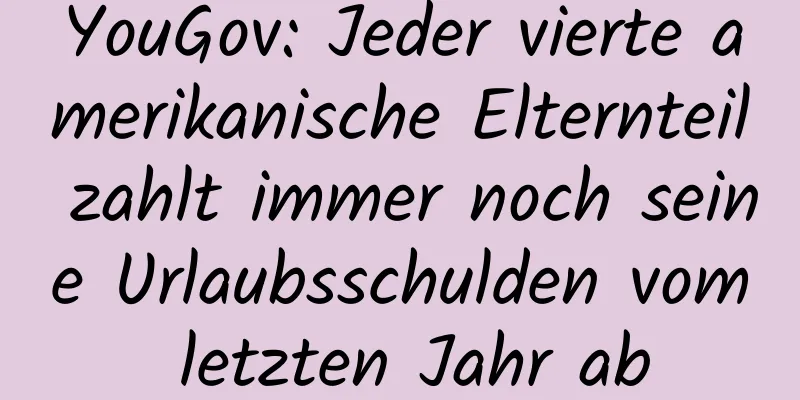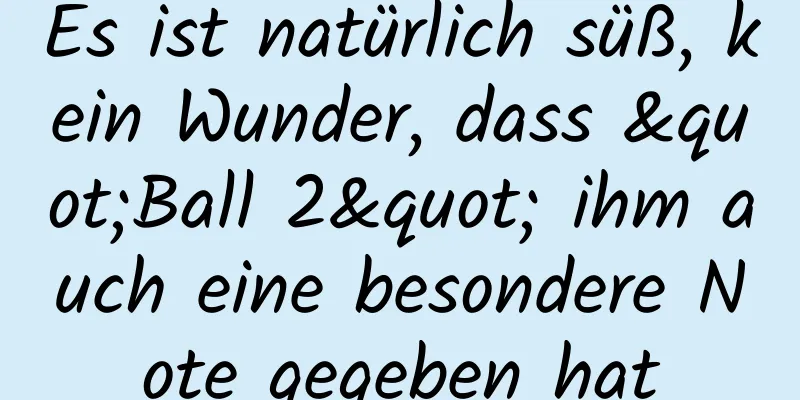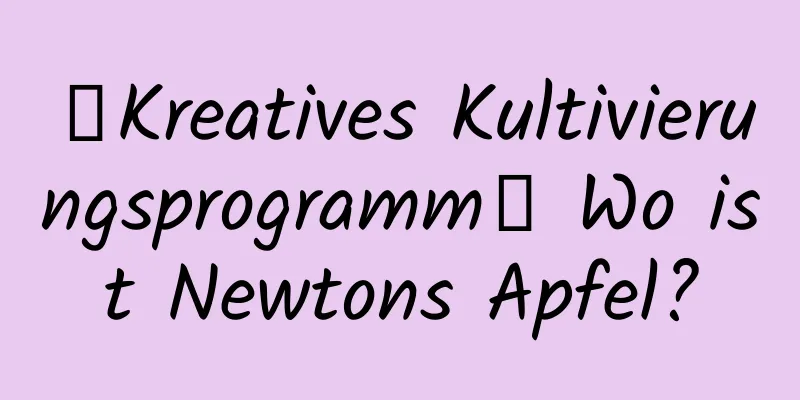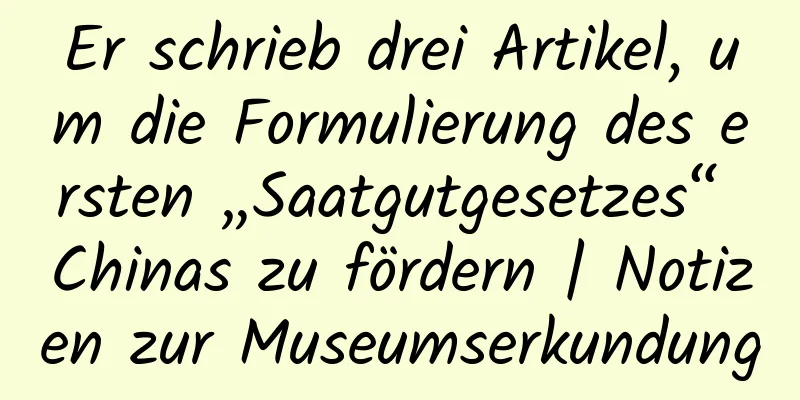Echte physikalische Begriffe: Mikroskopische Teilchen in der Quantenphysik
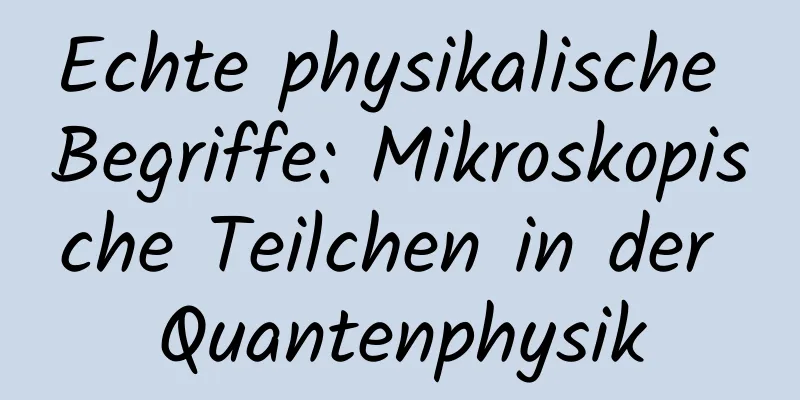
|
Ein Grundsatz bei der Bildung von Eigennamen besteht darin, das Wesen einer Sache offenzulegen oder ihre wichtigsten Merkmale hervorzuheben. Wenn neue Dinge zum ersten Mal auftauchen, benennen Wissenschaftler sie auf der Grundlage ihres jeweiligen Verständnisses. Angesichts der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Wissenschaft kann es jedoch vorkommen, dass das ursprüngliche Verständnis nicht immer stimmt und die verwendeten Begriffe leicht zu Fehlinterpretationen führen. Da der Begriff jedoch weit verbreitet ist, ist es nicht einfach, ihn zu ändern. Der Autor wird einige wichtige Begriffe der Physik „akribisch studieren“, ihre Bedeutung sorgfältig untersuchen und die tiefgreifenden physikalischen Implikationen dahinter erforschen. --Autor Geschrieben von Chen Shaohao (Massachusetts Institute of Technology, USA) Die Quantenmechanik ist eine der größten Errungenschaften der Physik des 20. Jahrhunderts. Es gibt viele Konzepte in der Quantenmechanik, die in der klassischen Physik nicht existieren, und einige davon widersprechen sogar der menschlichen Intuition. Allerdings ist es die Einführung dieser scheinbar seltsamen Konzepte, die die experimentellen Phänomene in der mikroskopischen Welt genau und effektiv erklären kann. Basierend auf der Quantenmechanik entwickelten Physiker die Quantenfeldtheorie weiter. In der modernen Physik ist die Quantenfeldtheorie zur grundlegenden Theorie zur Beschreibung mikroskopischer Teilchen geworden. Viele Konzepte der Quantenphysik unterscheiden sich stark von dem, was die Menschen im Alltag sehen und hören, und es ist nicht einfach, diese Konzepte mit geeigneten Fachbegriffen zu beschreiben. Basierend auf der Quantenmechanik und der Quantenfeldtheorie untersucht dieser Artikel einige physikalische Begriffe im Zusammenhang mit mikroskopischen Partikeln und erkundet ihre physikalische Bedeutung. Atome können gespalten werden Die makroskopischen Objekte, die Menschen im täglichen Leben sehen, bestehen aus Atomen oder Molekülen. Im frühen 19. Jahrhundert begründete der Chemiker Dalton die Atomtheorie. Diese besagt, dass die kleinste Einheit der materiellen Welt das Atom ist und dass Atome bei chemischen Veränderungen unverändert bleiben. Ein Molekül besteht aus mehreren Atomen, die durch chemische Bindungen miteinander verbunden sind. Das Wesentliche einer chemischen Reaktion besteht darin, dass Moleküle in Atome zerfallen und sich dann zu neuen Molekülen zusammensetzen. Das englische Wort für Atom ist „Atom“, das aus dem Griechischen stammt und ursprünglich „einzeln“ und „unteilbar“ bedeutet. Das chinesische Schriftzeichen „原“ ist ein Piktogramm und bedeutet ursprünglich die Quelle eines Baches. Später wurde es als „源“ geschrieben. Die abstrakte Bedeutung des Wortes „Yuan“ ist ursprünglich und ursprünglich und bezieht sich auf den Anfang oder Ursprung der Dinge, kann sich aber auch auf primitive Dinge beziehen. Beispielsweise ist mit Rohmaterial etwas gemeint, das vom Menschen nicht verändert wurde. Das chinesische Wort „Atom“ und das englische Wort „Atom“ haben die gleiche Bedeutung. Im 20. Jahrhundert entdeckten Physiker mit der Entwicklung moderner physikalischer Experimente und Theorien, dass Atome innere Strukturen haben und geteilt werden können. Ein Atom besteht aus einem Kern und Elektronen, wobei sich der Kern im Zentrum befindet und die Elektronen um den Kern herum verteilt sind. Obwohl sich die physikalische Bedeutung von Atom geändert hat, sind die Wörter „Atom“ im Englischen und „Atom“ im Chinesischen seit langem weit verbreitet und werden daher bis heute verwendet. Elementarteilchen sind unteilbar und haben keine Form Auch Atomkerne können gespalten werden. Der Atomkern besteht aus Protonen und Neutronen. Protonen und Neutronen lassen sich weiter zerlegen und bestehen aus Quarks. Quarks und Elektronen sind die grundlegendsten Teilchen. Die kleinste oder grundlegendste Einheit, aus der Materie besteht, wird Elementarteilchen genannt. Elementarteilchen sind unteilbar. Abbildung 1: Die innere Struktur eines Atoms. Ein Atom besteht aus einem Kern und Elektronen. Der Atomkern besteht aus Protonen und Neutronen. Neutronen und Protonen bestehen aus Quarks. Gemäß der quantenstatistischen Theorie können Elementarteilchen in zwei Kategorien unterteilt werden: Fermionen und Bosonen. Der Spin von Fermionen ist halbzahlig und der Spin von Bosonen ist ganzzahlig. Sie sind nach den Physikern Fermi und Bose benannt (Spin ist eine intrinsische Eigenschaft von Elementarteilchen, auf die später eingegangen wird). Nach dem Standardmodell der Teilchenphysik besteht alles auf der Welt aus drei Generationen von Basisfermionen. Beispielsweise sind Quarks und Leptonen die grundlegendsten Fermionen. Elektronen sind eine Art Lepton. Die ursprüngliche Bedeutung von Quark im Englischen ist der Schrei einer Möwe. Sein Entdecker, Gell-Mann, ließ sich von literarischen Werken inspirieren und verwendete dieses Wort zur Benennung. Drei Quarks bilden ein Baryon. Baryonen werden so genannt, weil ihre Masse viel größer ist als die der Leptonen. Protonen und Neutronen sind beide Baryonen. Ein Quark und ein Antiquark bilden ein Meson. Das englische Wort Meson kommt vom griechischen Wort Mesos, was Mitte bedeutet. Sein Entdecker Hideki Yukawa nannte es Meson, weil die Masse des Mesons zwischen der eines Elektrons und eines Protons liegt. In der Natur gibt es vier grundlegende Wechselwirkungen, von stark bis schwach: starke Wechselwirkung, elektromagnetische Wechselwirkung, schwache Wechselwirkung und Schwerkraft. Die Elementarteilchen, die Wechselwirkungen vermitteln, werden „Eichbosonen“ genannt. „Boson“ bedeutet, dass der Spin eine ganze Zahl ist, und „Eichung“ hat mit der Yang-Mills-Eichfeldtheorie zu tun. Gluonen sind beispielsweise Elementarteilchen, die starke Wechselwirkungen vermitteln. Das Wort „Kleber“ beschreibt anschaulich, wie starke Wechselwirkungen Quarks fest zusammenkleben und so Baryonen oder Mesonen bilden. Baryonen und Mesonen werden daher zusammenfassend als Hadronen bezeichnet. Die Protonen im Atomkern sind positiv geladen und es besteht eine elektromagnetische Abstoßung zwischen den Protonen. Es ist die starke Wechselwirkung, die durch Gluonen übertragen wird, die es ermöglicht, dass die Protonen aneinander „kleben“. Auch Photonen sind eine Art Elementarteilchen. Das englische Wort für Photon ist Photon, was auf Griechisch Licht bedeutet. Im Jahr 1926 verwendete der Physikochemiker Gilbert Lewis erstmals das Wort Photon, um den Träger des Lichts zu benennen. Später wurde dieser Begriff in der Wissenschaft weithin übernommen. Da Licht eine elektromagnetische Welle und die am weitesten verbreitete elektromagnetische Welle ist, wurde die Bedeutung des Wortes Photon noch erweitert und Physiker verwenden es zur Bezeichnung der Elementarteilchen, die elektromagnetische Wechselwirkungen übertragen. Das Wort Photon lässt die Menschen intuitiv denken, dass es Teilcheneigenschaften hat. Photonen haben Teilcheneigenschaften, was durch das Experiment zum photoelektrischen Effekt bestätigt wird. Allerdings besitzen Photonen auch Welleneigenschaften, was durch Youngs Doppelspalt-Interferenzexperiment bestätigt wird. Diese Welleneigenschaft spiegelt sich nicht im Wort „Photon“ wider. Der Autor ist der Ansicht, dass die Bezeichnung „elektromagnetische Elemente“ der physikalischen Bedeutung der Elementarteilchen, die elektromagnetische Wechselwirkungen übertragen, besser entspricht als die Bezeichnung „Photonen“. Das chinesische Wort „Partikel“ erinnert die Menschen leicht an feste Partikel in der makroskopischen Welt und lässt sie intuitiv denken, dass Partikel Formen haben. Manche Leute fragen sich vielleicht: Welche Form hat ein Elektron? Welche Form hat ein Proton? Ist es kugelförmig? Die Antwort lautet: Elementarteilchen haben keine Form. Das englische Wort für Partikel ist Particle und bedeutet unteilbare Grundeinheit. Welche Form diese Grundeinheit hat oder ob sie überhaupt eine Form hat, hat nichts mit der Bedeutung des Wortes „Partikel“ zu tun. Elementarteilchen sind gemäß der Quantenfeldtheorie die kleinsten Energieeinheiten von Quantenfeldern. Dies ist ein abstraktes Konzept und hat keine bestimmte Form wie ein makroskopisches Objekt. Daher ist die Übersetzung von Teilchen in „Element“ (d. h. die grundlegende Energieeinheit) genauer als die von „Partikel“. Atomorbitale haben keine Flugbahn Wenn in der mikroskopischen Welt viele neue Dinge entdeckt werden, neigen die Menschen dazu, zur Benennung dieser Dinge bestehende Begriffe aus der vertrauten makroskopischen Welt zu übernehmen. Mit der Entwicklung der Wissenschaft entdeckten die Menschen nach und nach, dass die Natur dieser Dinge nicht mit dem ursprünglichen Verständnis übereinstimmt und die ursprünglichen Begriffe ihre wahre Bedeutung nicht gut beschreiben können. Ein berühmtes Beispiel sind „Atomorbitale“. In der makroskopischen Welt bewegen sich Objekte gemäß Newtons Gesetzen der Mechanik entlang bestimmter Bahnen. Wenn diese Flugbahn bestimmt ist, wird sie üblicherweise als Umlaufbahn bezeichnet. Beispielsweise dreht sich die Erde auf einer elliptischen Umlaufbahn um die Sonne. In der mikroskopischen Welt ist die Situation anders. Als beispielsweise die Elektronen erstmals entdeckt wurden, glaubten die Menschen auf Grundlage des bekannten Konzepts der klassischen Mechanik, dass die Bewegung der Elektronen einer Flugbahn folgte. Genau wie die elliptische Umlaufbahn der Erde um die Sonne kreisen auch die Elektronen auf einer elliptischen Umlaufbahn um den Atomkern. Dieses auf der klassischen Mechanik basierende Modell weist jedoch schwerwiegende Mängel auf. Es kann nicht erklären, warum beschleunigte geladene Elektronen keine Energie nach außen abstrahlen. Nach der Etablierung der Quantenmechanik werden Elektronen durch Wellenfunktionen beschrieben, und der Modul der Wellenfunktion stellt die Wahrscheinlichkeit dar, mit der das Elektron im Raum erscheint. Die Elektronen in Atomen befinden sich in einem gebundenen Zustand, der in der mikroskopischen Welt ein Quantenzustand ist und sich vom Bewegungszustand makroskopischer Objekte unterscheidet. Gebundene Elektronen sind wie eine „Wolke“ um den Kern verteilt und haben keine bestimmte Bewegungsbahn. Am Beispiel des Wasserstoffatoms ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Elektronen im Grundzustand kugelförmig und die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Elektronen im ersten angeregten Zustand hantelförmig, was sich völlig von der elliptischen Bewegungsbahn klassischer Objekte unterscheidet. Gemäß der Unschärferelation können Position und Impuls eines Elektrons nicht gleichzeitig gemessen werden, d. h. die Bewegungsbahn des Elektrons ist ungewiss und hat keine Umlaufbahn. Daraus lässt sich erkennen, dass es ungeeignet ist, den Bewegungszustand von Elektronen mit der Umlaufbahn zu beschreiben. Im Jahr 1932 schlug der Chemiker Robert Mulliken vor, Orbit durch Orbital zu ersetzen. Dieses Konzept wird allgemein akzeptiert. In heutigen englischen Lehrbüchern und der Literatur wird „Atomorbital“ verwendet, um den Bewegungszustand von Elektronen in Atomen darzustellen, abgekürzt als „Orbital“. In der chinesischen Literatur wird „Atomorbital“ im Allgemeinen immer noch mit „Atomorbital“ übersetzt. Es ist erwähnenswert, dass die Bedeutungen von Orbital und Orbit nicht identisch sind. Mit Orbit wird in der klassischen Physik die Bewegungsbahn makroskopischer Objekte bezeichnet. „Orbital“ ist ein Adjektiv, das ursprünglich aus „Orbit“ hervorgegangen ist, und seine ursprüngliche Bedeutung bezieht sich auf etwas, das mit der Umlaufbahn zusammenhängt. Wenn Orbital jedoch als Substantiv verwendet wird, bezieht es sich speziell auf das Atomorbital in der Quantenmechanik. Seine eigentliche Bedeutung liegt im räumlichen Verteilungsmuster gebundener Elektronen, das sich völlig von der klassischen Bewegungsbahn unterscheidet. Der Autor ist der Ansicht, dass es sinnvoller ist, Orbital mit „Bindungsmodus“ statt mit „Umlaufbahn“ zu übersetzen. Unter Orbital versteht man auch den Bereich, in dem Elektronen mit größerer Wahrscheinlichkeit im Raum auftreten. Daher wird es in manchen Literaturquellen auch als „Orbital“ übersetzt. In einigen Dokumenten wird Orbital mit „Orbitalzustand“ übersetzt, was einen quantengebundenen Zustand bezeichnet. Leider hat keine dieser Behauptungen breite Akzeptanz gefunden. Abbildung 2: Elektronen im Grundzustand eines Wasserstoffatoms. Links: Nach der klassischen Physik ist ein Elektron eine kleine Kugel, die den Atomkern auf einer elliptischen Bahn umkreist. Das ist das falsche Bild. Rechtes Bild: Der Quantenmechanik zufolge haben Elektronen keine spezifische Form und keine festgelegte Bewegungsbahn. Stattdessen sind sie wie eine „Wolke“ um den Kern verteilt und kugelsymmetrisch. Dies ist das richtige Bild. Da der Begriff „Atomorbital“ in der chinesischen Literatur weit verbreitet ist, wird er im Folgenden weiterhin verwendet, um Verwirrung zu vermeiden. Elektronen in einem Atom werden durch Orbitalwellenfunktionen beschrieben. Die Orbitalwellenfunktion wird durch drei Quantenzahlen bestimmt, nämlich die Hauptquantenzahl, die Winkelquantenzahl und die magnetische Quantenzahl, die jeweils das Energieniveau, den Drehimpuls und die Bahnausrichtung des Elektrons darstellen. Die Drehimpulsquantenzahlen sind 0, 1, 2 und 3 und entsprechen jeweils dem s-Orbital, p-Orbital, d-Orbital und f-Orbital. Diese Namen leiten sich aus der Beschreibung des Erscheinungsbilds der charakteristischen Spektrallinien atomarer Spektren ab, nämlich scharfes Spektrum, Hauptspektrum, diffuses Spektrum und Fundamentalspektrum. Spin ist nicht Rotation Ein weiterer Begriff, der aus der makroskopischen Welt entlehnt wurde, um mikroskopische Dinge zu beschreiben, ist „Spin“. Spin ist ein Konzept der Quantenmechanik, das leicht missverstanden wird. Im Jahr 1924 schlug Pauli das berühmte Pauli-Prinzip vor, das besagt, dass sich nicht zwei Elektronen gleichzeitig im gleichen Quantenzustand befinden können. Um dieses Prinzip gültig zu machen, führte Pauli einen neuen Freiheitsgrad für Elektronen ein, den sogenannten „zweiwertigen Quantenfreiheitsgrad“. Pauli gelang es jedoch nicht zu erklären, welche physikalische Realität diesem „Freiheitsgrad“ entspricht. Im Jahr 1925 schlugen Kronig, Uhlenbeck und Goudsmit vor, dass dieser Freiheitsgrad dem Elektronenspin entspricht. Nach dem Bild der klassischen Physik stellt man sich das Elektron als geladene Kugel vor, deren Rotation einen Drehimpuls besitzt und ein Magnetfeld erzeugt, wodurch das experimentelle Phänomen der Aufspaltung atomarer Energieniveaus in einem äußeren Magnetfeld erklärt wird. Allerdings weist diese auf der Rotation makroskopischer Objekte basierende Erklärung erhebliche Probleme auf. Unter der Rotation eines makroskopischen Objekts (im Englischen auch Spin genannt) versteht man die Drehbewegung des Objekts relativ zu einer bestimmten Achse, beispielsweise die Rotation der Erde. Später, mit der Weiterentwicklung der Quantenmechanik, ging man in Theorie und Experiment davon aus, dass Elementarteilchen (einschließlich Elektronen) unteilbare Punktteilchen ohne Achsen sind, sodass die Rotation makroskopischer Objekte nicht direkt auf den Spin mikroskopischer Teilchen übertragen werden kann. Der Spin mikroskopischer Teilchen kann nur durch die Quantenmechanik erklärt werden. Die Quantenmechanik geht davon aus, dass der Spin ebenso wie Masse und Ladung eine intrinsische Eigenschaft von Elementarteilchen ist. Die Wirkungsgesetze des Spins ähneln denen des Drehimpulses in der klassischen Mechanik und können ebenfalls ein Magnetfeld erzeugen, unterscheiden sich jedoch grundlegend von der Rotation in der klassischen Mechanik. Spin bedeutet nicht, dass das Teilchen selbst „rotiert“, sondern vielmehr, dass das Teilchen mit einem „intrinsischen Drehimpuls“ geboren wird. Intrinsisch bedeutet, dass der Spinwert nur von der Art des Teilchens abhängt und nicht durch äußere Kräfte verändert werden kann. Der Spinwert wird quantisiert und durch die Spinquantenzahl beschrieben. Beispielsweise beträgt die Spinquantenzahl eines Elektrons 1/2 und die Spinquantenzahl eines Photons 1. Ein dem Spin ähnliches Konzept ist der Isospin. Isospin ist eine Quantenzahl, die mit der starken Wechselwirkung zusammenhängt und zur Unterscheidung zwischen Teilchen mit unterschiedlichen Ladungszuständen, wie etwa Protonen und Neutronen, verwendet wird. Isospin ist eine dimensionslose physikalische Größe ohne Drehimpulseinheit und hat daher nichts mit der Rotation in der klassischen Physik zu tun. Der Name „Isospin“ kommt einfach daher, dass seine mathematische Beschreibung dem Spin sehr ähnlich ist. Über den Autor Shaohao Chen hat einen Bachelor-Abschluss in Physik und einen Doktortitel in Atom- und Molekularphysik von der Tsinghua-Universität. Er war Postdoktorand an der University of Colorado Boulder und hat an der Louisiana State University und der Boston University gearbeitet. Derzeit arbeitet er am Massachusetts Institute of Technology und beschäftigt sich mit Hochleistungsrechnen. Dieser Artikel wird vom Science Popularization China Starry Sky Project unterstützt Produziert von: Chinesische Vereinigung für Wissenschaft und Technologie, Abteilung für Wissenschaftspopularisierung Hersteller: China Science and Technology Press Co., Ltd., Beijing Zhongke Xinghe Culture Media Co., Ltd. Besondere Tipps 1. Gehen Sie zur „Featured Column“ unten im Menü des öffentlichen WeChat-Kontos „Fanpu“, um eine Reihe populärwissenschaftlicher Artikel zu verschiedenen Themen zu lesen. 2. „Fanpu“ bietet die Funktion, Artikel nach Monat zu suchen. Folgen Sie dem offiziellen Account und antworten Sie mit der vierstelligen Jahreszahl + Monat, also etwa „1903“, um den Artikelindex für März 2019 zu erhalten, usw. Copyright-Erklärung: Einzelpersonen können diesen Artikel gerne weiterleiten, es ist jedoch keinem Medium und keiner Organisation gestattet, ihn ohne Genehmigung nachzudrucken oder Auszüge daraus zu verwenden. Für eine Nachdruckgenehmigung wenden Sie sich bitte an den Backstage-Bereich des öffentlichen WeChat-Kontos „Fanpu“. |
Artikel empfehlen
Die Rolle und Grundbewegungen beim Basketballspielen
Mein kleiner Mann liebt es, Basketballspiele zu s...
Paralleluniversum, Wissenschaft oder Science-Fiction?
Jede Entscheidung, die Xiulian trifft, „erschafft...
Wie wäre es mit Yoga zu Hause
Da viele Menschen introvertiert sind, sind sie ni...
Welche Vorteile bietet das Fahrradfahren?
Fahrräder waren früher ein Transportmittel. Damal...
Was sind Aerobic-Übungen?
Einige Freunde haben durch Aerobic eine schöne Fi...
iOS 9 hat einen schwerwiegenden Fehler aufgedeckt: Das Umgehen des Sperrbildschirmkennworts für den Zugriff auf das Fotoalbum und die Kontakte
Daten zeigen, dass die Installationsrate von iOS ...
Wie erzeugt „nuklear“ „Dampf“?
Science Times-Reporter Ji Chunhong An der gewunde...
Kann Lichtenergie durch die „Zeitrisse“ dringen und in die Vergangenheit und die Zukunft eingreifen? Wissenschaftler haben zum ersten Mal bewiesen
Science-Fiction-Netzwerk, 13. April. Wissenschaft...
Fujifilm X-A1-Parameter offengelegt: 16 Millionen Pixel, integriertes WLAN
[Neuigkeiten vom 9. September] Vor Kurzem hat die...
Sie können die Preiserhöhung nicht stoppen? Eine kurze Analyse der Gründe für den SSD-Preisanstieg
Die größte Neuigkeit auf dem SSD-Markt dürfte in ...
Baojun ist im Kleinwagenmarkt tätig. Warum sind Geely und Great Wall immer noch gleichgültig?
Ganz gleich, um welche Art von Markt es sich hand...
Vom Aussterben zur Wiedergeburt: Was hat der „Orientalische Edelstein“, der Schopfibis, erlebt?
Prüfungsexperte: Wang Lei Forscher für Nationalpa...
Gerüchteliste „Science“ Mai 2024: Sind QR-Codes bald aufgebraucht? Kann das „Zauberwerkzeug der körperlichen Untersuchung“ Ihre Noten verbessern?
Die „Science“-Gerüchteliste für Mai 2024 wurde be...
Vorsichtsmaßnahmen für Sportler beim Training
Sie sehen vielleicht, dass Sportler auf dem Feld ...