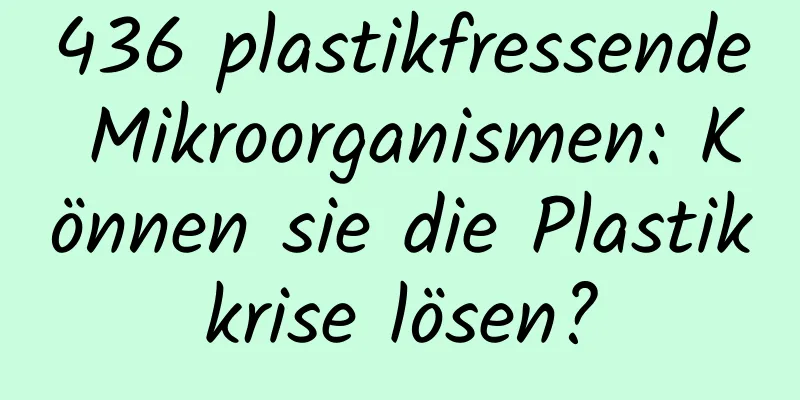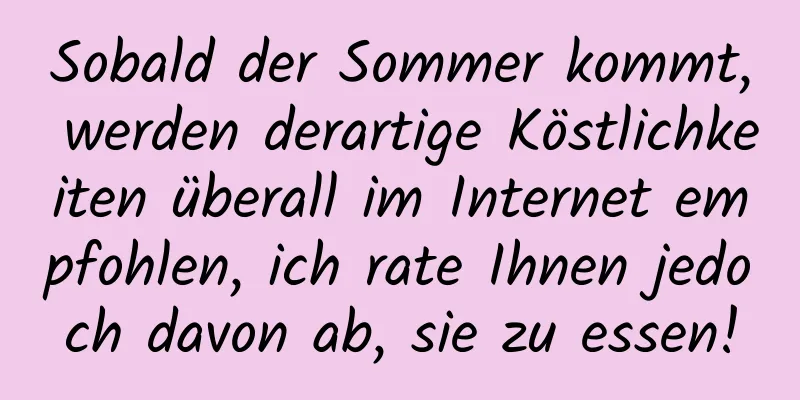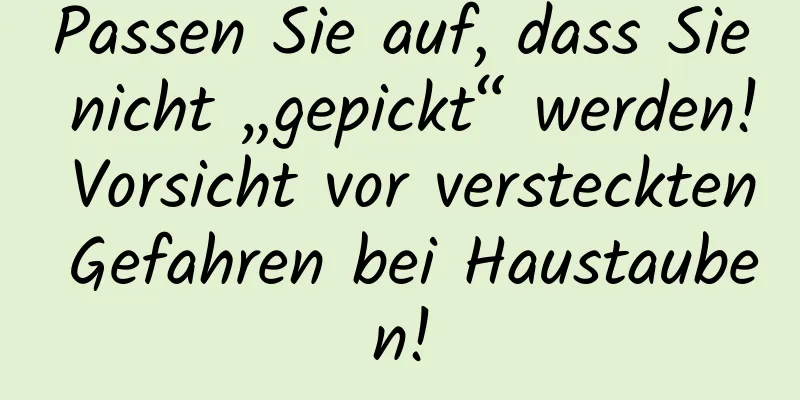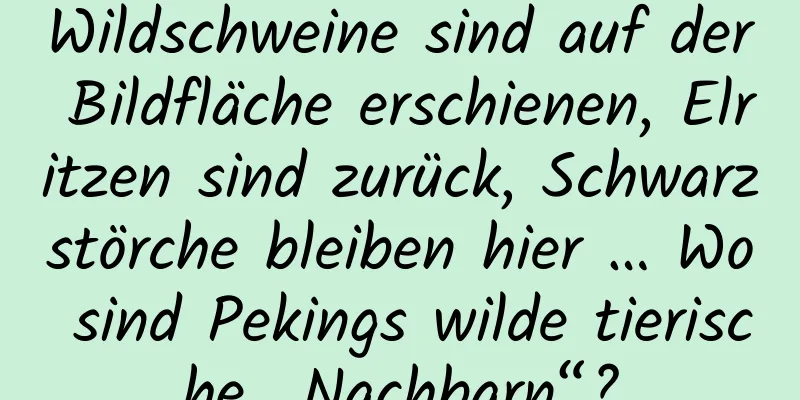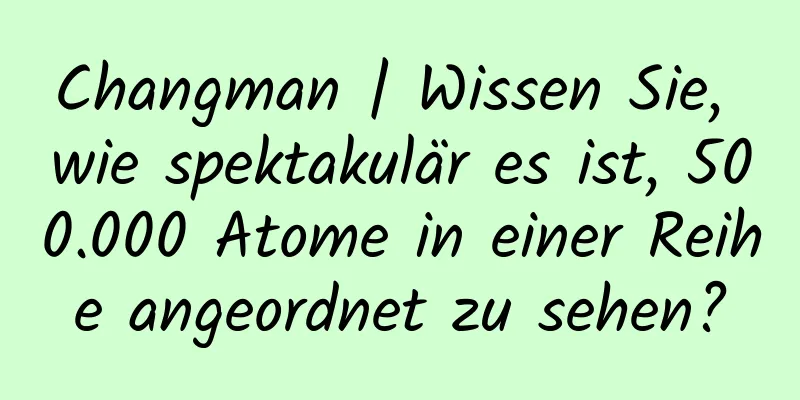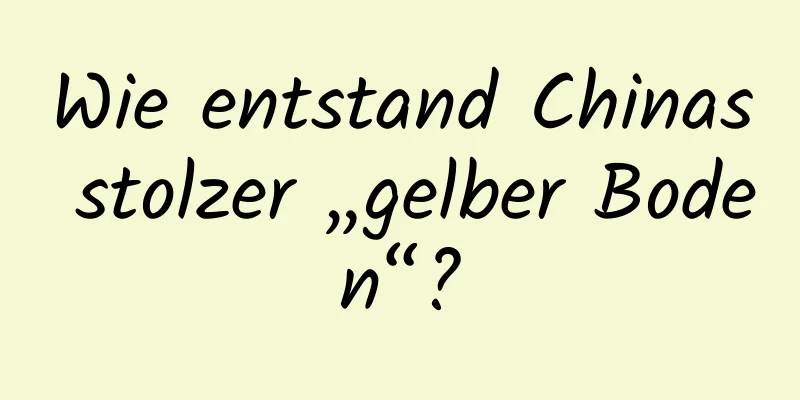Warum will Italien, das die Einführung von Zöllen auf chinesische Elektrofahrzeuge gefordert hat, nun, dass seine schöne Premierministerin kommt und um Investitionen bittet?
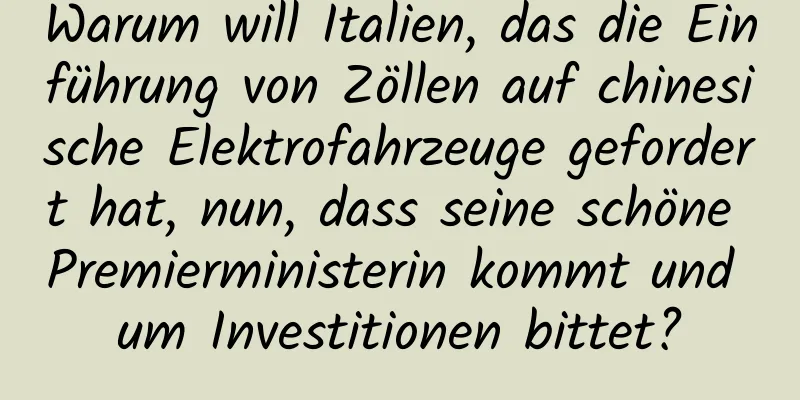
|
Sollten Zölle auf chinesische Elektrofahrzeuge erhoben werden? Dies ist ein Punkt, dem die EU-Länder in letzter Zeit kollektiv Aufmerksamkeit geschenkt haben. Der globale Automobilmarkt befindet sich derzeit in einer kritischen Phase des Wandels. China und die EU sind die beiden größten Akteure im weltweiten Markt für Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnologie. Daher ist die endgültige Entscheidung der EU von großer Bedeutung. Die EU zögert in dieser Frage seit mehreren Monaten. Ursprünglich war europäischen Medienberichten zufolge für den 25. September eine Abstimmung der EU zu diesem Thema geplant, die Tagesordnung wurde nun jedoch gestrichen. Das Hin und Her in einer so wichtigen Zollfrage spiegelt die großen Spaltungen innerhalb der EU wider. Am 11. September beendete der spanische Premierminister Sanchez seinen Besuch in China und machte deutlich, dass die EU ihre Position zur Einführung von Zöllen auf chinesische Elektrofahrzeuge überdenken sollte. Am 24. September erklärte der ungarische Außenminister öffentlich, dass er gegen diese Angelegenheit stimmen werde. Branchenkenner gehen davon aus, dass Deutschland, die größte Automobilmacht in der EU, sich bei der Schlussabstimmung wahrscheinlich enthalten wird. Gleichzeitig haben einige Länder ihre Unterstützung für die Steuererhöhungspläne der EU zum Ausdruck gebracht. Neben Frankreich, dem „Anstifter“, zählt auch Italien zu den Hauptbefürwortern des Plans. Kürzlich erklärte der stellvertretende italienische Ministerpräsident Tania, er werde die Einführung von Antisubventionszöllen der EU auf mit alternativen Antrieben betriebene Fahrzeuge aus China weiterhin unterstützen. Die Aussage Italiens ist ziemlich überraschend. Als die schöne italienische Premierministerin Meroni Ende Juli China besuchte, hieß sie chinesische Investitionen öffentlich willkommen. Und schon vor Meronis China-Besuch gab es Berichte, wonach die italienische Regierung einige ihrer eingestellten Automarken übernehmen und an chinesische Hersteller übertragen wolle. Ist die aktuelle Aussage Italiens widersprüchlich? Italien mag in bestimmten außenpolitischen Fragen schwanken, doch bei einem so zentralen Thema wie den EU-Zöllen auf chinesische Elektrofahrzeuge dürfte es kaum zu Widersprüchen kommen, da es den Plan von Anfang an unterstützt hat. Der Zweck Italiens dabei ist eigentlich dem Frankreichs recht ähnlich. Italien selbst muss eine Elektrofahrzeugindustrie aufbauen, aber die heimische Elektrofahrzeugindustrie hinkt erheblich hinterher. Im Jahr 2023 erreichte der Absatz reiner Elektrofahrzeuge in Italien 66.276 Einheiten, mit einer Durchdringungsrate von etwa 4,2 %. Seit 2024 sind die Umsätze jedoch weiter rückläufig, im ersten Quartal um 18,5 % und im zweiten Quartal um 34,9 %. Im ersten Halbjahr lag die Durchdringungsrate von Elektrofahrzeugen bei lediglich 3,9 Prozent, womit das Land zu den Ländern mit der niedrigsten Durchdringungsrate von Elektrofahrzeugen in Europa zählt. Auch die Leistung Italiens im Bereich der Kerntechnologien für Elektrofahrzeuge und der damit verbundenen Industrieketten ist relativ schwach. Als Meroni im Juli China besuchte, begleitete ihn der größte italienische Autoteilehersteller, der Reifenhersteller Pirelli. Man kann sich die Schwäche Italiens in der industriellen Kette vorstellen. Im Oktober 2023 schloss die Stellantis Group durch den Erwerb von Anteilen eine Kooperation mit Leapmotor ab. Bei dieser Kooperation spielt Leapmotor die Rolle des Technologieexporteurs, während Leapmotor in China lediglich ein zweitrangiger Automobilhersteller ist. Mit anderen Worten: Die heutige italienische Elektrofahrzeugindustrie weist große Ähnlichkeiten mit der chinesischen Automobilindustrie vor 40 Jahren auf. Es ist grundsätzlich unmöglich, durch Eigenständigkeit eine beherrschende Stellung zu erlangen. In dieser Situation ist es am besten, dem Beispiel Chinas zu folgen. Erstens muss Italien die Kosten für den Eintritt chinesischer Hersteller von Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnologie in den europäischen und italienischen Markt durch administrative Maßnahmen wie etwa die Erhöhung von Zöllen künstlich in die Höhe treiben und so den einheimischen Automobilherstellern Spielraum zum Überleben lassen. Zweitens muss Italien energisch Investitionen anziehen und ausländische Riesen wie BYD und Geely sowie ausländische Autoteileriesen wie CATL anlocken. Man hofft, dass diese Hersteller in Italien investieren und Fabriken errichten, ihren Technologietransfer und ihre Verbreitung erreichen und dann schrittweise eine lokale Industriekette für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben aufbauen. Mit den sogenannten „Zusatzzöllen“ werden Elektrofahrzeuge belegt, die in China produziert und anschließend in die EU exportiert werden. Dieser Fahrzeugtyp ähnelt den in unserem Land häufig anzutreffenden „Importautos“. Wenn chinesische Hersteller in Italien investieren und Fabriken errichten und ihre Autos zu italienischen „Inlandsautos“ werden, sind sie von der Zollpolitik nicht betroffen. Daher besteht kein Widerspruch zwischen der Tatsache, dass Italien einerseits Zölle auf chinesische Elektrofahrzeuge erhebt und andererseits Investitionen chinesischer Hersteller in Italien willkommen heißt. Vielmehr handelt es sich um zwei verschiedene Mittel, die demselben Zweck dienen: der italienischen Elektrofahrzeugindustrie letztlich zu einem erfolgreichen Markteintritt zu verhelfen. Italien vertritt zudem eine Grundsatzentscheidung: Selbst wenn Zölle eingeführt würden, würde dies die Investitionsfreude chinesischer Hersteller in Europa nicht dämpfen. Tatsächlich hatten sich chinesische Hersteller bereits vor der Vorlage des Steuererhöhungsplans durch die EU aktiv um Investitionen und die Gründung von Fabriken in europäischen Ländern wie Italien bemüht. Italienische Automarken haben auf dem chinesischen Markt einen immer geringeren Einfluss und wurden vor einigen Jahren an den Rand gedrängt. Der chinesische Markt ist für sie entbehrlich, deshalb haben sie nicht so große Angst vor chinesischen Vergeltungsmaßnahmen wie Deutschland. Dies ist auch ein wichtiger Grund, warum Italien die Steuererhöhungspläne der EU entschlossen unterstützt. Theoretisch ist an Italiens Ansatz nichts auszusetzen. Auch die chinesische Automobilindustrie hat zu Beginn Zölle auf importierte Autos erhoben und Joint Ventures gefördert. Damit versuchte man, eine italienische Version eines „Marktes für Technologie“ zu schaffen. Doch zwischen Theorie und Realität klafft eine Lücke. „Wenn China es kann, kann ich es auch“ ist eine Illusion vieler Länder dieser Welt. Italiens Wunschdenken wird wahrscheinlich scheitern. China konnte damals die Strategie des „Marktes für Technologie“ umsetzen, weil das Land über einen extrem großen inländischen Automobilmarkt verfügte. Im Jahr 1980 wurden in China lediglich 165.000 Autos verkauft, im Jahr 2023 stieg die Zahl jedoch auf 30 Millionen Fahrzeuge. Solch ein Super-„Kuchen“ reicht aus, um jeden großen Automobilhersteller anzulocken. Italien verfügt offensichtlich nicht über diese Energie. Das Beharren Italiens auf der Erhebung von Zöllen auf chinesische Autohersteller hat die kooperativen Beziehungen und das gegenseitige Vertrauen zwischen Italien und den chinesischen Herstellern untergraben, was sich negativ auf die Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten auswirken wird. Darüber hinaus ist Italien nicht das einzige Land, das die Produktionskapazitätsübertragung der chinesischen Hersteller von Fahrzeugen mit alternativer Energie übernehmen kann. Auch Spanien, Ungarn und sogar die Türkei können dies. Italien ist in dieser Hinsicht nicht unersetzlich. Letztendlich gibt es in dieser Angelegenheit nur zwei mögliche Ergebnisse.
In Europa wird noch immer über diese Frage gestritten, doch Italien selbst sollte sich darüber im Klaren sein, dass es als altes, entwickeltes kapitalistisches Land nicht mehr das ist, was es einmal war. Wenn sie den Drahtseilakt zwischen linker und rechter Politik vollführen will, wird sie am Ende höchstwahrscheinlich scheitern. Das Unternehmen wird seine Schwächen in der Elektroindustrie niemals vertuschen, nur weil die attraktive Premierministerin des Landes eine persönliche Freundschaft mit Musk pflegt. Als Gewinner des Qingyun-Plans von Toutiao und des Bai+-Plans von Baijiahao, des Baidu-Digitalautors des Jahres 2019, des beliebtesten Autors von Baijiahao im Technologiebereich, des Sogou-Autors für Technologie und Kultur 2019 und des einflussreichsten Schöpfers des Baijiahao-Vierteljahrs 2021 hat er viele Auszeichnungen gewonnen, darunter den Sohu Best Industry Media Person 2013, den dritten Platz beim China New Media Entrepreneurship Competition Beijing 2015, den Guangmang Experience Award 2015, den dritten Platz im Finale des China New Media Entrepreneurship Competition 2015 und den Baidu Dynamic Annual Powerful Celebrity 2018. |
<<: Was ist ein Heilungsredner? Es kann Ihre Stimmung spüren
>>: KI ist da, und die am meisten Panik auslösenden Modelle sind Taobao
Artikel empfehlen
Hebe deinen Fuß! Klatscht in die Füße! Das Fett an den Seiten bricht ab! Nicht einmal Liu Genghong kann die „Sportmüdigkeit“ überwinden! ! !
Prüfungsexperte: Wang Linyu Das zweite angeschlos...
Dehnung der vorderen Wade
Die Wadenmuskulatur ist eine der Kernmuskeln des ...
Er baute einen Roboterarm, der ihm die Haare schnitt, und …
Wie der Titel schon andeutet, baute jemand einen ...
Wenn Sie so gut darin sind, Spaß zu haben, warum kommen Sie dann nicht in den Himmel? Ich zeige es euch hier!
Kinder können nicht ohne Spielzeug leben. Gutes S...
Wie spektakulär ist das „Tor“ zum Einen Tal und den Neun Wasserfällen? Entdecken Sie die Geheimnisse der größten natürlichen Gneisbrücke Chinas
„Ein natürlicher Steinbogen, der über einem erodi...
Polyphenole in Birnen, ein gesundes „Gegenmittel“ zu fettreichen Lebensmitteln?
Wenn der Cholesterinspiegel im Blut steigt, kann ...
Bankdrücken mit Langhantel
Langhanteln sind etwas, das viele Leute kennen, a...
Wie verliert man Fett an den Innenseiten der Oberschenkel?
Im Sommer tragen Freundinnen oft Shorts. Wenn sie...
Neuigkeiten zu Elektroautos: Der Vision X1 verzichtet auf 7 Sitze, um junge Leute anzulocken, und kostet nur 40.000 Yuan, was den Baojun 310 in Sekundenschnelle schlägt
SUV, Automatikgetriebe, Tempomat, Panorama-Schieb...
Wie wählt man Joggingschuhe für Damen aus?
Heutzutage legen viele Menschen Wert darauf, Spor...
Halbstündiger Comic zur chinesischen Geschichte: Mythologisches China (1)
Gemischtes Wissen Speziell entwickelt, um Verwirr...
Ein Auto ohne Fahrer? Wie AGI den Menschen aus dem autonomen Fahren „entfernen“ kann
[Anmerkung des Herausgebers] Das Aufkommen von Ch...
Wie dehnen Sie sich nach dem Training?
Nach dem Training gibt es viele Vorsichtsmaßnahme...
Mit einer kleinen Methode lässt sich testen, ob Sie einen „Körperbau haben, mit dem sich leicht Gewicht verlieren lässt“?
Viele Menschen haben auf dem Weg zum Abnehmen ähn...
Wie kann ich schnell an den Armen abnehmen?
Bei heißem Wetter tragen viele Frauen kühlere Kle...