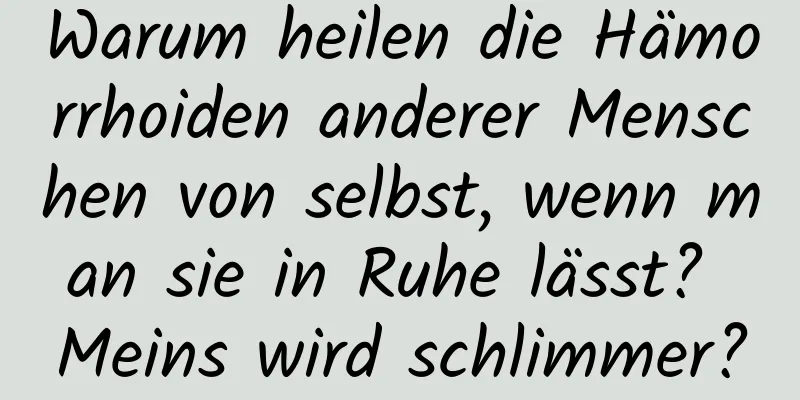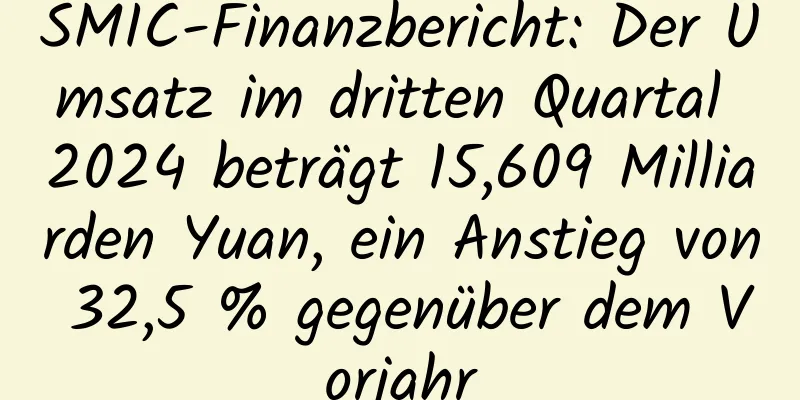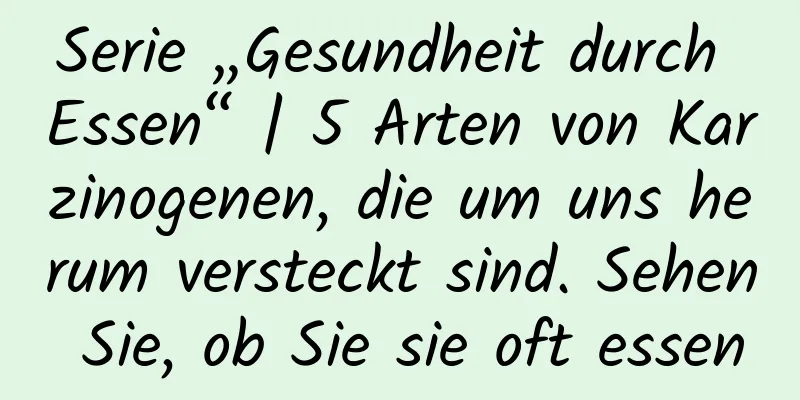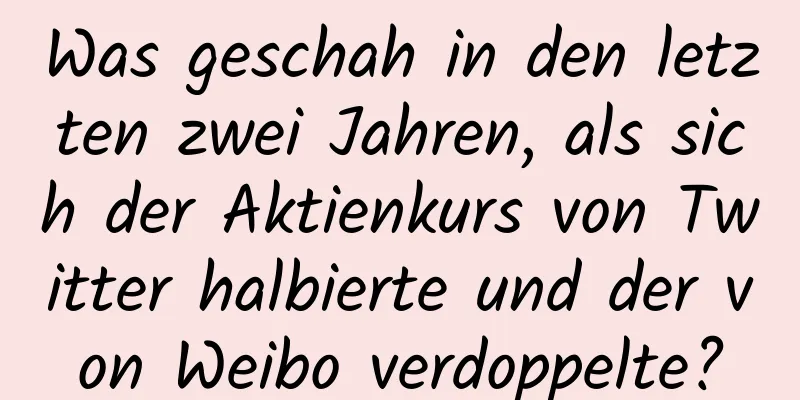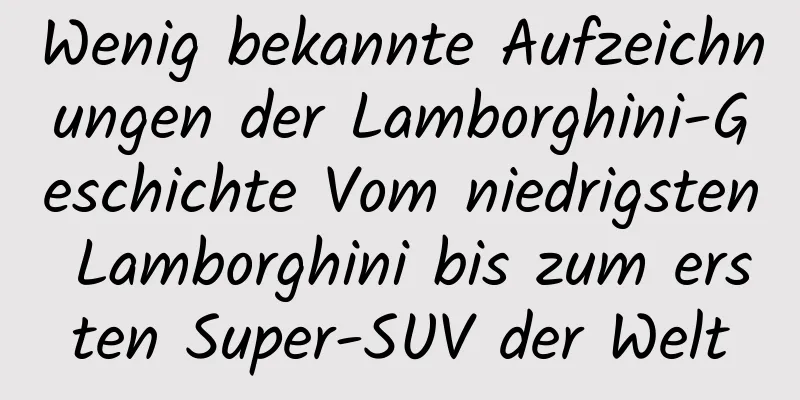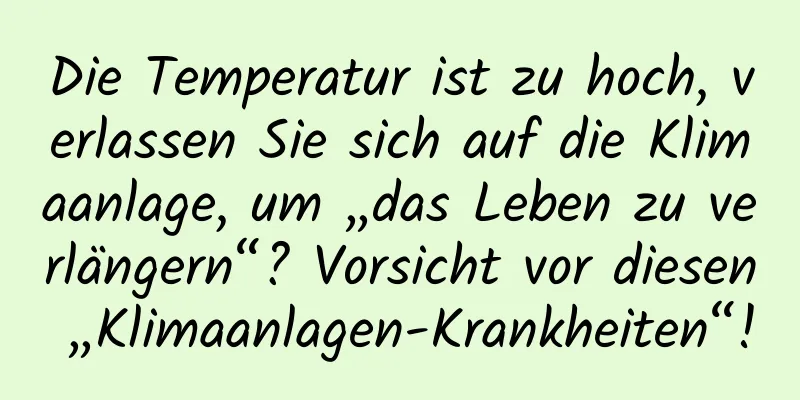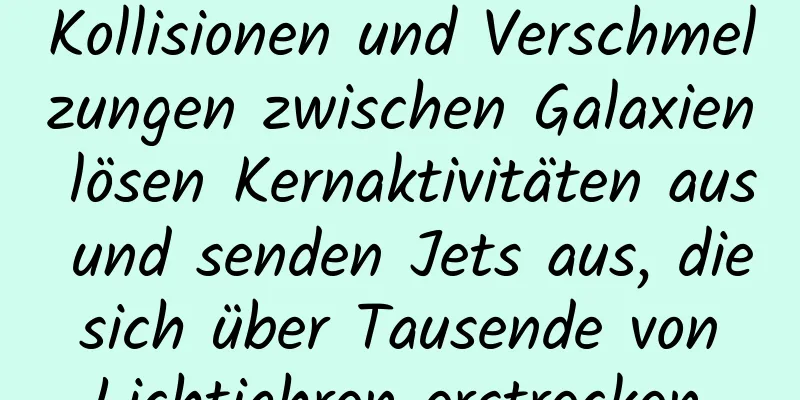Es gibt verschiedene optische Täuschungen. Welchen Sinn hat es, sie zu studieren?
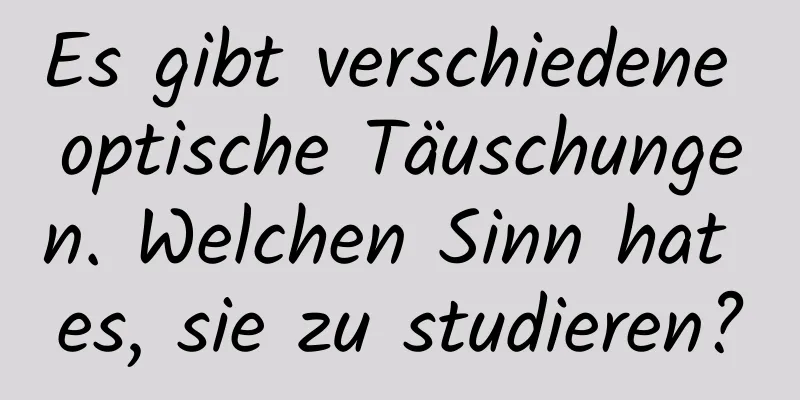
|
Wir müssen nicht nur die Illusionen der Menschen, sondern auch die der Tiere untersuchen. Geschrieben von Xu Zilong (Southeast University) Vor langer Zeit gab es ein Sprichwort, dass Fehleinschätzungen zum Fußball oder zum Charme des Fußballs gehören. Natürlich wurde diese Aussage später widerlegt. Die FIFA konnte dem Druck von allen Seiten nicht standhalten und begann mit Reformen. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien wurde erstmals Torlinientechnologie eingeführt, bei der der Hightech-Schiedsrichter „Hawkeye“ die Schiedsrichter bei ihren Entscheidungen unterstützte. Warum sind Schiedsrichter manchmal unzuverlässig? Ganz zu schweigen von den Winkelproblemen und Konzentrationsproblemen, die durch die mangelnde Sicht entstehen. Selbst wenn der Ball vor Ihnen vorbeifliegt, können Sie immer noch falsche Einschätzungen abgeben. Wenn Sie es nicht glauben, schauen Sie sich das Bild unten an: Abbildung 1. Flash-Lag-Effekt | Quelle: Wikipedia Wenn sich das rote Quadrat in die Mitte des Bildes bewegt, blinkt gleichzeitig das grüne Quadrat, aber wir haben das Gefühl, dass das rote Quadrat vorbei ist, wenn das grüne Quadrat blinkt. Diese Illusion wird Flash-Lag-Effekt genannt. Vereinfacht ausgedrückt besteht der Flash-Lag-Effekt darin, dass bei einer Bewegung eines visuellen Reizes entlang einer kontinuierlichen Bahn die wahrgenommene Position des bewegten Reizes seiner tatsächlichen Position im Verhältnis zu allen plötzlichen Ereignissen (wie beispielsweise Blitzen), die entlang dieser Bahn auftreten können, voraus ist (Abbildung 1) [1]. Bei Fußballspielen können Schiedsrichterassistenten aufgrund des Flash-Lag-Effekts [2] Fehler bei der Beurteilung machen, ob ein angreifender Spieler im Abseits steht (Abbildung 2). Im Abseits-Szenario entspricht der empfangende Spieler der angreifenden Mannschaft dem sich kontinuierlich bewegenden roten Quadrat, während die Passaktion des passierenden Spielers dem plötzlichen Ereignis (grüner Blitz) entspricht. Der Moment des Passes ist für den Schiedsrichterassistenten der Zeitpunkt, auf Abseits zu entscheiden. Aufgrund des Flash-Lag-Effekts wird der Schiedsrichterassistent denken, dass das Passereignis verzögert ist, und der laufende empfangende Spieler wird als näher am Tor wahrgenommen als es die tatsächliche Position ist, was zu einem Flaggenfehler (FE) führt. Abbildung 2. Schematische Darstellung der Fehleinschätzung des Schiedsrichterassistenten. ▲Spieler der angreifenden Mannschaft; △Die Position der Spieler der angreifenden Mannschaft aus der Sicht des Schiedsrichterassistenten; ●Die Position des vorletzten Spielers der verteidigenden Mannschaft; ■Schiedsrichterassistent. (Bild modifiziert aus Referenz [2], klicken Sie, um ein größeres Bild zu sehen) (a) Schematische Darstellung der Geometrie der On-Position- und Off-Side-Positionen. Im Moment des Passes des Offensivspielers ist die relative Position des annehmenden Spielers und des vorletzten Spielers der Abwehrmannschaft das Kriterium dafür, ob Abseits vorliegt. (B) Schematische Darstellung der Auswirkungen des Flash-Lag-Effekts auf Abseitsentscheidungen. Wenn der annehmende Spieler der angreifenden Mannschaft im schattierten Bereich der Figur auf das gegnerische Tor zuläuft, ist in dem Moment, in dem der passierende Mitspieler den Ball berührt, die vom Schiedsrichterassistenten wahrgenommene Position (weißes hohles Dreieck) wahrscheinlich näher am Tor als seine tatsächliche Position (schwarzes ausgefülltes Dreieck), was zu einer Fehleinschätzung führt. Offensichtlich kann uns das Verständnis optischer Täuschungen dabei helfen, zu erkennen, dass Schiedsrichter in manchen Fällen unschuldig sind. Neben der Illusion des Flash-Lag-Effekts, die die Leute zu vermeiden versuchen, gibt es auch einige „gute“ Illusionen, die genutzt werden können, um das Beste aus einer schlechten Situation zu machen. Aus der Sicht eines Sehforschers kann man beispielsweise sagen, dass der berühmte psychologische Projektionstest, der Rorschach-Test, auf einer optischen Täuschung beruht. Genauer gesagt sucht unser Gehirn immer nach bekannten Mustern in zufälligen Strukturen mit geringem Informationsgehalt. Dieses psychologische Phänomen wird Pareidolie genannt[3]. Abbildung 3. Beispiel für einen Rorschach-Tintenkleckstest | Quelle: Wikipedia Natürlich sind alle menschlichen Gesichter auf dem Mars, die Kaninchen auf dem Mond, der Teufel/Gott im Tornado und die Buddha-Statuen im Wolkenmeer das Ergebnis imaginärer optischer Täuschungen. Aus den beiden oben genannten Beispielen können wir erkennen, dass das Sehen nicht nur ein „Gefühl“ unter den „fünf Sinnen“ (Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten) ist, sondern eine „Wahrnehmung“, bei der das Gehirn an der Interpretation beteiligt sein muss. Bei einer verzerrten Interpretation entsteht eine Illusion. Visuelle Täuschungen sind die beste Anpassung unseres Sehsystems an visuelle Szenen. Diese Anpassungen sind in unserem Gehirn „fest verdrahtet“ und können zu unangemessenen Interpretationen visueller Szenen führen. So wie die Medizin den menschlichen Körper anhand von Patienten untersucht, können auch die Psychologie und die Neurowissenschaften visuelle „Fehler“ nutzen, um die Struktur und Funktion des visuellen Systems aufzudecken und die Mechanismen des Sehens (bei Menschen und Tieren) zu verstehen. Es gibt viele optische Täuschungen, von denen die meisten noch nicht ausreichend erklärt wurden. Wir wissen bereits, dass Helligkeit und Kontrast, Bewegung, Geometrie oder Perspektive, dreidimensionale Interpretation (Größenkonstanz und unmögliche Bilder) und kognitive/Gestalt-Effekte allesamt optische Illusionen verursachen können. Aus der Perspektive ihres Entstehungsmechanismus lassen sich visuelle Illusionen grob in drei Typen unterteilen: geometrische Illusionen, die durch die Struktur des Bildes selbst verursacht werden, physiologische Illusionen, die durch Sinnesorgane verursacht werden, und kognitive Illusionen, die psychologische Ursachen haben. 01 Optische Täuschungen durch Helligkeit und Kontrast Das klassische „Hermann-Gitter“ ist eine optische Täuschung, die der deutsche Physiologe Ludimar Hermann (1838–1914) in den 1870er Jahren entdeckte. Wenn Sie das weiße Gitter im Bild unten scannen, werden Sie feststellen, dass sich dort, wo sich die weißen Linien kreuzen, schwache graue Flecken befinden. Wenn Sie jedoch direkt auf die Schnittpunkte der weißen Linien starren, verblassen diese grauen Flecken oder verschwinden. Abbildung 4. Hermanger | Quelle: Wikipedia Eine weitere ähnliche Illusion ist die 1994 entdeckte Funkelgitter-Illusion. Sie wird oft als Variante der Hermanger-Illusion angesehen. Abbildung 5. Flackerndes Gitter | Quelle: Wikipedia Diese beiden Illusionen sind sehr ähnlich und beinhalten beide den gleichen Prozess im visuellen Nervensystem: laterale Hemmung. Das menschliche Auge ist wie eine hochentwickelte Kamera. Die Netzhaut am unteren Rand des Auges ist wie ein lichtempfindlicher Film, der aus einer großen Anzahl von Sehnervenzellen besteht (siehe Abbildung 6). Abbildung 6. Anatomie der Netzhaut[4] Abbildung 7. Struktur der Netzhautschichten[4] Wenn Licht in die Netzhaut eintritt, wandelt diese das Lichtsignal in Nervenimpulse um, die über den Weg Photorezeptor → Bipolarzelle → Ganglienzelle an das Sehzentrum der Großhirnrinde weitergeleitet werden. Der Bereich, in dem visuelle Neuronen auf Lichtreize reagieren, wird als „rezeptives Feld“ bezeichnet[4]. Das rezeptive Feld der meisten visuellen Neuronen ist in einen zentralen und einen umgebenden Teil unterteilt (siehe Abbildung 7), der als „Zentrum-Umgebung-rezeptives Feld“ bezeichnet wird. Eine seiner wichtigen Eigenschaften besteht darin, dass der zentrale Teil und der umgebende Teil antagonistisch auf Licht reagieren. In Abbildung 8 beispielsweise unterdrückt die Lichteinwirkung auf den peripheren Teil des rezeptiven Feldes (rot) die Lichtreaktion im zentralen Teil des rezeptiven Feldes (blau). Abbildung 8. Schematische Darstellung des rezeptiven Zentrum-Umgebungsfeldes [4] Seit einem halben Jahrhundert wird die klassische Theorie der „lateralen Hemmung“ zur Erklärung der Hermanger-Illusion verwendet. Die sogenannte laterale Hemmung, auch horizontale Hemmung genannt, bedeutet, dass durch Stimulation erregte Neuronen die Aktivität benachbarter Neuronen hemmen. Schauen wir uns genauer an, was bei der Hermanger-Illusion passiert. Abbildung 9 Hermanns Erklärung der lateralen Hemmung | Quelle: michaelbach.de In Abbildung 9 gehen wir davon aus, dass die rote Scheibe das rezeptive Feld einer retinalen Ganglienzelle darstellt. Wenn das rezeptive Feld zufällig auf den Schnittpunkt des Gitters (Mitte der oberen linken Scheibe) fällt, befinden sich darum herum 4 helle Hemmblöcke, wodurch die Mitte dunkel (grau) erscheint. Wenn die Ganglienzelle auf die „Straße“ blickt, sind um sie herum nur zwei Hemmblöcke vorhanden (Mitte der unteren linken Scheibe), sodass sie eine stärkere Stimulation erhält als das Neuron am Schnittpunkt des Kreuzes, was bedeutet, dass es weiß aussieht. Wenn wir jedoch direkt auf das Kreuz schauen, ist das rezeptive Feld sehr klein (die kleine rote Scheibe rechts). Bei so kleinen rezeptiven Feldern spielt es keine Rolle, ob sie sich an der Schnittstelle befinden oder nicht. Allerdings zeigen aktuelle Forschungsergebnisse, dass die oben genannte klassische Erklärung möglicherweise problematisch ist. Wenn Sie die Gitterlinien leicht verdrehen, verschwindet die Illusion (rechte Seite des Bildes unten). Dies deutet darauf hin, dass der visuelle Kortex Informationen mit Richtungsselektivität verarbeitet, auch als neuronale Richtungsselektivität bekannt[5]. Abbildung 10. Das Verschwinden der Hermanger-Illusion | Quelle: Bach, M. Optische Täuschungen, 2006 02 Bewegungsillusion Abbildung 11. Bewegungsillusion | Quelle: Bach, M. Optische Täuschungen, 2006 Manchmal kann es so aussehen, als würde sich ein Standbild in Zeitlupe bewegen, wie im Bild oben, wo die Scheibe sich langsam zu drehen scheint. Die neuronalen Mechanismen der Bewegungsillusion sind noch nicht vollständig verstanden, man kann aber sagen, dass die Voraussetzung für diese Illusion asymmetrische Helligkeitsniveaus sind[6]. Offensichtlich besteht jeder große Kreis in Abbildung 11 aus vielen radialen fächerförmigen Streifen (die Fächer sind sehr schmal). Jeder fächerförmige Balken enthält eine Reihe von Farbsequenzen, und die sich wiederholende Einheit der Farbsequenz in der Abbildung ist „helles Weiß – helles Gelb – dunkles Schwarz – dunkles Blau – helles Weiß“. Abbildung 12. Die in Abbildung 11 enthaltene Farbsequenz Der Schlüssel zur Illusion besteht darin, dass die Positionen der Farb- bzw. Helligkeitsfolgen in benachbarten radialen Sektoren versetzt bzw. versetzt sind [3]. Wenn ein solches Bild plötzlich vor unseren Augen erscheint, lösen die asymmetrischen Helligkeitsstufen die Bewegungsmelder des visuellen Systems aus, sodass es so aussieht, als würde sich das Bild drehen. Durch Gruppieren wird die Illusion verstärkt, Farbe ist jedoch nicht erforderlich. 03 Geometrische und perspektivische Illusionen Abbildung 13. Zöllner-Illusion | Quelle: Bach, M. Optische Täuschungen, 2006 Die Zöllner-Täuschung ist eine weitere häufige optische Täuschung. Im Jahr 1860 entdeckte der deutsche Astrophysiker Johann Karl Friedrich Zöllner, dass parallele Linien, die kurze Linien in spitzen Winkeln schneiden, zu divergieren scheinen. In Abbildung 13 gibt es eine Reihe schräger gerader Linien, die sich mit kurzen Linien überlappen. Es sieht so aus, als ob diese Linien verstreut wären und sich bald kreuzen würden – tatsächlich sind jedoch alle neun „schrägen Geraden“ parallel. Ähnliche Illusionen sind die Poggendorff-Illusion, die Hering-Illusion und die Kombination der Hering- und Zöllner-Illusionen (Abbildung 14). Abbildung 14. Mehrere gängige geometrische und Winkeltäuschungen: (a) Poggendorff-Täuschung; (b) Hering-Illusion; (c) Kombination aus Hering-Illusion und Zorn-Illusion[6] Forscher glauben, dass die Zornas-Illusion auftritt, weil der Winkel zwischen der kurzen und der langen Linie die Tiefenwahrnehmung auslöst. Basierend auf dem perspektivischen Prinzip, dass Dinge aus der Nähe größer und aus der Ferne kleiner erscheinen, vermittelt die durch den Schnittpunkt langer und kurzer Linien angezeigte Richtung den Menschen das Gefühl, als sei sie die „Tiefe“ des Papiers. während die durch die Öffnung des Winkels angezeigte Richtung den Menschen das Gefühl vermittelt, als würde sie auf eine „flache“ Stelle zeigen. Zu diesem Zeitpunkt passt sich unser visuelles System automatisch wieder an – es zieht die beiden nebeneinanderliegenden parallelen langen geraden Linien im „tiefen“ Teil „näher heran“ und schiebt die parallelen schrägen langen geraden Linien im „flacheren“ Teil „weiter weg“ – um die korrekte Wahrnehmung von Dingen zu gewährleisten, die in der Nähe größer und in der Ferne kleiner sind. Tatsächlich sind jedoch alle Linien auf zweidimensionalem Papier gezeichnet und haben keine Tiefe, sodass die langen geraden Linien nicht parallel erscheinen. 04 Größenkonstanzmechanismus Konstanz ist ein inhärenter Mechanismus der menschlichen Gehirnkognition. Je weiter ein Objekt von uns entfernt ist, desto kleiner ist das Bild auf der Netzhaut. Wir glauben jedoch nicht, dass es kleiner geworden ist, nur weil es weiter weg ist. Hier ist der Mechanismus der Größenkonstanz am Werk. Wenn die Entfernung zu einem Objekt halbiert wird, verdoppelt sich die Größe des Objektbildes. Das visuelle System multipliziert die Größe der Projektion auf der Netzhaut mit der angenommenen Entfernung, sodass wir die Größe eines Objekts schätzen können, ohne von der geometrischen Perspektive beeinflusst zu werden. Bei ungültigen Entfernungsangaben setzt sich unser Sehsystem auf die „Standardeinstellungen“ zurück und kann die Größe eines Objekts nicht mehr richtig einschätzen. Beispielsweise die von Fotografen häufig verwendete „Mondtäuschung“: Der Mond erscheint in Horizontnähe größer als hoch am Himmel, weil er zu weit von uns entfernt ist, jenseits der geschätzten Reichweite. Abbildung 15. Müller-Lyer-Illusion | Quelle: Der Wissenschaftler Die Müller-Lyer-Illusion, die 1889 vom deutschen Soziologen Franz Carl Müller-Lyer entdeckt wurde, kann durch visuelle Konstanz erklärt werden. Bei dieser Illusion erkennt das visuelle System Tiefenhinweise – die Richtungen der Pfeile an den Enden der Liniensegmente. „Konvexe Ecke“ bezeichnet einen geringeren Abstand, beispielsweise eine hervorstehende Ecke eines Raumes; Mit „konkaver Ecke“ ist ein größerer Abstand gemeint, beispielsweise die zurückgesetzte Ecke eines Raumes. Das visuelle System glaubt, dass ein nach innen zeigender Pfeil (konkaver Winkel) bedeutet, dass das Liniensegment weiter von uns entfernt ist; Ein nach außen zeigender Pfeil (konvexer Winkel) bedeutet, dass das Liniensegment näher bei uns ist. Als nächstes nimmt der Größenkonstanzmechanismus Korrekturen an dem von uns beobachteten Bild vor: Er vergrößert die Länge der „weiteren“ (Pfeile an beiden Enden zeigen nach innen) Liniensegmente und verringert die Länge der „näheren“ (Pfeile an beiden Enden zeigen nach außen) Liniensegmente, was dazu führt, dass wir die oberen („weiteren“) Liniensegmente als länger wahrnehmen als die unteren („näheren“) Liniensegmente. 05 Gestalteffekt Abbildung 16. Kanisa-Platz[5] Der Kanizsa-Platz wurde erstmals 1955 vom italienischen Psychologen Gaetano Kanizsa beschrieben. Obwohl jeder das Quadrat im Bild wahrnehmen kann, handelt es sich bei seinem Umriss um den vom Betrachter automatisch generierten Umriss des Motivs. Gestaltpsychologen erklären diese Illusion mithilfe des Gesetzes der Geschlossenheit, einem der Gestaltgesetze der Wahrnehmungsorganisation. Nach diesem Gesetz werden gruppierte Objekte tendenziell als Teile eines Ganzen betrachtet. Wir neigen dazu, Lücken zu ignorieren und Konturen wahrzunehmen, die das Bild zusammenfügen. Der Gestaltismus besagt, dass Menschen dazu neigen, Objekte als vollständige Ganze wahrzunehmen, anstatt nur die Lücken zu bemerken, die in ihnen enthalten sein können. Wenn ein Teil eines Bildes fehlt, ergänzt unsere Wahrnehmung den fehlenden Teil automatisch. Untersuchungen legen nahe, dass das Wahrnehmungssystem dies tut, um die Integrität der umgebenden Reize zu erhöhen. Abbildung 17. Der Unmögliche Dreizack, auch bekannt als die „Teufelsgabel“ [1] In Abbildung 17 sieht der obere Teil des linken Bildes wie drei Türme aus. Die Unterseite ist eine gebogene U-förmige Stange. Verbindet man die Linien wie im Bild rechts dargestellt, entsteht das „unmögliche Objekt“. Die Linienverlängerungen sind ungeeignet, da sie den leeren Hintergrund zwischen den Türmen in die U-förmige Bodenfläche verwandeln. Dies hinterlässt beim Betrachter ein unheimliches Gefühl, wo Kunst und Wissenschaft eine Verbindung eingehen: Mauritius Escher malte das berühmte „Auf- und Absteigen“, nur zwei Jahre nachdem Penrose das Gemälde „Die unmögliche Treppe“ veröffentlicht hatte. Können Hunde Illusionen haben? Einige kreative Wissenschaftler haben einige interessante Experimente durchgeführt. Sarah Byosiere von der La Trobe University in Australien zeigte Hunden die Ebbinghaus-Titchener-Illusion. Es handelt sich um eine Illusion relativer Größe, benannt nach dem deutschen Psychologen Hermann Ebbinghaus und dem britischen Psychologen Edward B. Titchener. Abbildung 18. Ebbinghaus-Titchener-Illusion[7] In der klassischsten Version werden zwei gleich große Kreise nahe beieinander platziert, wobei einer von einem größeren Kreis und der andere von einem kleineren Kreis umgeben ist. Wenn die beiden Gruppen nebeneinander platziert werden, nehmen wir wahr, dass der zentrale Kreis, der von den großen Kreisen umgeben ist, kleiner erscheint als die Kreise, die von den kleinen Kreisen umgeben sind. Einer der Hauptgründe für diese Illusion ist der Größenkontrasteffekt zwischen dem zentralen Zielkreis und den umgebenden Induktionskreisen. Welche Konsequenzen hat die Ebbinghaus-Titchener-Illusion für Hunde? Byosiers Gruppe entwarf eine Einrichtung, die es Hunden ermöglicht, ihre Gefühle auszudrücken: einen kleinen Testraum mit einem Touchscreen, der eine Vielzahl unterschiedlicher optischer Täuschungen anzeigt, mit denen die Hunde mithilfe ihrer Nasen interagieren können. Jeder Hund wurde darauf trainiert, den Bildschirm mit der Nase zu berühren, um das Bild auszuwählen, bei dem der mittlere Kreis größer erschien. Abbildung 19. Reaktionen von Testhunden auf die Ebbinghaus-Titchener-Illusion [8] Die experimentellen Ergebnisse zeigen, dass auch Hunde die Ebbinghaus-Titchener-Illusion erleben. Aber! ! ! Doch anders als Menschen, die einen ausgefüllten Kreis, der von kleineren Ringen umgeben ist, als größer wahrnehmen, entscheiden sich Hunde für das genaue Gegenteil. Abbildung 20. Delboeuf-Illusion | Quelle: Der Wissenschaftler Die Delboeuf-Illusion (Abbildung 20) wurde 1865 vom Psychophysiker Joseph Delboeuf erfunden. Zwei schwarze Kreise gleicher Größe sind von Ringen unterschiedlicher Größe umgeben. Normalerweise erscheint dem menschlichen Auge der schwarze Kreis auf der linken Seite etwas kleiner als der auf der rechten. Der Distanzeffekt ist ein wichtiger Faktor bei der Entstehung der Delboeuf-Illusion. Wenn sich der umgebende Induktionsring nahe am zentralen Zielkreis befindet, erscheint der zentrale Zielkreis größer. Bei großer Entfernung erscheint der zentrale Zielkreis kleiner. Infolgedessen überschätzen wir die Größe des mittleren Kreises auf der rechten Seite, da dieser fast die gleiche Größe wie die äußeren Ringe hat, und unterschätzen die Größe des mittleren Kreises auf der linken Seite, da dieser viel kleiner als die äußeren Ringe ist. Wie sieht die Delboeuf-Illusion für einen Hund aus? Christian Agrillo und seine Kollegen an der Universität Padua in Italien versuchten, die Delboeuf-Illusion bei verschiedenen Hunderassen zu testen, indem sie in Kreise gewickeltes Hundefutter verwendeten (siehe Abbildung 21). Abbildung 21. Reaktionen von Testhunden auf die Delboeuf-Illusion[8] In der Agrillo-Gruppe erhielt jeder Hund zwei Teller mit Futter, die einen Meter voneinander entfernt standen. In der Kontrollgruppe wurden die Hunde gebeten, zwischen zwei Tellern gleicher Größe, aber mit unterschiedlichem Inhalt zu wählen; In der Testgruppe wurden die Hunde gebeten, zwischen zwei Tellern mit gleichem Inhalt, aber unterschiedlicher Größe zu wählen. Agrillo geht davon aus, dass die Hunde unabhängig von der Situation den Teil wählen, der ihnen größer erscheint. Wenn die Hunde also auch der Delboeuf-Illusion unterlagen, hätten sie in der Testgruppenbedingung den kleineren Napf wählen müssen, und der Haufen Hundefutter im kleinen Napf wäre größer erschienen. Das haben sie jedoch nicht getan! Im Kontrollexperiment gingen die Hunde tatsächlich zum größeren Teil; Im Testexperiment, als sie zwischen der gleichen Menge Hundefutter auf Tellern unterschiedlicher Größe wählen mussten, „war ihre Leistung im Wesentlichen zufällig.“ Die Forscher sagten jedoch, dass die Ergebnisse nicht ausreichten, um herauszufinden, ob dies bedeutet, dass Hunde nicht anfällig für diese optischen Täuschungen sind oder ob die Testbedingungen einfach nicht geeignet waren, um sie zu erkennen. Es kann auch sein, dass die Hunde im Experiment, da sie unabhängig von ihrer Wahl mit Futter belohnt wurden, keine Motivation hatten, sich für das Futter zu entscheiden, das etwas größer aussah. Allerdings scheinen Hunde und Menschen auf bestimmte Arten optischer Täuschungen, wie beispielsweise die oben erwähnte Müller-Lyer-Täuschung, ähnlich zu reagieren (Abbildung 15). Vor einigen Jahren führten Forscher der University of Lincoln in Großbritannien ein Experiment durch, bei dem sie Hunde mit einem Touchscreen interagieren ließen, auf dem die Müller-Lyer-Illusion angezeigt wurde. Das Team stellte fest, dass Hunde, die darauf trainiert waren, das längere Liniensegment zu wählen, häufig den nach innen zeigenden Pfeil wählten, so wie es Menschen bei der Ausführung derselben Aufgabe tendenziell tun. Dies lässt den Schluss zu, dass Hunde und Menschen diese besondere Illusion auf dieselbe Weise wahrnehmen. Doch zusätzliche Kontrollexperimente und eine detaillierte Analyse der Daten durch die Forscher, die die Studie durchgeführt hatten, legten eine alternative Erklärung für die Ergebnisse nahe: Die Hunde würden den nach innen zeigenden Pfeil nicht aufgrund der wahrgenommenen Länge des Liniensegments wählen; Sie würden den Stimulus wählen, der insgesamt am stärksten wäre. Interessanterweise wurden optische Täuschungen auch bei Fischen untersucht, beispielsweise ihre Reaktion auf die Delboeuf-Illusion. Die Wahrnehmung dieser Illusion durch den Fisch dürfte von der Fischart abhängen. Eine Studie zeigt, dass Riffbarsche auf die Delboeuf-Illusion ähnlich reagieren wie Menschen und Delfine, während Guppys genau umgekehrt reagieren. Bambushaie treffen normalerweise keine Entscheidungen, die deutlich über dem Zufall liegen.[9] Zurück zur eigentlichen Frage: Warum kümmern sich Menschen nicht nur um ihre eigenen Illusionen, sondern auch um die Illusionen anderer Tiere? Das Wesentliche bleibt unverändert und letztendlich müssen wir immer noch Fragen zum menschlichen Gehirn beantworten. In Fällen, in denen Hunde und Menschen unterschiedliche Reaktionen zeigten, wählten die Hunde den entgegengesetzten Reiz als die Menschen oder zeigten überhaupt keine Sensibilität. Dies könnte daran liegen, dass das visuelle System des Hundes auf verschiedene Arten visueller Reize unterschiedlich reagiert. Der Mensch ist besonders gut darin, globale Muster in Bildern wahrzunehmen, die aus kleinen Elementen bestehen. Im Gegensatz dazu neigen Hunde möglicherweise eher dazu, lokale Reize in diesen Bildern wahrzunehmen. Dies könnte erklären, warum Hunde auf die Ebbinghaus-Titchener- und Delboeuf-Illusionen anders reagieren als Menschen – beide Illusionen erfordern eine Wahrnehmung auf globaler Ebene, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Dieser Unterschied zwischen den Arten könnte auf unterschiedliche Evolutionsdrücke bei Hunden und Menschen zurückzuführen sein. Um sich an ihre spezifische Umgebung anzupassen, haben verschiedene Arten unterschiedliche physiologische Eigenschaften und Funktionen entwickelt. Wenn die gleiche Information in das visuelle System gelangt, kann es sein, dass verschiedene Spezies sie unterschiedlich verarbeiten und interpretieren [10]. In der wissenschaftlichen Literatur gibt es derzeit einige Hinweise darauf, dass Hunde nicht die gleiche starke Präferenz für globale Reize haben wie Menschen. Allerdings gibt es nur wenige Studien zu diesem Thema [11]. Chouinard weist auf eine andere Möglichkeit hin, den Unterschied in der Wahrnehmung zwischen Hunden und Menschen zu verstehen: das Ausmaß, in dem ein Tier ähnliche Reize als identisch wahrnimmt, anstatt subtile Unterschiede zwischen ihnen zu bemerken. Die Studie ergab, dass Hunde Unterschiede zwischen ähnlichen Reizen weniger wahrscheinlich wahrnehmen als Menschen. 06 Zukunft Viele Illusionen sind noch immer nicht vollständig verstanden, aber sie stellen eine wertvolle Ressource für spätere Experimente und technologische Entwicklungen dar. Mittlerweile gibt es einige Spitzentechnologien, die ausgefeiltere technische Mittel nutzen, um das menschliche Gehirn zu messen und die inneren Mechanismen der Illusionsbildung aus der Perspektive der kognitiven Neurowissenschaft zu erforschen. Den Unterschied zwischen Wahrnehmung und Wirklichkeit lehrte uns bereits Platon in seinem Höhlengleichnis. Es besteht eine gute Chance, dass wir nie in der Lage sein werden, uns umzudrehen und die wahre Realität zu erkennen, aber wir können unser Bestes tun, um sie zu verstehen. Glücklicherweise können wir die Geheimnisse des Sehens durch Illusionen verstehen und die künstlerische Schönheit, die sie uns bringen, wertschätzen und genießen. Verweise [1] Bach, M. Optische Täuschungen, 2006 [2] MVC Baldo, RD Ranvaud und E. Morya, „Flaggenfehler in Fußballspielen: Der Flash-Lag-Effekt in die Realität umgesetzt“, Perception, Bd. 31, Nr. 10, Art. NEIN. 10. 2002. [3] https://en.wikipedia.org/wiki/Pareidolia [4] Mark F. Bea, Barry W. Connors, Michael A. Paradiso, übersetzt von Wang Jianjun. Neurowissenschaften: Erforschung des Gehirns. Hochschulpresse. 2004 [5] DM Eagleman, „Visuelle Illusionen und Neurobiologie“, Nature Reviews Neuroscience, Bd. 2, nein. 12, Art. NEIN. 12, 2001. [6] https://michaelbach.de/ot/ [7] B. Roberts, MG Harris und TA Yates, „Die Rolle von Induktorgröße und -entfernung in der Ebbinghaus-Illusion (Titchener-Kreise)“, Perception, Bd. 34, Nr. 7, Art. NEIN. 7, 2005. [8] https://www.the-scientist.com/infographics/infographic-what-do-dogs-perceive-68288 [9] https://www.verywellmind.com/optical-illusions-4020333 [10] S.-E. Byosiere, PA Chouinard, TJ Howell und PC Bennett, „Was sehen Hunde (Canis familiaris)? Eine Untersuchung des Sehvermögens von Hunden und Auswirkungen auf die Kognitionsforschung“, Psychonomic Bulletin & Review, Bd. 25, Nr. 5, Art. NEIN. 5, 2018. [11] E. Pitteri, P. Mongillo, P. Carnier und L. Marinelli, „Hierarchische Reizverarbeitung durch Hunde (Canis Familiaris)“, Animal Cognition, vol. 17, Nr. 4, Art. NEIN. 4, 2014. |
>>: Quanteninterferenz erleichtert das Zählen von Sternen
Artikel empfehlen
Was ist die Ab-Wheel-Übung?
Das Bauchmuskelrad ist ein Gerät, das beim Traini...
Die globale Erwärmung verlangsamt die Erdrotation! Auch unsere Zeit wird sich dadurch ändern...|Environmental Trumpet
Hallo zusammen, dies ist die 8. Ausgabe der Kolum...
So trainieren Sie die Po-Muskeln
Im Laufe der Jahre ist Fitness für viele junge Me...
Ginkgo ist so weit verbreitet, warum ist er eine gefährdete Pflanze?
Im Spätherbst und Frühwinter gibt es immer einen ...
Weibo: Xiaomi gehört im ersten Halbjahr 2024 zu den zehn meistgesuchten Marken der Automobilindustrie, weit vor Tesla
Kürzlich hat der offizielle Weibo Hot Search-Acco...
Was sollten Sie vor dem Schwimmen beachten?
Schwimmen ist eine Fitnessübung, die viele Mensch...
Schuppen und Haarausfall, was ist mit unserer Kopfhaut los?
Ich weiß nicht, ob Sie, die Sie jeden Tag beschäf...
Welche Sportarten sind körperlich am anstrengendsten?
Viele männliche Freunde möchten einen muskulösen ...
Wie hoch muss ein Flugzeug fliegen, um nicht mehr von der Erdanziehungskraft beeinflusst zu werden? Wie kann es der Schwerkraft der Erde entkommen?
Die Menschen sind voller Fantasien über das Flieg...
So reduzieren Sie Bauchfett durch Training
Wenn wir arbeiten, müssen wir sowohl geistig als ...
Einfache Fitness-Gymnastik
Viele Menschen möchten Sport treiben, aber weil s...
Kann ich nach dem Laufen Wasser trinken?
Manche Leute sagen, dass wir nach dem Laufen kein...
So trainieren Sie die oberen Gliedmaßen effektiv mit Hanteln
Viele Menschen greifen beim Training auf Hanteln ...
So erstellen Sie den Trainingsplan für Bodybuilding mit Geräten
Heutzutage ist Fitness mit der Entstehung von Fit...
Was ist der effektivste Weg, um an Beinen schlanker zu werden?
Die Beine vieler Menschen sehen nicht besonders g...