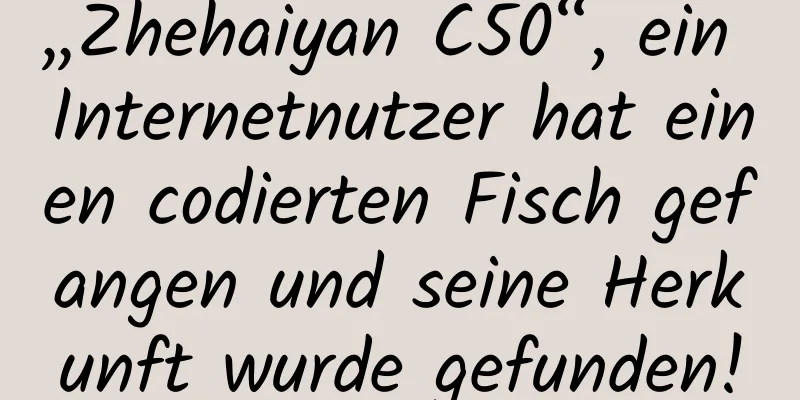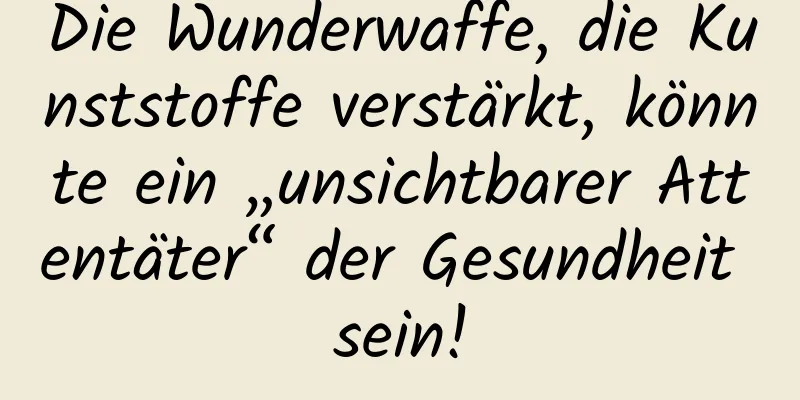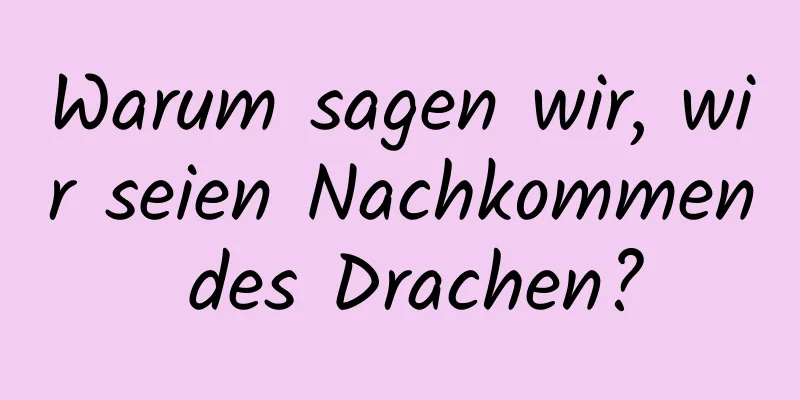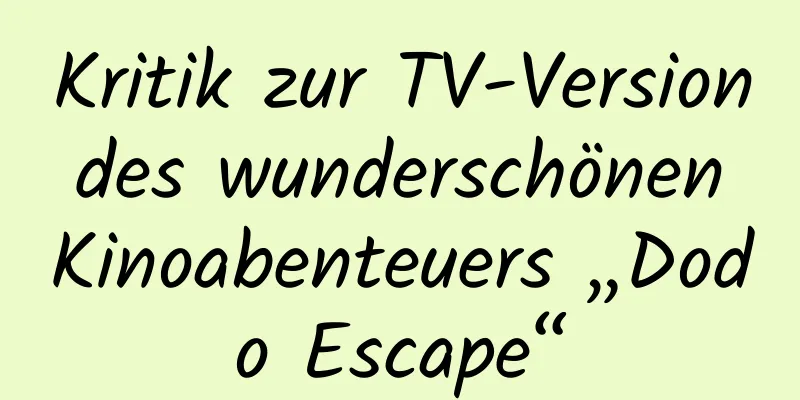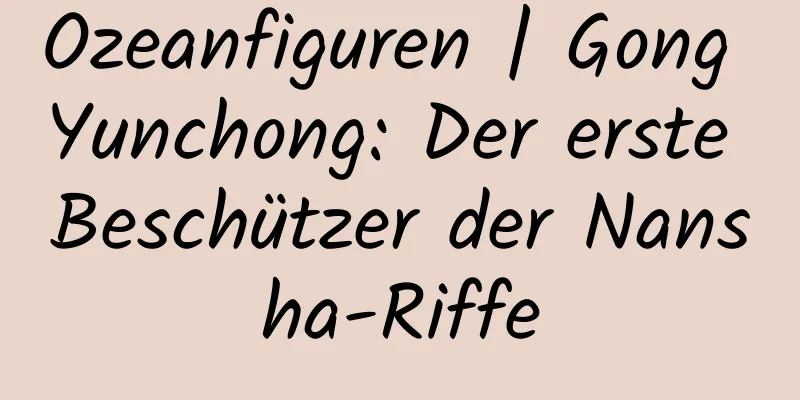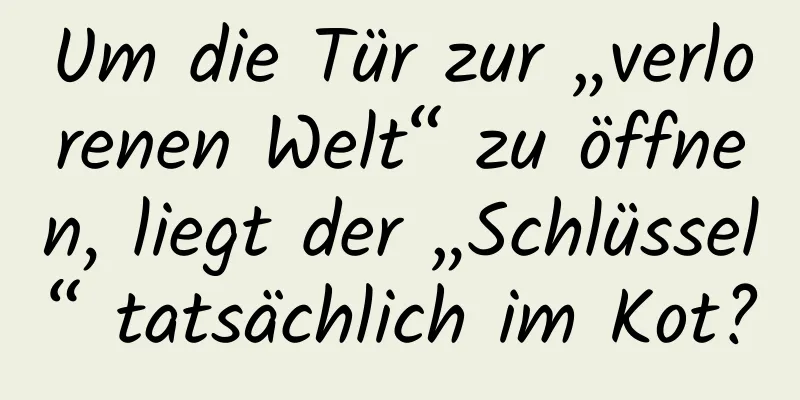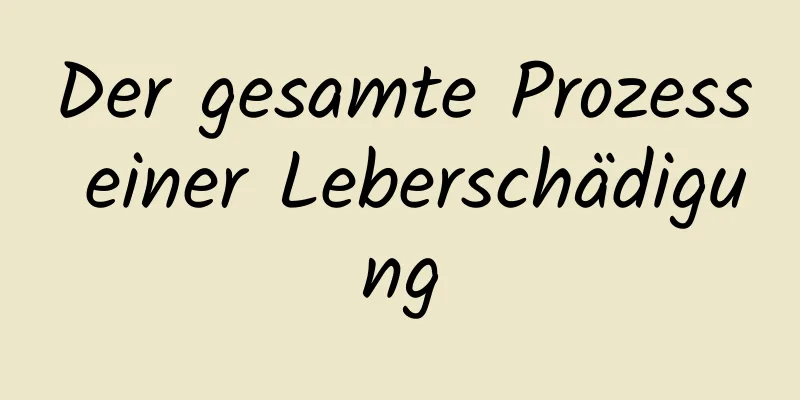„Angriff des Heliumkerns“: Neue Herausforderungen für die Niederenergie-Kerntheorie
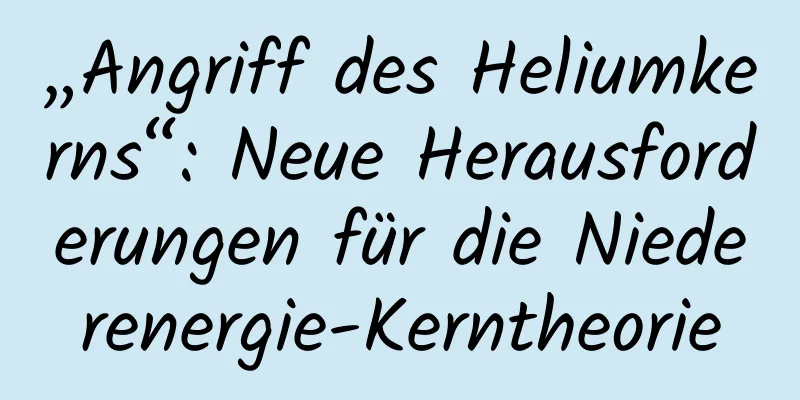
|
Der Heliumkern (Alphateilchen) ist einer der den Physikern bekanntesten Kerne. Die Existenz des Atomkerns bewiesen Physiker zunächst durch Streuexperimente mit Alphateilchen. Wir verstehen es jedoch immer noch nicht vollständig. In einem kürzlich durchgeführten Streuexperiment mit Elektronen und Heliumkernen stellten Forscher fest, dass der elektrische Formfaktor des ersten angeregten Zustands von Heliumkernen stark von den theoretischen Vorhersagen abwich. Geschrieben von Jiang Lijia (Fakultät für Physik, Northwestern University) Kürzlich haben Wissenschaftler den Formfaktor des monopolaren Übergangs von Heliumkernen vom Grundzustand in den ersten angeregten Zustand durch inelastische Streuung von Elektronen und Heliumkernen am Mainz Microbeam Accelerator (MAMI) gemessen. Als Wissenschaftler jedoch versuchten, diese scheinbar einfache experimentelle Messung mithilfe der äußerst erfolgreichen chiralen Effekttheorie in der Kernphysik zu beschreiben, trat eine große Abweichung auf. Warum tritt dieses Problem auf? Liegt es an einem theoretischen oder experimentellen Fehler? Resonanzzustand: angeregter Zustand eines Atomkerns Im Atomkern gibt es zwei Arten von Nukleonen: Protonen und Neutronen. Zwischen den Nukleonen besteht eine starke Wechselwirkung. Ähnlich wie elektronische Energieniveaus haben auch Atomkerne unterschiedliche Energieniveaus. Durch die Aufnahme oder Abgabe einer bestimmten Energiemenge (in Form von Photonen oder anderen Teilchen) können Atomkerne Übergänge zwischen verschiedenen Energieniveaus erreichen. Einer der Übergangstypen ist der monopolare Übergang. Dabei handelt es sich um einen Übergang, bei dem die Quantenzahl des Atomkerns unverändert bleibt, sich jedoch die Ladungsverteilung ändert. Der Heliumkern, auch Alphateilchen genannt, besteht aus zwei Protonen und zwei Neutronen und ist einer der am besten untersuchten Atomkerne. Wie in Abbildung 1 gezeigt, gelangen die Heliumkerne während des inelastischen Streuprozesses von Elektronenkollisionen mit Heliumkernen auf MAMI vom Grundzustandsmonopol zur Spaltschwelle (19,8 MeV). Intuitiv erscheint diese Art von angeregtem Zustand, der auch jenseits der Spaltungsschwelle noch existiert, etwas seltsam, aber in der Kernphysik kommt er sehr häufig vor – er wird oft als Resonanzzustand bezeichnet. Die Untersuchung der Resonanzzustände, die durch diese Art von monopolarem Übergang erzeugt werden, ist für das Verständnis des Atomkerns von außerordentlicher Bedeutung. Einerseits stellt sich die Frage, ob sich ein solcher Anregungszustand von Heliumkernen theoretisch erklären lässt: Handelt es sich um den kollektiven Anregungszustand eines vierkernigen Subsystems? Oder handelt es sich um einen quasimolekularen Zustand, der aus Protonen und Wasserstoff-3-Kernen besteht? Dies ist derzeit noch unbekannt. Gleichzeitig kann die Messung des Resonanzzustands selbst als „Lupe“ dienen, um den Atomkern zu erforschen und festzustellen, ob einige theoretisch „schwache“ Wechselwirkungen (Terme höherer Ordnung in der Störungstheorie) tatsächlich ignoriert werden können. Andererseits kann durch die Messung der durch monopolare Übergänge erzeugten angeregten Zustände auch ein wichtiger Parameter der Zustandsgleichung der Kernphysik extrahiert werden – die Inkompressibilität (d. h. die Starrheit von Kernmaterie bei Dichteänderungen), was den Wissenschaftlern dabei helfen wird, neue Phänomene wie die Verschmelzung von Neutronensternen besser zu erforschen. Eine effektive Theorie zur Beschreibung der Kernkräfte Die Wechselwirkung zwischen Nukleonen wird von starken Wechselwirkungen dominiert, die im Prinzip durch die Quantenchromodynamik (QCD) beschrieben werden können. Im niedrigen Energiebereich, in dem die Bindungsenergie der Nukleonen liegt (etwa einige zehn MeV), ist die QCD jedoch nicht-perturbativ und lässt sich nur schwer zur Erklärung nuklearer Phänomene verwenden. Wie lässt sich die QCD-Theorie auf Kernsysteme anwenden? Die Einführung des Konzepts der chiralen effektiven Feldtheorie (χEFT) ist ein großer Durchbruch auf dem Gebiet der Niederenergie-Kernphysik. S. Weinberg entwickelte 1990 erstmals den theoretischen Rahmen von χEFT. Bei niedrigen Energien sind Quarks in Nukleonen eingeschlossen und die einzigen effektiven Freiheitsgrade des Systems sind Mesonen und Hadronen, wobei Mesonen die Wechselwirkungen zwischen Nukleonen vermitteln. Darauf aufbauend können effektive Hamiltonoperatoren und Interaktionspotentiale konstruiert werden. Derzeit wird χEFT erfolgreich und umfassend auf verschiedene Kernsysteme angewendet, darunter auch auf Systeme mit zwei Kernen (NN), drei Kernen (3N) und sogar mehr Nukleonen. Elektrischer Formfaktor Im Rahmen von χEFT kann die Grundzustandsenergie eines Heliumkerns mit vier Nukleonen sehr genau berechnet werden. Allerdings reagiert die Grundzustandsenergie nicht sehr empfindlich auf die Einzelheiten der Nukleonenwechselwirkungen. Um einen strengeren Test des theoretisch konstruierten nuklearen Hamiltonoperators durchzuführen, Neues Experiment ermöglicht höhere Präzision Die Größe des Formfaktors. Da sich die theoretischen Berechnungen damals auf gebundene Zustände beschränkten, konnte der Formfaktor nicht gut berechnet werden. Um das Jahr 2013 herum wurde schließlich eine Technologie entwickelt, die Kontinuumseffekte theoretisch berücksichtigen konnte. Dabei stellte sich heraus, dass sich die auf χEFT und phänomenologischen Modellen basierenden Berechnungen stark von den experimentellen Daten unterschieden. Aufgrund der geringen Genauigkeit früher experimenteller Daten und der großen Fehlerspanne können jedoch keine eindeutigen Schlussfolgerungen daraus gezogen werden. Wir haben den Hintergrundbeitrag, der durch die Elektronenstreuung an den Aluminiumkammerwänden entsteht, sorgfältig berücksichtigt. Um diesen Hintergrund zu entfernen, reduzierten sie die Heliumdichte in der Reaktionskammer auf ein extrem niedriges Niveau und führten separate Messungen durch. Durch diese Behandlung wurden die Fehlerbalken erheblich reduziert. Wie in Abbildung 2 gezeigt, stimmen die neuen hochpräzisen Formfaktordaten grundsätzlich mit früheren experimentellen Daten überein, während die Vorhersagen der aktuellen Theorien der Niederenergie-Kernphysik (dargestellt durch χEFT) die experimentellen Daten nicht quantitativ erklären können, obwohl sie den experimentellen Daten im Trend ähneln. Insbesondere sind die mit χEFT berechneten Ergebnisse fast doppelt so hoch wie die experimentellen Daten. Angesichts der Tatsache, dass die experimentellen Messfehler sehr gut kontrolliert werden können, lässt die Inkonsistenz zwischen theoretischen Berechnungen und experimentellen Daten darauf schließen, dass einige scheinbar schwache Beiträge der Nukleonenwechselwirkungen im monopolaren Übergangsprozess bei der Beschreibung angeregter Kernzustände verstärkt werden könnten. oder für χEFT, obwohl es bis NNNLO entwickelt wurde, um den ersten angeregten Zustand von α-Teilchen zu erklären, Die Anregungsenergie des Zustands (20,2 MeV) hängt eng mit der Zweikörperspaltungsschwelle von Heliumkernen (19,8 MeV) zusammen. Was auch immer der Grund ist, es ist sehr interessant und regt zu weiteren Forschungen an. Verweise [1] S. Bacca et al., „Isoskalare Monopolresonanz des Alphateilchens: Ein Prisma für nukleare Hamiltonoperatoren“, Phys. Ehrw. Lett. 110, 042503 (2013). [2] S. Kegel et al., "Die Messung des Formfaktors des -Teilchen-Monopolübergangs stellt die Theorie in Frage: Ein Niedrigenergie-Puzzle für Kernkräfte?" Phys. Ehrw. Lett. 130, 152502 (2023). [3] http://physics.aps.org/articles/v16/58#c1 Dieser Artikel wird vom Science Popularization China Starry Sky Project unterstützt Produziert von: Chinesische Vereinigung für Wissenschaft und Technologie, Abteilung für Wissenschaftspopularisierung Hersteller: China Science and Technology Press Co., Ltd., Beijing Zhongke Xinghe Culture Media Co., Ltd. |
<<: Ich, eine Eule, ein Raubvogel!
Artikel empfehlen
US-Gericht entscheidet, dass Qualcomm Patente an Konkurrenten lizenzieren muss
Ausländische Medien berichteten, ein US-Bundesric...
Wie trainiert man Muskeln am besten?
Muskeltraining ist für viele Menschen schon seit ...
Hat Muskelaufbau Auswirkungen auf das Höhenwachstum?
Es ist der Traum aller Eltern, dass ihre Kinder e...
Wie können Männer effektiv Muskeln aufbauen?
Ob die Muskeln gut entwickelt sind, ist der Schlü...
Warum bringt Windows Microsoft immer weniger Geld ein?
Das Windows -Betriebssystem war schon immer eine ...
Berichten zufolge haben einige iPhone 6-Hüllen die Apple-Inspektion nicht bestanden, was sich auf die Auslieferung auswirken kann
Laut der taiwanesischen Economic Daily News gab es...
Wissenschaftler lüften das Geheimnis der Seeotter! Warum werden die Zähne von Seeottern durch das Fressen nicht beschädigt?
Produziert von: Science Popularization China Auto...
Es gibt ein Longquanyi in Chengdu
Wenn es um Sehenswürdigkeiten in Chengdu geht, ko...
Das „Baby des Jahrhunderts“ ist gestorben. Warum sind junge und mittelalte Menschen vom plötzlichen Herztod betroffen?
Am 24. März veröffentlichte die Mutter des „Babys...
Was bedeutet „nüchterner Magen“ bei einer Blutabnahme auf nüchternen Magen?
Die Blutentnahme im nüchternen Zustand ist eine g...
Was sind die Hauptvorteile der Yoga-Praxis?
Viele Mädchen machen gerne Yoga, weil sie dadurch...
Können Sie den Untersuchungsbericht wirklich verstehen? Abnorme Blutfettwerte deuten tatsächlich darauf hin!
In der heutigen schnelllebigen Zeit, in der es ne...
Die starken Regenfälle und Überschwemmungen im Norden hängen tatsächlich mit dem Ausbruch des Tonga-Vulkans im letzten Jahr zusammen?
Letzte Woche erregten Überschwemmungen in Nordchi...
In der Verwirrung Unsinn reden: Ist das eine „mysteriöse Vorstellung“ im Gehirntheater?
Prüfungsexperte: Chen Mingxin Nationaler psycholo...
Welches hat die beste optische Bildstabilisierung? iPhone 6 Plus vs. Note 4
Optische Bildstabilisierung ist heute bei Smartph...