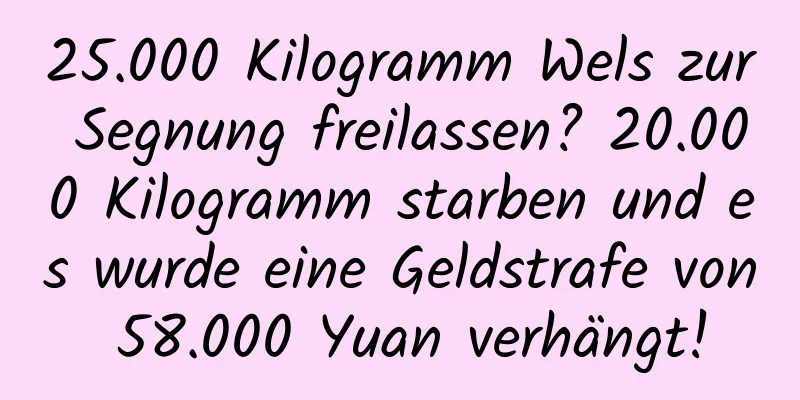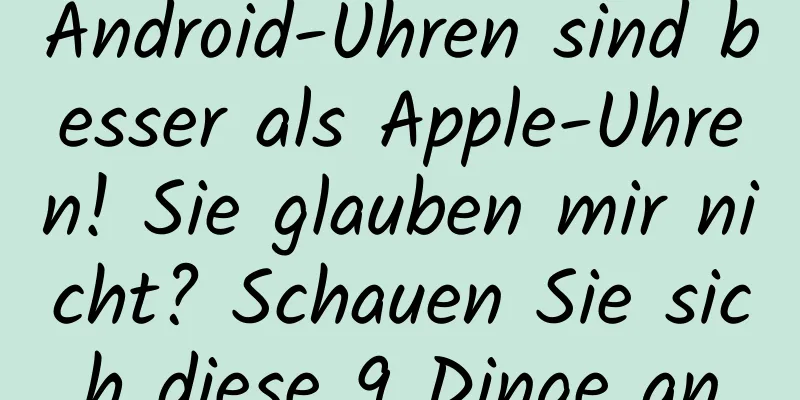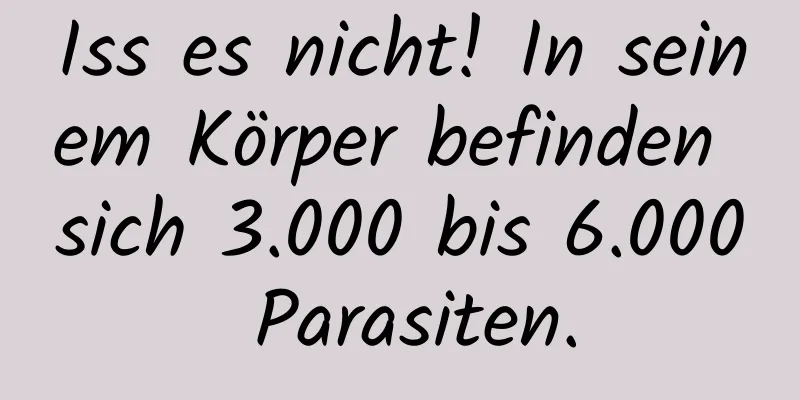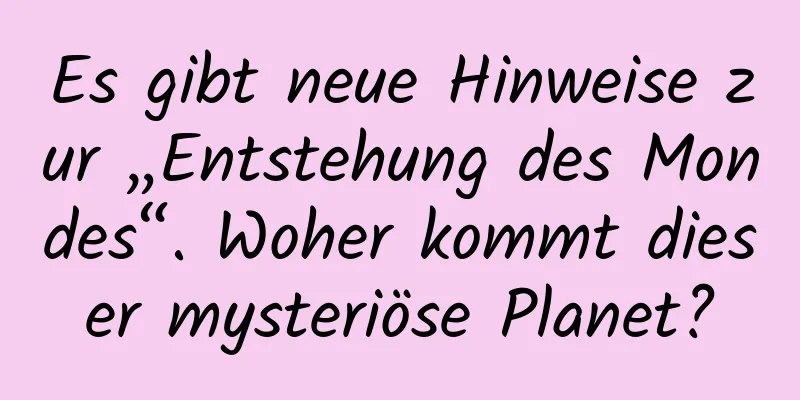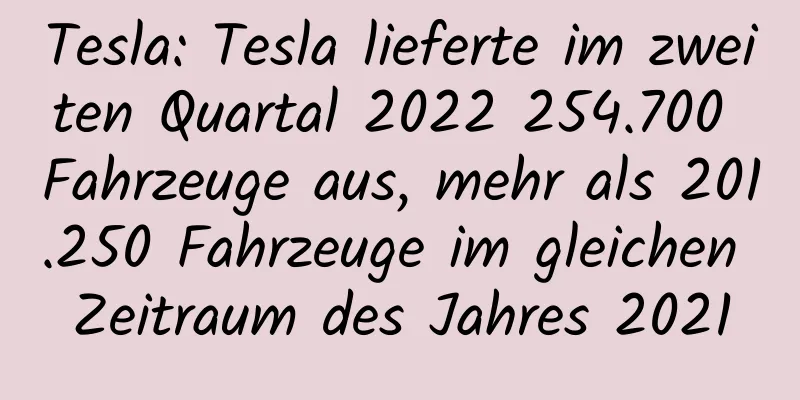Hier ist eine Wette: Sie können nicht gleichzeitig einatmen und sprechen!
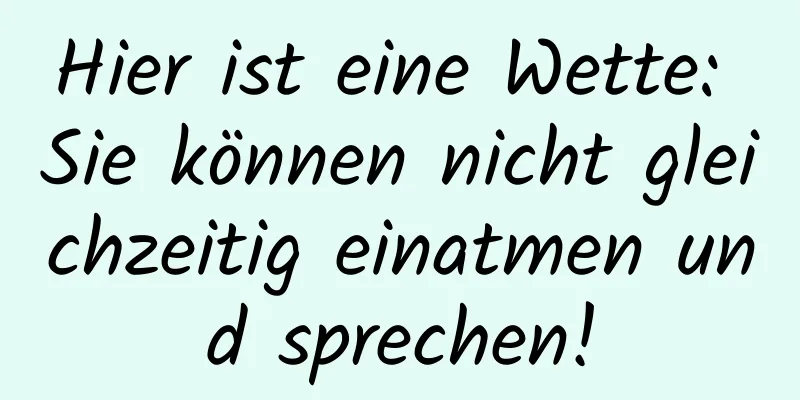
|
Herausforderung! Versuchen Sie es bitte: Atmen Sie ein und sprechen Sie gleichzeitig. Plaudern, Summen, Schreien(?) – diese stimmlichen Verhaltensweisen führen wir fast täglich aus. Natürlich halten wir es für selbstverständlich, unsere Meinung zu äußern und „denken“, wir könnten jederzeit unsere Meinung sagen. Doch ein einfaches kleines Experiment zeigt uns: Zumindest wenn wir einatmen, können wir nicht sprechen. Manchmal werden Sie feststellen, dass manche Leute so begeistert davon sind, zu reden, dass sie gar nicht anders können, als ununterbrochen zu reden, und es scheint, als könne sie niemand unterbrechen. Da Atmung und Lautäußerung nicht gleichzeitig möglich sind, werden sie sich wahrscheinlich zu Tode reden, wenn sie wirklich nicht aufhören können zu reden. Glücklicherweise haben wir noch nie von einem so humorvollen und erschreckenden Vorfall gehört. Schließlich steht für den menschlichen Körper immer ein Grundbedürfnis im Vordergrund: das Überleben. Wenn Sie merken, dass Ihnen bald Sauerstoff fehlt, zwingt Ihr Gehirn Sie, mit dem Sprechen aufzuhören und schnell zu atmen. Schließlich hat das Überleben oberste Priorität. Stimmgebung und Atmung sind eng miteinander verbunden. Es scheint, als würden wir beim Ausatmen immer reden und beim Einatmen aufhören zu reden. Denn für die Stimmbildung ist das Ausstoßen von Luft aus der Lunge erforderlich, die durch den Kehlkopf strömt und die Stimmbänder zum Schwingen bringt, um einen Ton zu erzeugen. Der Schlüssel liegt hier in der Luftströmung und der Stimmbandvibration. Wenn man jedoch genau darüber nachdenkt, führt das Einatmen offensichtlich auch dazu, dass Luft durch den Rachen strömt. Warum kann also der umgekehrte Vorgang nicht die Stimmbänder zum Vibrieren bringen? Warum können wir nicht beim Einatmen sprechen und gleichzeitig die ganze Zeit plappern? Warum „reden wir nicht mit dem Tod“? Zart und komplex Um die ersten beiden Fragen zu verstehen, müssen wir den Prozess der Vokalisierung genauer verstehen. Obwohl die Komplexität des Stimmsystems von Art zu Art unterschiedlich ist, sind die grundlegenden Prozesse der Lauterzeugung ähnlich. Wie bereits erwähnt, erfordert die Stimmgebung einen Luftstrom und eine Vibration der Stimmbänder, die eng mit dem Kehlkopf verbunden sind. Bildquelle: Wikipedia Der Kehlkopf ist ein uraltes Organ. Als die Fische aus dem Meer an Land krochen und sich zu verschiedenen Tieren entwickelten, bestand ein wichtiges Problem in diesem Prozess darin, dass sie die Luft, die sie atmeten, von der Nahrung, die sie zu sich nahmen, trennen mussten. Der Kehlkopf fungiert als „Vorraum“ der Luftröhre. Darin befindet sich eine Knorpelschicht namens Epiglottis, die verhindert, dass Nahrung oder Flüssigkeit in die Luftröhre gelangen und zum Ersticken führen. Unterhalb der Epiglottis haben sich bei Säugetieren zusätzliche Gewebefalten entwickelt, die die für unsere Lautäußerungen notwendigen Stimmbänder bilden. Um die Stimmbänder zum Schwingen zu bringen, ist in der Regel eine Kontraktion des Kehlkopfes und ein Zurückziehen der Stimmbänder erforderlich, damit der hindurchströmende Luftstrom die Stimmlippen zum Schwingen anregen kann. Wenn Sie es bewusst spüren, werden Sie vielleicht feststellen, dass der Ton, den Sie erzeugen, wenn Sie Ihre Kehle zusammendrücken, normalerweise hoch ist, während Sie einen tiefen Ton erzeugen können, wenn Sie versuchen, Ihre Kehle zu weiten. Bei diesem Vorgang werden die Stimmbänder tatsächlich angespannt oder entspannt, wodurch die Frequenz der Stimmbandschwingung angepasst wird. Wenn wir jedoch versuchen einzuatmen, muss der Kehlkopf geöffnet werden, um eine effiziente Einatmung zu gewährleisten. Das bedeutet, dass die Stimmbänder abduziert werden müssen, was es natürlich unmöglich macht, die Stimmbänder zum Vibrieren zu bringen und Töne zu erzeugen. Dies geschieht natürlich unter der Prämisse einer natürlichen Entspannung, bei der wir beim Einatmen keine Stagnation spüren. Wenn Sie jedoch bewusst Ihre Kehle zusammenziehen und gleichzeitig einatmen, können Sie zwar Ausrufe wie „Schock mich!“ von sich geben, aber das Einatmen wird Ihnen schwerfallen. Bildquelle: Wikipedia Die komplexe und feine Koordination der Stimmbänder und der Atmung ermöglicht es Tieren, Geräusche zu erzeugen und miteinander zu kommunizieren. Doch die Wissenschaftler fragen sich noch immer, warum bei Lebensgefahr immer dann die Lautäußerungen durch Atmen ersetzt werden. Wie kann sichergestellt werden, dass die Atmung Vorrang vor der Stimmäußerung hat? Der Manipulator dominanten Verhaltens Alle Verhaltensweisen werden durch neuronale Schaltkreise reguliert. Beispielsweise wird der Verschluss oder die Abduktion der Stimmbänder durch motorische Neuronen des Kehlkopfes gesteuert, während die Atembewegungen durch einen komplexen Atmungskreislauf gesteuert werden. Es besteht offensichtlich ein neuronaler Kreislauf zwischen Kehlkopfbewegung und Atmung, der den flexiblen Wechsel zwischen beiden nahtlos und reibungslos regeln und die Priorität des Atemkreislaufs sicherstellen kann. Um die „Manipulatoren“ hinter diesem dominanten Verhalten zu erforschen, begann ein Forschungsteam des Massachusetts Institute of Technology mit der Verwendung von Mausmodellen, um die Neuronen zu identifizieren, die die Stimmbandadduktion steuern, und zu erforschen, wie diese Neuronen mit dem Atmungskreislauf interagieren. Mäuse müssen auch ausatmen, um Laute von sich zu geben, wodurch Luft durch ihre fast geschlossenen Stimmbänder strömen kann. Durch die Adduktion der Stimmbänder entsteht in der Mitte ein sehr kleines Loch. Wenn Luft durch das Loch strömt, können Mäuse Ultraschallwellen aussenden, ähnlich wie beim Pfeifen, um miteinander zu kommunizieren. Dieser Vorgang wird auch als Ultraschallvokalisation (USV) bezeichnet. Die Forscher wussten, dass die Stimmbandadduktion durch motorische Neuronen des Kehlkopfes gesteuert wird. Daher verwendeten sie neuronale Tracer, um die synaptischen Verbindungen zwischen den Neuronen abzubilden und begannen mit der Rückverfolgung zu den Neuronen, die sie innervieren. Nach der Beobachtung stellten die Forscher fest, dass im Hinterhirn eine Gruppe von Motoneuronen im Nucleus retroambiguus (RAm, der in früheren Studien mit der Lautäußerung in Verbindung gebracht wurde) bei USV bei Mäusen stark aktiviert wurde. Letztendlich konzentrierten sich die Forscher auf eine Untergruppe klangspezifischer Neuronen im RAm, genannt RAmVOC. Bildquelle: Originalarbeit Als die Forscher die RAmVOC-Neuronen blockierten, konnten die Mäuse keine USVs oder andere Arten von Geräuschen mehr erzeugen. Ihre Stimmbänder schlossen sich nicht und ihre Bauchmuskeln zogen sich nicht zusammen. Umgekehrt konnten sich bei Aktivierung der RAmVOC-Neuronen die Stimmbänder der Mäuse schließen, USVs produzieren und gleichzeitig ausatmen. Und je länger die Aktivierungszeit, desto länger ist auch die Ausatmungs- und Lautäußerungszeit. Wenn RAmVOC-Neuronen jedoch zwei Sekunden oder länger stimuliert wurden, wurden die USVs durch die Inspiration unterbrochen. Während einer längeren RAmVOC-Aktivierung unterbrachen die Mäuse ihre Lautäußerungen regelmäßig, um einzuatmen. Die Anforderungen der Atmung übertrafen offenbar die Stimulation, die die Forscher auf die RAmVOC-Neuronen ausübten. Um den wahren Übeltäter im Hintergrund zu finden, kartierte das Forschungsteam die Neuronen, die hemmende Signale an RAmVOC-Neuronen senden. Dabei stellten sie fest, dass die hemmenden Signale größtenteils aus einem Teil des Hirnstamms stammten, der den Atemrhythmus steuert, dem sogenannten preBötC. Bildquelle: Originalarbeit Als die Forscher die Verbindung zwischen preBötC und RAmVOC blockierten, fiel es den Mäusen schwerer, ihre Lautäußerungen zum Atmen zu unterbrechen. Die Atmung der Mäuse war viel flacher als normal. Die Mäuse gaben beim Einatmen außerdem ein heiseres, asthmaähnliches Geräusch von sich. Die Studie zeigte, dass RAmVOC-Neuronen die Adduktion der Stimmbänder zur Tonerzeugung steuern, aber regelmäßig durch preBötC gehemmt werden, um eine gleichmäßige Atmung zu gewährleisten. Diese Studie enthüllte die neuronalen Schaltkreise hinter den koordinierten Bewegungen der Atmung und Stimmgebung und wurde im März dieses Jahres in Science veröffentlicht. Wenn wir auf die Evolution des Menschen zurückblicken, veränderte sich die Form unserer Stimmorgane, nachdem wir uns von unseren frühen Affenvorfahren abgespalten hatten. Unsere Münder wurden kleiner und standen weniger hervor, und unsere Zungen bewegten sich nach unten, wodurch unsere Kehlen tiefer zogen und unsere Hälse länger wurden. Diese Veränderungen ermöglichen es dem Menschen, eine Vielzahl winziger Muskeln mit unglaublicher Präzision zu steuern und komplexe Laute zu erzeugen, die andere Tiere nicht erreichen können. Doch mit Chancen sind auch immer Risiken verbunden. Da der Kehlkopf abgesenkt ist, muss die gesamte Nahrung, die wir zu uns nehmen, durch den Kehlkopf, die Luftröhre umgehen und dann in die Speiseröhre gelangen. Die Gefahr besteht darin, dass es zu Erstickungsanfällen kommen kann, wenn die Nahrung an die falsche Stelle gelangt. Es scheint, dass diese Strukturen, die unsere Fähigkeit zur Lautäußerung verbessern, tatsächlich dazu führen, dass wir „effizienter“ ersticken. Um diese Art von „Effizienz“ zu vermeiden, beachten Sie bitte auch Folgendes: Vermeiden Sie eifriges Essen und Trinken während des Sprechens, da dies die Erstickungsgefahr erheblich erhöht; oder zu lange weitersprechen, was ebenfalls zu einer Ermüdung des Halses und zum Ersticken führen kann. Verweise [1]https://www.science.org/doi/10.1126/science.adi8081 [2]https://news.mit.edu/2024/how-brain-coordinates-speaking-and-breathing-0307 [3]https://www.nih.gov/news-events/nih-research-matters/coordinating-speech-breathing-brain [4]https://www.smithsonianmag.com/smart-news/scientists-discover-how-some-whales-can-sing-while-holding-their-breath-underwater-180983836/ [5]https://www.npr.org/2010/08/11/129083762/from-grunting-to-gabbing-why-humans-can-talk [6]https://www.nature.com/articles/s41586-024-07080-1 Planung und Produktion Quelle: Global Science (id: huanqiukexue) Autor | Bu Zhou Herausgeber: Yang Yaping Korrekturgelesen von Xu Lailinlin |
Artikel empfehlen
Wenn Sie Tee nicht richtig trinken, schadet das Ihrem Körper! Diese 3 Menschentypen sollten weniger trinken
Die Gewohnheit, Tee zu trinken Es scheint in die ...
Kugelschreiber wird zum magischen Werkzeug: Er kann heimlich Bilder von Damenröcken machen
Laut der Shenyang Evening News deckte CCTV kürzlic...
Wenn die Technologie die Schlafökonomie ankurbelt, sind Sie bereit, für Ihren Schlaf zu bezahlen?
Vor Kurzem verstarb Gu Wang, ein Spielemoderator ...
Wie trainieren Sie die Flexibilität Ihres Körpers?
Bei Tänzern oder Kindern ist die Körperflexibilit...
Was sind die besten Indoor-Übungen für Frauen?
Körperliche Betätigung erlangt bei vielen Frauen ...
Pflanzen konnten vor 250 Millionen Jahren die Erde „umgestalten“
Kürzlich konnte ein Team von Pflanzenpaläoökologe...
Zehn Minuten Yoga am Morgen
Wer eine bessere Figur haben möchte, kann jeden M...
Welche Vorteile hat Sport während der Schwangerschaft?
Schwangere dürfen keine anstrengenden Tätigkeiten...
Welche Yoga-Übungen gibt es zur Reduzierung des Armumfangs?
Im Leben höre ich immer wieder, wie manche Freund...
Wirf den kleinen Delphin wie einen Ball zu Tode! Wie erschreckend ist es, dass ein Killerwal sich seit 60 Jahren auf Mobbing konzentriert?
Am 25. Juli 2022 wurde die Killerwalforscherin De...
Erleben Sie „Black Squad: Deadly Assault“, um zu sehen, welche Funken Koreas Nr. 1-FPS-Spiel und LeTV TV erzeugen
Warum spielen so viele Menschen gerne Spiele mit ...
So trainieren Sie die Unterarmmuskulatur
Viele Menschen möchten lieber einen Zentimeter gr...
Was sind die wichtigsten Punkte bei den Decline Dumbbell Flys?
Ich glaube, dass viele Freunde, die Fitness liebe...